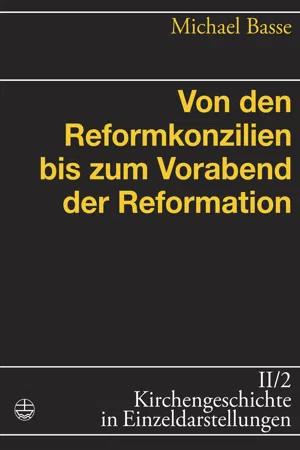![]()
Kapitel 1
Christentum und Gesellschaft
Die Kirche als Institution hat im 15. Jahrhundert – wie zu allen Zeiten – die strukturellen Rahmenbedingungen für die Glaubensgemeinschaft der Christen markiert, aber auch außerhalb dieses institutionellen Rahmens wurde christlicher Glaube gelebt und praktiziert. Dabei gestaltete sich das Verhältnis zwischen „offizieller“ und „inoffizieller“ Religiosität jedoch nicht antagonistisch, sondern dialektisch. Die Religion spielte eine wichtige Rolle bei der Identitätsbildung sozialer Gruppen von der Sippe über die kommunale, die regionale und die nationale Ebene bis hin zum Corpus Christianum als einer transnationalen Größe. Entsprechende historische Traditionen, wie sie vor allem in der Historiographie konstruiert und in der Erinnerungskultur rezipiert wurden, wiesen stets einen religiösen Bezug auf, indem die gemeinsamen Wurzeln und Grundlagen einer sozialen Gemeinschaft auf bestimmte Ereignisse wie die Christianisierung einer Region oder die Entstehung eines lokalen Kults zurückgeführt wurden.
Kirche und Welt waren bei allen Tendenzen zunehmender Ausdifferenzierung von Gesellschafts- und Herrschaftsstrukturen sowie vielfältiger Lebensformen auch im 15. Jahrhundert noch eng miteinander verflochten. Der gesellschaftlichen Funktion des Christentums korrespondierte seine Bedeutung bei der Begründung und Sicherung politischer Herrschaft. Um die gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt des Christentums in dieser Zeit darzulegen, gilt es zunächst das Wechselverhältnis von Kirche als Institution und Glaubensgemeinschaft aufzuzeigen und dann die spezifische Situation des Christentums in der städtischen und in der ländlichen Gesellschaft zu beschreiben.
A. DIE INSTITUTION KIRCHE UND DIE GEMEINSCHAFT DER GLÄUBIGEN
Die gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen des Spätmittelalters haben die Kirche des 15. Jahrhunderts zu einem facettenreichen Gebilde werden lassen. Die institutionelle Zweiteilung in Klerus und Laien wirkte sich auf den Status, die religiöse Praxis und Wahrnehmungsmuster der Christen aus, war aber nicht für sämtliche Erscheinungsformen und Handlungsfelder des christlichen Glaubens bestimmend. Ergänzt und teilweise überlagert wurde diese Zweiteilung von gesellschaftlich bedingten Stände- und Bildungsunterschieden. Während ein adliger Vertreter des Hochklerus und ein einfacher Mönch oder Landpfarrer bäuerlicher Herkunft darin übereinstimmten, dass ihnen als Mitgliedern des geistlichen Standes eine besondere Rolle in der Kirche zukam, unterschieden sie sich doch deutlich in ihrer gesellschaftlichen Stellung und der damit verbundenen Mentalität, die sich wiederum in ihrem kirchlichen Handeln niederschlug. Prosopographische Studien vermitteln einen Einblick in die schichtspezifischen Vernetzungen von Personengruppen und deren Identitäten. Die Abgrenzung zwischen Klerikern und Laien relativierte sich auch im Blick auf ihre Bildung: Je mehr Laien – gerade auch im wohlhabenderen Bürgertum – lesen und schreiben konnten, um so weniger galt die bis ins Hochmittelalter gültige Gleichsetzung von Kleriker und litteratus. Vielmehr brachten nun gebildete Kleriker und Laien ihre gemeinsame Orientierung an einem Bildungsideal darin zum Ausdruck, dass sie an unzureichend gebildeten Geistlichen Kritik übten.
Bei allen Unterschieden hinsichtlich des gesellschaftlichen Rahmens von Kirche und Religiosität zeichnete sich die Gemeinschaft der Gläubigen aber immer noch durch eine relative Homogenität aus. Über die Ständegrenzen hinweg gab es Gemeinsamkeiten in Bezug auf grundlegende Inhalte und Rituale des christlichen Glaubens, auch wenn deren Konkretion dann wiederum spezifische Prägungen aufwies, wie unterschiedliche Formen der Marienverehrung oder der Wallfahrten verdeutlichen (s. Kap. ). Häretische Bewegungen, wie sie in den vorangegangenen Jahrhunderten die Einheit der Kirche bedroht hatten, spielten mit Ausnahme der Hussiten sowie der Waldenser, die weit verstreut in den Alpen Zuflucht gefunden hatten, keine große Rolle mehr. Trotz aller Kritik an der kirchlichen Hierarchie und ihren Funktionsträgern war eine dezidierte Kirchlichkeit die religiöse Signatur dieser Zeit. Gemäß dem ekklesiologischen Dogma, dass es außerhalb der Kirche kein Heil geben könne, vertrauten die Gläubigen nicht nur auf die Heilsmittlerschaft der Kirche und nahmen die von ihr angebotenen Mittel geradezu sehnsüchtig an, sondern die Motivation zur Erneuerung der Kirche führte auch dazu, dass Laien Maßnahmen zur Selbsthilfe ergriffen, indem sie Klosterreformen vorantrieben und Predigtpfründen stifteten.
Eine Sonderstellung nahmen die ‚Semireligiosen‘ ein, die eine geistliche Lebensform praktizierten, ohne doch einer festen Ordensregel zu folgen. Sie übten eine große Anziehungskraft vor allem auf bestimmte Kreise der städtischen Bevölkerung aus, was der allgemeinen „Tendenz zur religiösen Regulierung des Laienlebens“ entsprach. Das Semireligiosentum wies eine große Bandbreite von Erscheinungsformen auf, die sich hinsichtlich ihrer jeweiligen Zusammensetzung, ihrer Zielsetzung und Organisation sowie ihrer Stellung zur Amtskirche voneinander unterschieden. Dazu zählten Inklusen (Männer und Frauen, die sich zu Gebet und Askese völlig zurückgezogen haben), Konversen (Laienbrüder) und Donaten (Gläubige, die ein wieder lösbares Versprechen klösterlichen Lebens ablegten) ebenso wie ‚Verbrüderungen‘ und andere religiöse Gemeinschaften, in denen monastische und laikale Lebensform miteinander vermischt waren. Sie boten Gläubigen die Möglichkeit, mit einem höheren Grad der Verbindlichkeit als von den Bruderschaften abverlangt ein geistliches Leben zu führen, ohne in einen Orden eintreten zu müssen. Insbesondere Frauen, denen ansonsten der Zugang zu Liturgie und Theologie vielfach versperrt war, konnten auf diesem Wege ihren religiösen Neigungen und Bedürfnissen nachgehen. Damit einher ging eine soziale Absicherung, denn die Zugehörigkeit zu einer geistlichen Gemeinschaft verbesserte die soziale Lage und das Ansehen insbesondere der Frauen aus unteren Gesellschaftsschichten und Randgruppen.
Die Amtskirche wurde in ihrer institutionellen Verfassung auch im späten Mittelalter vom Adel dominiert. Die überwältigende Mehrheit der Bischöfe gehörte dem Hochadel an, und dieser besetzte auch die meisten Führungspositionen in der Ämterhierarchie der Kirche. Das resultierte aus der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung dieser Ämter und den damit verbundenen Herrschaftsinteressen. In der Konsequenz führte das zur Trennung der weltlichen und der geistlichen Funktionen, die mit einem kirchlichen Amt verknüpft waren, so dass teilweise Stellvertreter mit den genuin geistlichen Aufgaben betraut waren, während der Amtsinhaber weltlichen Dingen nachging. Das konnte – musste aber nicht zwangsläufig – bedeuten, dass die geistlichen Pflichten vernachlässigt wurden, zumal die Tendenz vorherrschte, die Stellvertreter – die sogenannten Leutpriester, Plebane oder Vikare – schlecht zu bezahlen, weshalb diese oft auch nur unzureichend ausgebildet waren. Diese Entwicklung vollzog sich aber nicht nur in der vom Adel dominierten Reichskirche, sondern auch im Niederkirchenbereich.
Die wirtschaftliche und kulturelle Anziehungskraft der Städte, die nicht allein durch die Pest und die daraus resultierende Landflucht zu erklären ist, hatte eine „Urbanisierung der Kirche“ zur Folge. Das entsprach den Interessen städtischer Umlandpolitik und bedeutete für die Kirche auf dem Land, dass sie einer städtischen Kirche bzw. einem Kloster oder Stift inkorporiert (einverleibt) werden konnte, indem diesen die entsprechenden Pfarrrechte und Pfründen übertragen wurden. In der Regel amtierten in solchen inkorporierten Pfarreien wiederum Vikare. So entstand ein Klerikerproletariat, das am Existenzminimum lebte und oft von einer Pfarrstelle zur nächsten wandern musste. Die Lebenssituation dieser Kleriker hat Sebastian Brant (1457 / 58–1521) im ‚Narrenschiff‘ mit scharfer Kritik an den gesellschaftlichen und kirchlichen Verhältnissen auf den Punkt gebracht: „Kein ärmer Vieh auf Erden ist / Als Priesterschaft, der Brot gebrist.“ Gleichwohl nahm die Zahl derer, die ein geistliches Amt anstrebten, stetig zu, weil man sich letzten Endes doch eine hinreichende Versorgung versprach. Die Kumulation von Pfründen verstärkte noch das Einkommens- und Bildungsgefälle unter den Klerikern. Zudem war der Inhaber einer Pfründe nicht ständig vor Ort, soweit die Residenzpflicht das nicht von ihm verlangte oder er sich davon nicht dispensieren, d. h. freistellen lassen konnte. Nicht nur die höheren Würdenträger, sondern auch der niedere Klerus war bestrebt, wenn möglich in der Stadt zu wohnen und die Betreuung der Gemeinde einem Stellvertreter zu überlassen. Die feudalrechtliche Verknüpfung eines kirchlichen Amtes mit einer Pfründe, die dem Amtsinhaber ein wirtschaftliches Einkommen sicherte, förderte das Bestreben, solche Ämter mit politischem Einfluss und Geld zu erwerben. Der Augustiner-Eremit Gottschalk Hollen (um 1411–1481) brachte das kritisch zum Ausdruck, indem er beklagte: „O, wieviele Brüder und Nachahmer hat Judas auch heute noch, die Christus verkaufen: jene verfluchten Simonisten, die ihre Benefizien verschachern, als wären es Pferde oder Rinder!“ Die prinzipielle Einsicht in die Notwendigkeit kirchlicher Reformen führte zusammen mit den Bestrebungen zur institutionellen Zentrierung der Amtskirche in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts dazu, dass reformwillige Bischöfe auf Veränderungen drängten. So beanspruchten sie auch wieder verstärkt das Visitationsrecht, gegen das allerdings von Seiten der Klöster und der weltlichen Herrscher zum Teil Widerstand geleistet wurde.
In der Struktur der kirchlichen Hierarchie dominierten die Bischöfe, während die Metropoliten ihre Macht längst eingebüßt hatten. Diese Entwicklung entsprach den Interessen der römischen Kurie, die damit eine konkurrierende Zentralgewalt in den Kirchenprovinzen verhinderte. Auf der Ebene der Bistümer besaß der Bischof die kirchenrechtliche Gewalt und hatte die Aufgabe, die General- oder Diözesansynode zu leiten. Dieses Gremium, das selbst nur beratende Funktion hatte, spielte „eine herausragende Rolle in der Vermittlung und Popularisierung des päpstlichen Dekretalenrechts für den Niederklerus ohne juristische Ausbildung und sogar für Laien“. Jeder Pfarrer sollte eine Abschrift der Synodalgesetze besitzen und seine Gemeinde über ihre Bestimmungen unterrichten. Die Archidiakone (Stellvertreter des Bischofs) und Landdekane waren verpflichtet, die Kenntnisse der Pfarrer bezüglich der Statuten zu überprüfen. Diesem Ziel dienten Visitationen mit entsprechenden Handreichungen, die allerdings im 15. Jahrhundert „nur in unregelmäßigen und langen Zeitabständen“ durchgeführt wurden, so dass sich die faktische Beachtung der normativen Vorgaben nur schwer ermitteln lässt. Nach den Vorstellungen des Konzils von Basel sollten die Synoden für die Durchführung der Kirchenreform sorgen.
Der Einfluss, den ein Bischof auf den Klerus seiner Diözese ausüben konnte, hing von den jeweiligen Strukturen und Machtverhältnissen ab. Eine wichtige Rolle spielten die Domkapitel, denen das Recht der Bischofswahl zustand und die ihre eigenen Interessen verfolgten, indem sie den Kandidaten auf bestimmte Zusagen, die sogenannten Wahlkapitulationen, verpflichteten. Die personengeschichtliche Erforschung des Speyerer Domkapitels liefert ein typisches Beispiel dafür, wie ein adliger Personenverband seinen Einfluss über ein enges Geflecht verwandtschaftlicher, freundschaftlicher und regionaler Beziehungen geltend machen konnte. Eine solche Patronage (Günstlingswirtschaft) und der damit verbundene Nepotismus (Vetternwirtschaft) waren durchaus üblich und wurden nicht in Frage gestellt, solange sie nicht als Zumutung empfunden wurden. Im Zusammenhang mit der kirchlichen Reformbewegung des 15. Jahrhunderts wurde daran allerdings scharfe Kritik geübt, und an der Entwicklung in der Diözese Straßburg lässt sich ablesen, dass sich die enge Verbindung zwischen lokalen gesellschaftlichen Eliten und dem Klerus nach 1450 signifikant auflöste.
Dem Einfluss des Bischofs stand vor allem das weit verbreitete Patronatswesen im Wege. Nach wie vor war es gängige Praxis, dass der Patron die entscheidende Rolle bei der Besetzung von Pfarrstellen spielte. Solche Patronatsrechte konnten Einzelpersonen oder auch Personenverbände wie Genossenschaften und Kommunen innehaben. Das Recht einer Gemeinde, den Pfarrer selbst zu wählen, blieb die Ausnahme, wenngleich solche Pfarrerwahlen mit dem blühenden Stiftungswesen zunahmen. Innerhalb der Gruppe der weltlichen Patronatsherren gab es im späten Mittelalter „bedeutende Verlagerungen“, die für die Pfarreien unmittelbare Konsequenzen hatten. Während die Territorialherren darum bemüht waren, ihr landesherrliches Kirchenregiment auszubauen und deshalb die Besetzung wichtiger Pfarrstellen zu kontrollieren, trat der übrige Adel einen Großteil seiner Patronatsrechte an Klöster und Stifte ab, die ihrerseits danach strebten, solche Pfarreien zu inkorporieren und damit deren geistliche wie vermögensrechtliche Eigenständigkeit aufzuheben. Das durchaus spannungsgeladene Zusammenspiel von geistlicher und weltlicher Obrigkeit zeigte sich auf der Ebene der Pfarreien und Messpfründen daran, dass die Kirche mit der weltlichen Gewalt kooperieren musste...