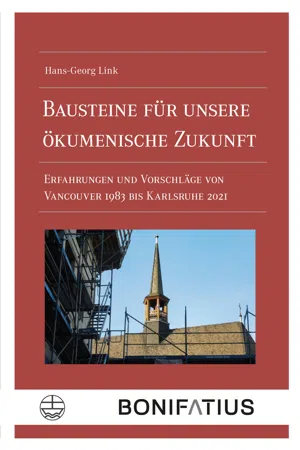![]()
III. Gesichtspunkte
Theologische Beiträge zu Kernfragen der ökumenischen Bewegung
![]()
Der biblische Kanon in ökumenischer Sicht*
I. Umgangsweisen mit der Schrift
1. In den orthodoxen Kirchen
In den orthodoxen Kirchen erreicht die Feier der Göttlichen Liturgie mit dem kleinen Einzug ihren ersten Höhepunkt: Der Priester mit dem Evangelienbuch und der Diakon mit dem Weihrauchfass durchschreiten die Ikonenwand zu dem kleinen Umzug in der Kirche, der »das Buch der Bücher« allen Anwesenden erst einmal sinnenfällig vor Augen führt. Bevor der Priester die Schrift auf dem (beweglichen) Ambo niederlegt, neigt er sie in alle vier Himmelsrichtungen, um ihre weltumspannende Bedeutung zu verdeutlichen. Der Diakon kündigt mehrfach mit dem Ruf »Weisheit« die Lesungen an und fordert die Gemeinde zur Aufmerksamkeit auf. Nach der Verlesung des Evangeliums bringt der Priester seine Verehrung für die laut gewordene Weisheit Gottes durch Verneigen und Berühren des Buches zum Ausdruck. Die Gemeinde antwortet mit verschiedenen Doxologien. Wer diesen bis in altkirchlicher Zeit zurückreichenden Ritus des kleinen Einzuges heute mitvollzieht, der wird sich nicht nur durch die ausdrucksstarke Symbolsprache angesprochen fühlen, sondern in ihr auch eine tiefe Hochachtung vor der Schrift und insbesondere vor dem Evangelium zum Ausdruck gebracht sehen. Die Predigt folgt häufig erst nach Abschluss der Göttlichen Liturgie, meist frei und nicht von der Kanzel herab gehalten, nicht immer ganz tiefschürfend, dafür aber auf das alltägliche Leben bezogen, sozusagen als gute Ratschläge für den Weg durch die Woche. Sie bildet die Brücke zwischen der »Göttlichen Liturgie« und der »Liturgie nach der Liturgie« im Alltag der Welt.
2. In der römisch-katholischen Kirche
Innerhalb der römisch-katholischen Kirche hat sich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch im Blick auf den Umgang mit der Schrift ein tiefgreifender Wandel vollzogen. Mit der dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung »Dei Verbum« von 1965 hat sich erstmals in der Geschichte ein Konzil derart ausführlich und positiv zum Thema »Wort Gottes« geäußert. Die Konstitution über die heilige Liturgie von 1963 »Sakrosanctum Concilium« hat mit der Einführung der Landessprache zugleich auch dem gesamten Wortgottesdienst innerhalb der Meßfeier ein neues Gewicht verliehen. Seitdem sind mehrere Lesungen und eine Homilie im Anschluss an das Evangelium in der Messe zur Selbstverständlichkeit geworden. Die enge Zusammengehörigkeit von Wort- und Feierteil im eucharistischen Gottesdienst wird nachdrücklich unterstrichen. Diese Änderungen im Vollzug der Liturgie der Kirche wären ohne eine vorausgegangene jahrzehntelange Annäherung zwischen evangelischen und katholischen Exegeten nicht möglich geworden. Der vom Benziger und Neukirchener Verlag herausgegebene »Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament« (EKK) ist die bislang wohl ergiebigste Frucht dieses Annäherungsprozesses im deutschsprachigen Bereich.
3. In den reformatorischen Kirchen
Die reformatorischen Kirchen haben einen vielfältigen Umgang mit der Schrift entwickelt. Seit Luthers Zeiten steht der Predigtgottesdienst nach wie vor im Mittelpunkt des kirchlichen Lebens, wenn er auch in eine unübersehbare Krise geraten ist. Daneben sind informelle Bibelauslegung, gemeinsames und individuelles Bibellesen zu wesentlichen Elementen evangelischer Tradition geworden. In der reformierten Kirche hat die fortlaufende Bibellese, die lectio continua, ihren besonderen Platz, und die seit über 250 Jahren erscheinenden Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine sind heute weltweit verbreitet. Auch die Entwicklung der Bibelwissenschaft zu ihrem heutigen Niveau gehört zum guten Erbe der reformatorischen Kirchen. Im Widerstand der Bekennenden Kirche gegen den Nationalsozialismus ist es zu einer Wiederentdeckung des Wortes Gottes und seines Anspruchs auf alle Bereiche unseres Lebens gekommen.
4. In der ökumenischen Bewegung
Auf diesem Hintergrund der orthodoxen, katholischen und reformatorischen Traditionen wird es verständlich, dass sich die ökumenische Bewegung in unserem Jahrhundert wesentlich als Bibelbewegung etabliert hat. Denn die Gottesdienste, zu denen sich die Angehörigen der verschiedenen Kirchen zusammenfanden, waren von Anfang an bibelbezogene Wort-Gottesdienste und sind es größtenteils bis heute geblieben: Lesung und Auslegung der Schrift stehen im Mittelpunkt, Lieder und Gebete gehören mit dazu. Unbestreitbar handelt es sich dabei um eine einfache Form des Gottesdienstes, die vielfältigen liturgischen Reichtum vermissen lässt und deswegen je länger desto unbefriedigender wird. Sie hat aber den Vorteil des Schlichten, auf die gemeinsame ökumenische Grundlage in der Schrift immer wieder zurückzuführen. Um diese grundlegende gemeinsame Orientierung der ökumenischen Bewegung festzuschreiben, ist die Formulierung »gemäß der Heiligen Schrift« (vgl. 1. Korinther 15,3 f.) 1961 in die Basis des Ökumenischen Rates aufgenommen worden.
Diese ökumenische Betonung der Schrift hat schon vielfältige Früchte gezeitigt: Im deutschsprachigen Raum gibt es erfreulicherweise seit einigen Jahren einen ökumenischen Bibelleseplan und die Einrichtung ökumenischer Bibelwochen. Der Ökumenische Rat unterhält praktisch seit seiner Gründung eine Abteilung für biblische Studien. Seit 20 Jahren kommen Vertreter der katholischen Kirche sowie des Ökumenischen Rates jährlich zu einer Tagung zusammen, um die Bibeltexte für die »Gebetswoche für die Einheit der Christen« gemeinsam auszuwählen und auszulegen. Die sog. Lima-Liturgie von 1982, das ökumenische Formular eines Abendmahlsgottesdienstes, hat sich die Erfahrung verschiedener Kirchen im gottesdienstlichen Umgang mit der Schrift zunutze gemacht: Der »Wortgottesdienst« beginnt – so war es jedenfalls in Vancouver 1983 – mit einer feierlichen Bibelprozession zum Altar. Auf das Kollektengebet folgen eine alttestamentliche, eine Epistel- und eine Evangelienlesung, von der Gemeinde jeweils mit Responsorien beantwortet. An die Predigt schließt sich eine ausgiebige meditative Stille an, manchmal von entsprechender Musik begleitet, die dem Teilnehmer Zeit lässt, das Gehörte zu überdenken. Zum Abschluss wird der in den Alltag der Welt zurückkehrenden Gemeinde vor dem Segen die Kernaussage des Evangeliums als Sendungswort mit auf den Weg gegeben.
5. Bibel-Teilen in Lateinamerika und Europa
Seit Ernesto Cardenal die Gespräche mit seiner Gemeinde in Lateinamerika über das Leben Jesu veröffentlicht hat (auf Deutsch erstmals 1976 »Das Evangelium der Bauern von Solentiname«), breitet sich in ökumenischen Kreisen das sog. Bible Sharing, Bibel-Teilen, immer weiter aus. Es ist eine gemeinschaftliche Form des Bibelgesprächs, die als 7-Schritte-Weg bekannt geworden ist:
1. Man bittet um die Gegenwart des Geistes.
2. Der jeweilige Bibeltext wird versweise reihum gelesen.
3. In einer 5- bis 15-minütigen Schweige-Meditation macht sich jeder seine eigenen Gedanken zu dem Text: Unterstreichungen, Kommentare, Fragen.
4. Einzelne bemerkenswerte Worte, Satzteile oder Sätze des Abschnitts werden von Teilnehmern ohne jeden Kommentar laut in die Runde gesprochen – der Text erhält dadurch sein Gruppen-Profil.
5. Bemerkungen, Fragen und Antworten schließen sich an, aber keine eigentliche Diskussion. Jeder Teilnehmer wird mit dem akzeptiert, was er beitragen will.
6. Überlegungen zum praktischen Umsetzen des Vernommenen in der Gruppe, Gemeinde und Öffentlichkeit folgen.
7. Gemeinsames Beten und/oder Singen rundet das Bibelgespräch ab.
6. Schlussfolgerungen
Aus diesen Umgangsweisen mit der Schrift innerhalb der ökumenischen Bewegung möchte ich nun einige erste Schlussfolgerungen ableiten.
1. Heutzutage darf man feststellen, dass die Schrift im jeweiligen Gottesdienst der drei christlichen Haupttraditionen, der orthodoxen, katholischen und reformatorischen, an hervorragender Stelle ihren Ort erhalten und ihr Wort zu sagen hat. M. a.W.: Es handelt sich bei der Schrift spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht mehr um protestantisches Sondergut, das sich als Schibboleth gegen die katholische oder orthodoxe Tradition ins Feld führen ließe. Stattdessen haben reformatorische Kirchen innerhalb der ökumenischen Bewegung dieses Jahrhunderts maßgeblich dazu beigetragen, die Schrift auch in den anderen Kirchen zu beheimateten. Wir haben es dabei mit einem Vorgang von ökumenischem Teilen der Gaben zu tun, über den man sich nur von Herzen freuen kann. Damit hat die Schrift seit 1965 – der Proklamation von Dei Verbum – ihre traditionelle kontroverstheologische Rolle endgültig ausgespielt und ist zur ökumenischen Grundlage der Christenheit geworden.
2. Seit den Anfängen der ökumenischen Bewegung hat die Schrift ihre hervorragende Eignung als gemeinsamer Anknüpfungspunkt der verschiedenen Kirchen erwiesen. Ökumenische Gottesdienste sind ohne die Schrift undenkbar und undurchführbar. Bi- und multilaterale theologische Dialoge kommen ohne das Gespräch über entsprechende Schriftstellen zu keinen tragfähigen Ergebnissen. Manche ökumenische Gruppe überlebt seit Jahrzehnten dank ihrer gewachsenen Gem...