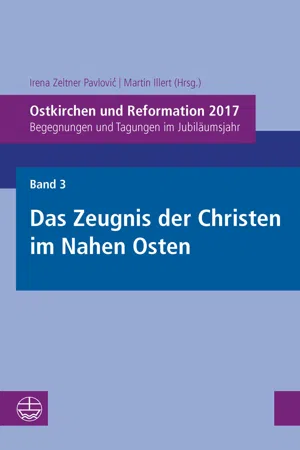
Ostkirchen und Reformation 2017
Begegnungen und Tagungen im Jubiläumsjahr. Band 3: Das Zeugnis der Christen im Nahen Osten
- 392 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
Ostkirchen und Reformation 2017
Begegnungen und Tagungen im Jubiläumsjahr. Band 3: Das Zeugnis der Christen im Nahen Osten
About this book
Thema dieser Dokumentationsbände ist die Begegnung zwischen den Ostkirchen und den Kirchen der Reformation. Sie verbinden exegetische, historische und hermeneutische Perspektiven auf Orthodoxie und Protestantismus mit aktuellen ökumenischen Fragestellungen.Band 1 vereint die Beiträge des Erlanger Symposiums "Hermeneutik und Hermeneuten" mit den Vorträgen der Eichstätter Tagung "Reformation und die Ostkirchen" und der bilateralen theologischen Dialogbegegnung zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Rumänischen Orthodoxen Kirche zum Thema "Die Erneuerung der Kirche".Band 2 dokumentiert die Verleihung der Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät Tübingen an den Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I sowie die begleitende Tübinger Tagung "Freiheit aus orthodoxer und evangelischer Sicht" und ergänzt diese durch hier erstmals in deutscher Sprache publizierte Aufsätze des Ökumenischen Patriarchen zu kirchenhistorischen, liturgischen, dogmatischen, ethischen und ökologischen Fragen.Band 3 enthält die Vorträge des Berliner altorientalisch-evangelischen Dialoges zur "Zukunft des Christentums im Nahen Osten" und des Moskauer bilateralen theologischen Dialoggespräches zwischen dem Moskauer Patriarchat und der EKD zu "Martyrium und christlichem Zeugnis".Mit Beiträgen von Daniel Benga, Christoph Böttigheimer, Elpidophoros Lambriniadis, Hacik Rafi Gazer, Heta Hurskainen, Martin Illert, Christof Landmesser, Patriarch Bartholomaios I, Elisabeth Gräb-Schmidt, K. M. George, Viorel Ionita, Assaad Kattan, Wolfgang Schwaigert, Aho Shemunkasho, Papst Tawadros II, Reinhard Thöle, Athanasios Vletsis, Irena Zeltner-Pavlovic u.a.[Eastern Churches and Reformation 2017. Encounters and Conferences in the Year of the Anniversary]The present volumes deal with the encounter between the Eastern Churches and the Churches of the Reformation. They combine exegetical, historical and hermeneutical perspectives on Orthodoxy and Protestantism together with current ecumenical questions.The first volume unites the contributions of the Erlangen symposium on hermeneutics, the papers of the Eichstätt conference on the Reformation and the Eastern Churches, and of the bilateral-theological dialogue-meeting on the renewal of the Church between the Evangelical Church in Germany and the Romanian Orthodox Church.The second volume contains the papers of conference on the theological understanding freedom in the orthodox and the protestant tradition plus a collection of essays on theological, ethical and ecological matters by Patriarch Bartholomew I.The third volume documents the theological dialogue between the oriental-orthodox Churches and the Evangelical Church in Germany on the future of Christianity in the Near East and the bilateral dialogue between the evangelical church in Germany and the Moscow Patriarchate on martyrdom and Christian witness.
Frequently asked questions
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Information
ANHANG 1: EVANGELISCHE UND ORTHODOXE BEITRÄGE AUS DEM RUSSISCH-DEUTSCHEN GESPRÄCH ZUR SOZIALETHIK
CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN VON INKLUSION AM BEISPIEL DES PAPIERS INKLUSION LEBEN DER EVANGELISCHEN KIRCHE IN DEUTSCHLAND
Table of contents
- Cover
- Titel
- Impressum
- Geleitwort
- Inhalt
- Bischöfin Petra Bosse-Huber: Begrüßung der altorientalischen Kirchenoberhäupter und ihrer Delegationen im Namen der Evangelischen Kirche in Deutschland am 18. Oktober 2017 in Berlin
- Kardinal Reinhard Marx: Grußwort anlässlich der Begegnung mit Oberhäuptern der orientalisch-orthodoxen Kirchen am 19. Oktober 2017 in Berlin
- BILATERALER DIALOG DER EVANGELISCHEN KIRCHE IN DEUTSCHLAND MIT DEN ALTORIENTALISCHEN KIRCHEN, BERLIN, 20 21. OKTOBER 2017
- ERÖFFNUNG DER KONFERENZ, WORTE DER VORSTEHER DER ALTORIENTALISCHEN KIRCHEN UND GRUÿWORTE DER ÖKUMENISCHEN GÄSTE
- DAS GEGENWÄRTIGE ZEUGNIS DER CHRISTEN IM NAHEN OSTEN
- ERFAHRUNGEN IN BEGEGNUNG UND DIALOG
- LERNRAUM DIASPORA
- FÜRBITTGOTTESDIENST FÜR DIE CHRISTEN IM NAHEN OSTEN, BERLIN, 21. OKTOBER 2017
- BEGRÜßUNG IM NAMEN DER DOMGEMEINDE UND GEISTLICHE WORTE DES RATSVORSITZENDEN, DER VORSTEHER DER ALTORIENTALISCHEN KIRCHEN UND DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ
- BILATERALER THEOLOGISCHER DIALOG ZWISCHEN DER EVANGELISCHEN KIRCHE IN DEUTSCHLAND UND DEM MOSKAUER PATRIARCHAT, MOSKAU, 01. BIS 03. NOVEMBER 2017
- ANHANG 1: EVANGELISCHE UND ORTHODOXE BEITRÄGE AUS DEM RUSSISCH-DEUTSCHEN GESPRÄCH ZUR SOZIALETHIK
- ANHANG 2: »[…] DAMIT IHR NICHT TRAURIG SEID«: CHRISTLICHER UMGANG MIT STERBEN UND TOD. EINE HANDREICHUNG DER ORTHODOXEN BISCHOFSKONFERENZ IN DEUTSCHLAND UND DER EVANGELISCHEN KIRCHE IN DEUTSCHLAND
- Empfehlungen
- Beitragende
- Weitere Bücher