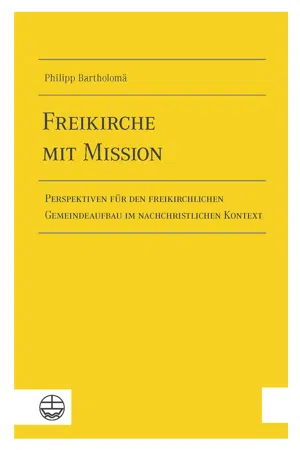![]()
1.EINLEITUNG
1.1.FREIKIRCHEN ALS FORSCHUNGSGEGENSTAND: EINE ANNÄHERUNG AUS MISSIOLOGISCHER PERSPEKTIVE
Die Anfänge der evangelischen Freikirchen in Deutschland reichen zum Teil bis in die Zeit der Reformation zurück. Die sogenannten ›klassischen‹ Freikirchen, die in dieser Studie im Vordergrund stehen (siehe 1.2.1.), entstanden schließlich ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Freikirchen unterscheiden sich von den traditionellen Großkirchen nicht durch Sonderlehren, sondern in erster Linie durch ein bestimmtes ekklesiologisches Verständnis und ihre ausgeprägte Glaubenspraxis.1 Bei aller Unterschiedlichkeit zwischen einzelnen freikirchlichen Strömungen und Traditionen,2 lässt sich das Phänomen der ›Freikirchen‹ doch annäherungsweise durch die folgenden vier Merkmale bestimmen:
(1)das Prinzip der ›Freiwilligkeit‹, wonach das aus einer individuellen Bekehrung entspringende persönliche Glaubensbekenntnis entscheidend für die Mitgliedschaft in der Kirche ist;
(2)die Trennung der Kirche vom Staat, was einerseits die Ablehnung staatlicher Reglementierung bedeutet, gleichzeitig aber die Entscheidung beinhaltet, bewusst auf Privilegien von Seiten des Staates zu verzichten;
(3)die Förderung des ›Priestertums aller Gläubigen‹, womit die aktive Mitgestaltung des gemeindlichen Lebens durch alle Glieder (und nicht nur durch die Amtsträger) gemeint ist;
(4)die starke Betonung von Evangelisation und Mission, weshalb man die freikirchliche Bewegung durchaus auch als ›Konversionschristentum‹ bezeichnen kann.3
Während der Kenntnisstand über Freikirchen in der Bevölkerung weiterhin meist sehr gering ist, haben sie als Forschungsgegenstand in den vergangenen Jahrzehnten vermehrt Aufmerksamkeit erfahren. Gerade aus historischer und systematischer Sicht sind Freikirchen als Kollektiv inzwischen recht gut erfasst und in verschiedenen Grundlagenwerken zugänglich gemacht.4 Ähnliches gilt für die jeweils spezifische Geschichte und besondere theologische Ausprägung der einzelnen freikirchlichen Denominationen.5 Im deutschsprachigen Kontext hat sich vor allem der 1990 gegründete Verein für Freikirchenforschung um die Untersuchung von theologischen und historischen Fragestellungen aus freikirchlichem Blickwinkel verdient gemacht. Über die Jahre sind eine ganze Reihe von Bänden der Zeitschrift Freikirchenforschung mit Beiträgen zu unterschiedlichsten Themenschwerpunkten erschienen, darunter u. a. die Rezeption der Reformation durch die Freikirchen, Freikirchen als [kirchliche wie gesellschaftliche] Außenseiter, das Verhältnis von Freikirchen zur Gemeinschaftsbewegung, zur charismatischen Bewegung bzw. zu neueren, unabhängigen Gemeinden, Freikirchen zur Zeit des Nationalsozialismus, oder die Problematik enttäuschter Aussteiger aus Freikirchen verbunden mit dem Thema der Dekonversion.
Aus praktisch-theologischer Perspektive ist es nun allerdings verwunderlich, dass angesichts der bei Freikirchen traditionell starken Betonung von Bekehrung, Mission und Gemeindewachstum gerade der spezifisch missiologische Aspekt des freikirchlichen Gemeindeaufbaus bisher kaum ins Blickfeld intensiverer Forschung gerückt wurde. Dies erscheint umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass in jüngerer Zeit immer häufiger zu hören ist, die Zukunft der Kirche sei freikirchlich. So hat Miroslav Volf in seiner einflussreichen freikirchlichen Ekklesiologie nachdrücklich betont, weltweite Entwicklungen deuteten darauf hin, dass das protestantische Christentum in der Zukunft eine weitestgehend freikirchliche Form annehmen werde.6 Ähnlich hat einer der einflussreichsten deutschen Theologen des 20. Jahrhunderts, Jürgen Moltmann, kürzlich in einem Aufsehen erregenden Interview bemerkt: »Die Zukunft der Volkskirche ist freikirchlich!«7 Damit ist zunächst natürlich nicht mehr ausgesagt, als dass die Zukunft der Kirche eine »freiere und freiwilligere« sein wird.8 Und auch Volf will seine Aussage explizit nicht so verstanden wissen, dass die »Rettung« des Christentums quasi automatisch von christlichen Gemeinschaften freikirchlicher Prägung zu erwarten sei.9 Doch nichtsdestotrotz drängt sich angesichts solcher Zukunftsprognosen die Frage auf, ob es neben der vorhergesagten Zukunftsfähigkeit des Typs ›Freikirche‹ auch andere Anzeichen dafür gibt, dass Freikirchen inmitten des massiven gesellschaftlichen Wandels tatsächlich in besonderem Maße in der Lage sind, missionarische Stoßkraft zu entfalten. Mit anderen Worten: Sind Freikirchen aufgrund ihrer ekklesiologischen Identität und ihren charakteristischen Merkmalen in besonderer Weise geeignet, christliche Erneuerungs- und gemeindliche Wachstumsprozesse in einem zunehmend säkularer werdenden Kontext zu initiieren und zu gestalten?
Abgesehen von einzelnen, verstreuten Hinweisen und Anmerkungen sind mir für den deutschsprachigen Kontext bisher lediglich zwei Studien bekannt, die sich aus jeweils unterschiedlichen Blickwinkeln mit Facetten der angedeuteten Fragestellung befasst haben. Sabine Schröder hat 2007 unter dem Titel Konfessionslose erreichen eine auf den Osten Deutschlands begrenzte empirische Untersuchung freikirchlicher Gemeindegründungen vorgelegt.10 Sie knüpft dabei an den vielfach geäußerten Standpunkt an, wonach sich im konfessionslosen, areligiösen Osten Deutschlands entscheiden werde, ob der christliche Glaube in seiner kirchlichen Gestalt in der säkularisierten Gesellschaft Deutschlands überhaupt noch missionarische Wirksamkeit entfalten könne.11 Auch Freikirchen geben hier zunächst wenig Anlass zur Hoffnung. Denn Schröder kommt zu dem eher ernüchternden Ergebnis, dass selbst neue, freikirchliche Gemeindegründungen »genauso wenig ein Mittel darstellen, Ostdeutschland mit dem Evangelium zu erreichen, wie die etablierten Kirchen vor Ort«. Das habe vor allem mit einem Mangel an Inkulturation zu tun, wobei »die besonderen gesellschaftlichen Bedingungen in Ostdeutschland nicht genügend reflektiert werden« und folglich eine gezielte, kontextsensible Auseinandersetzung mit spezifisch ostdeutschen Mentalitäten kaum stattfinde.12 In der Regel würden freikirchliche Angebote, »nicht auf Konfessionslose abgestimmt, die doch über 70 Prozent der Bevölkerung ausmachen, sondern auf Menschen, die noch irgendeine Verbindung zur Kirche oder zum Christentum haben«. Schröder beklagt in diesem Zusammenhang, dass sich die Hoffnung, freikirchliche Gemeindegründungen könnten der »Minorisierung« und »Marginalisierung« der christlichen Kirche etwas Substanzielles entgegensetzen, bisher nicht erfüllt habe. Stattdessen sei die Frage in den Vordergrund zu rücken, »warum die Freikirchen in ihrem Bemühen um die konfessionslose Bevölkerung ähnlich erfolglos blieben wie zumeist die Volkskirche«.13 Durch die erlernte Konfessionslosigkeit sei in Ostdeutschland eine religiöse Sprachlosigkeit entstanden, die es auch Freikirchen »schwer macht zu verdeutlichen, wie der christliche Glaube im Alltag erfahren und gelebt werden kann«.14 Es bestehe ein »Verständigungsgraben«15 zwischen Freikirchen und der für den Glauben zu gewinnenden Bevölkerung und es scheint auch Freikirchen bisher nicht ausreichend gelungen, angesichts der weitverbreiteten religiösen Indifferenz sprachfähig und damit missionarisch effektiv zu werden. Ohne tieferes Verständnis der »andersgearteten Sozialisation«16 und ohne eine bewusster kontextualisierte Gemeindebaupraxis wird sich, so könnte man im Anschluss an Schröders Studie prognostizieren, angesichts der gesellschaftlichen Realitäten im Osten Deutschlands auch im Rahmen der Freikirchen keine signifikante missionarische Durchschlagskraft entfalten.
Auf den ersten Blick positiver stimmt eine von Forschern der Universität Lausanne und des Institut de Sciences Sociales des Religions Contemporaines durchgeführte empirisch-religionssoziologische Untersuchung der evangelischen Freikirchen in der Schweiz aus dem Jahr 2014 mit dem Titel Phänomen Freikirchen.17 Anhand einer repräsentativen quantitativen Erhebung und weiteren qualitativen Untersuchungen kommen die Autoren zu dem Schluss, dass es sich bei den Evangelisch-Freikirchlichen um ein äußerst wettbewerbsstarkes religiös-soziales Milieu handele.18 Das evangelisch-freikirchliche Milieu sei »sicherlich eine der innovativsten und dynamischsten Kräfte in der religiösen Szene der Schweiz«19, denn die Zahl der Evangelisch-Freikirchlichen hat sich nach Angaben des Bundesamtes für Statistik zwischen 1970 und 2000 mehr als verdreifacht (auf 112.964). Für 2008 schätzen die Autoren, dass es in der Schweiz zwischen 200.000 und 250.000 Evangelisch-Freikirchliche gibt (d. h. ca. 2,6–3,2 % der Bevölkerung), wozu allerdings auch Kinder, Personen mit Doppelmitgliedschaften (Freikirchen und Landeskirchen) sowie Personen mit freikirchlichem Frömmigkeitstypus in Landeskirchen zählen.20 »In einem von wachsender religiöser Indifferenz und Vielfalt geprägten Kontext stellen die Evangelisch-Freikirchlichen – anders als das katholische und das reformierte Milieu – eine erstaunliche Resistenz unter Beweis«,21 was sich die Schweizer Religionssoziologen anhand ihrer Ergebnisse mit einer Kombination von »sozialer Abschottung« und »hoher Wettbewerbsstärke« erklären: Die freikirchliche (evangelikal geprägte) Identität bleibe auch in einer zunehmend säkularisierten Welt plausibel, weil man sich auf der einen Seite durch gemeinsame Glaubensüberzeugungen, Praktiken, Werte und Normen deutlich profiliere und vom religiösen wie ethischen Relativismus der (Post-)Moderne klar abgrenze. Das gemeinsame Bekenntnis zur Bibel als unangefochtene Autorität nicht nur in Glaubensdingen, sondern gerade auch in Sachen Moral und Verhalten, ziehe eine bewusste, normative Selbstkontrolle nach sich und sorge im Zusammenspiel mit der Sozialkontrolle durch andere Mitglieder und personifizierte Autoritäten (Pastoren, Älteste, sonstige Verantwortungsträger) für die fortdauernde Stabilität freikirchlicher Gruppierungen.22
Auf der anderen Seite agiere man wettbewerbsstark, weil man in ...