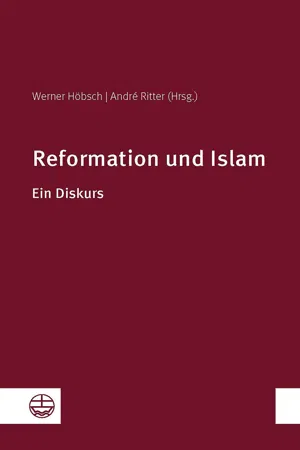![]()
TEIL II
![]()
Athina Lexutt
»und legten die Verhaltensregeln für einen respektvollen Umgang in der Diskussion fest«
Drei Beispiele der Auseinandersetzung mit dem Islam vor der Reformation
Die Herausforderung
Jeder weiß es, und es steht heute zu Recht auf jeder politischen und gesamtgesellschaftlichen Agenda: Spätestens in einer globalisierten Welt und in einer solchen, in der alles nicht mehr als ein paar Mausklicks entfernt ist, sind umfangreiche Kenntnisse unterschiedlichster Zusammenhänge, Geschichtsbewusstsein und ein ethisches Wertegerüst unverzichtbar, wenn diese Mausklicks nicht einen Clash bewirken sollen und das Aufeinandertreffen verschiedenster religiöser, politischer und kultureller Systeme konstruktiv genutzt werden und nicht zu einem Zusammenbruch unter Feindschaft und Gewalt führen soll. Erst recht gilt dies in den letzten Jahrzehnten im Blick auf die Begegnung von Gesellschaften, die aus und mit den Errungenschaften der europäischen Aufklärung wesentliche Momente ihrer Existenz definieren, und solchen, die demgegenüber an voraufklärerischen Strukturen festhalten und dies unter anderem, dann aber umso vehementer mit religiöser Überzeugung und einem religiösen Auftrag begründen. Welche Rolle in diesem Zusammenhang einem gegenseitigen Kennenlernen und einem Dialog auf Augenhöhe zukommt, ist unbestritten, und so ist es in erster Linie der Dialog, der auch mit denen gesucht wird, die wenig dialogbereit erscheinen. Der Dia log als probates Mittel, Toleranz nicht nur als Lippenbekenntnis zu leben, und als ebenso probates Mittel, im verbalen Austausch zu einer tragfähigen Verständigung zu kommen, die mindestens eine gewalttätige Auseinandersetzung verhindern, wenn nicht gar zu einem von Toleranz getragenen Miteinander gelangen, wird daher auf allen Ebenen gesucht. In den letzten Jahren spielt dabei der Dialog auf religiöser Ebene zwischen Christentum und Islam eine zunehmend bedeutende Rolle, da er gerade im Blick auf den politisch orientierten Islam als wichtiges Moment gesamtgesellschaftlicher und kultureller Verständigung gelten muss. Das Impulspapier der EKD »Reformation und Islam« formuliert entsprechend: »Gegenwärtig und zukünftig wird es darauf ankommen, mit dem Erbe der Vergangenheit so umzugehen, dass dadurch Begegnung mit anderen nicht verhindert, sondern ermöglicht und befördert wird. In einer Gesellschaft, die verschiedene Bekenntnisse und Weltanschauungen in sich birgt, ist die eigene theologische Sprach- und Verständigungsfähigkeit immer wieder herausgefordert.«1
Dieses »Erbe der Vergangenheit« soll nun an anderer Stelle als der der Reformation betrachtet werden. Denn vielleicht überrascht es, dass die Einsicht in die Notwendigkeit eines und die Forderung nach einem Dialog nicht so neu sind, wie es auf den ersten Blick scheint. Schon seit dem Aufkommen des Islam im 7. Jahrhundert und vermehrt seit seiner anschließenden Expansion gibt es christlicherseits die Notwendigkeit, aber auch das tiefe Bedürfnis, dieser doch insgesamt als so anders wahrgenommenen Religion zu begegnen. Wie unterschiedlich das Begegnen dabei aussehen konnte, ist allgemein bekannt. Doch wäre es ein gefährlicher Trugschluss, es immer schon als von Gewalt und Missionierungsgedanken durchsetzt zu verstehen. Vielmehr gibt es zahlreiche Beispiele eines mit der Intention des besseren Verstehens geführten Dialogs. Darauf ist vor allem dort und dann zu treffen, wenn eine unmittelbare Nähe, eine Zusammenarbeit, ja ein Zusammenleben es unausweichlich erscheinen lassen, Wege des friedlichen Miteinanders zu beschreiten, voneinander zu lernen, aufeinander zuzugehen. Was uns in den Jahrhunderten vor dem Fall Konstantinopels 1453 und dem darauf folgenden aggressiven Vordringen der Osmanen nach Westen an solchen Beispielen entgegenkommt, zeugt insgesamt von einem ernstzunehmenden Versuch, dem Islam und seinen ansprechbaren Vertretern argumentativ, philosophisch-theologisch fundiert und methodisch nachvollziehbar entgegenzukommen. Drei Beispiele aus dem 14. und 15. Jahrhundert seien daher im Folgenden gewählt, um dies zu verdeutlichen.2
Dialoge mit dem Islam – Drei Beispiele
Die Beispiele sind nicht zufällig aus dem 14. und 15. Jahrhundert gewählt. Die Zeit der Kreuzzüge ist vorbei, die Zeit des nicht immer einfachen, engen Zusammenwirkens von kirchlicher und kaiserlicher Gewalt ebenso. Im Gegenteil schwanken die beiden großen Säulen, die das Mittelalter wesentlich getragen haben, erheblich und haben mit je eigenen Krisen zu kämpfen. Es bahnt sich in diesen Jahrhunderten etwas an, was dann – genährt aus unterschiedlichen Quellen – zu der Explosion führen wird, die uns in der Reformationsepoche begegnen wird.
Dass gerade in dieser Zeit besonders fruchtbare und weitreichende, einflussreiche Auseinandersetzungen mit dem Islam stattgefunden haben, ist auch unter zwei weiteren Gesichtspunkten erstaunlich. Der erste: Zu Beginn des 14. Jahrhunderts erklärt sich Osman I. zum Sultan in Kleinasien und gründet das Osmanische Reich; das ehemals glänzende, als zweites Rom geltende Byzantinische Reich ist unter dem Eroberungswillen und der beanspruchten Deutungshoheit zur Bedeutungslosigkeit verdammt, nur Konstantinopel hält sich noch bis Mitte des 15. Jahrhunderts. Als auch dieses Bollwerk fällt, steigert sich die Furcht vor dem »Türken« unermesslich und wird auf lange Zeit jeden Dialog verunmöglichen, der allerdings auch auf osmanischer Seite nicht gesucht wird. Der zweite Gesichtspunkt: Die letzten maurischen Siedlungen im Westen Europas fallen unter der spanischen Reconquista, jeder arabische Einfluss wird zugunsten einer römisch-katholischen Vorrangstellung zurückgedrängt; der letzte arabische Staat auf europäischem Boden ist Granada, das aber dann 1492 ebenfalls fällt. Dennoch gab und gibt es natürlich Berührungspunkte im oben angesprochenen Sinn, und eben daraus sind auch die drei Beispiele eines direkten oder indirekten Dialogs entstanden, die im Folgenden betrachtet werden sollen.
Raimundus Lullus
Mit Person und Werk des Ramon Lull = Raimundus Lullus3 (1232–1316) begeben wir uns an die Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert. Raimundus wurde in Palma de Mallorca geboren, das zwar vier Jahre zuvor wieder unter christliche Herrschaft gestellt wurde, in dem aber nach wie vor viele Juden und Muslime lebten. Ein Bekehrungserlebnis – eine Vision des Gekreuzigten – brachte Raimundus dazu, ein asketisch-monastisches Leben zu führen, seine Ehe, aus der zwei Kinder hervorgegangen waren, aufzugeben und sich schließlich den Franziskaner-Tertiaren anzuschließen. Wahrscheinlich nicht unbeeinflusst durch sein eigenes Erleben wurde ihm die Bekehrung nunmehr auch Andersgläubiger, die er aus seiner Heimatstadt allzu gut kannte, zu einem wichtigen Auftrag. Und er wusste, dass es dazu nur einen erfolgversprechenden Weg geben konnte: indem er die Sprache dieser Andersgläubigen lernte, um sich umso mehr Kenntnisse über ihre die Religion und Philosophie begründenden Quellen aneignen zu können. Mehr noch bemühte er sich, Missionare in entsprechend ausgerüsteten Schulen und Seminaren auszubilden, die erst die orientalischen Sprachen erlernen sollten, bevor sie sich daran machen durften, auf dem Vernunftweg Andere davon zu überzeugen, dass ihre Quellen nicht die gleiche Strahlkraft und vor allem Vernunftgemäßheit besaßen wie die Heilige Schrift. Wie fortschrittlich seine Überlegungen waren, lässt sich daran ablesen, dass er umgekehrt auch wünschte, muslimische Herrscher wollten Gesandte in christliche Länder schicken, die im gelehrten Dialog ihre Ansichten vertreten sollten. Auch hier war seine Absicht wohl weniger, dass die christlichen Denker vom Islam lernen, sondern dass die muslimischen Gelehrten gewissermaßen vor Ort einen besonders authentischen Eindruck von der Wahrheit des christlichen Glaubens erlangen sollten – aber er dachte an einen echten, friedlichen Austausch. Letztlich sind seine Ideen bei seiner eigenen Obrigkeit nicht gut aufgenommen worden und seine Pläne gescheitert. Was aber blieb, ist ein gesteigertes Bewusstsein von der Notwendigkeit, sich mit den orientalischen Ländern intensiver auseinandersetzen zu müssen und das Erlernen des Arabischen dazu als unbedingte Voraussetzung zu verstehen.
Das zwischen 1275 und 1277 verfasste Werk »Libre del gentil e los tres savis« (»Buch vom Heiden und den drei Weisen«)4 gibt von Raimundus’ Bemühen ein gutes Beispiel. Es handelt sich dabei um eine Erzählung, die von der Begegnung eines nach Wahrheit suchenden Heiden und drei Weisen, die der jüdischen, der christlichen und der muslimischen Religion anhängen, berichtet. Diese treffen sich zufällig und beschließen – ganz analog zu dem, was Raimundus selbst erlebt hatte – einen abgeschiedenen Ort aufzusuchen, an dem sie sich ungestört unterhalten können. Diesen finden sie in einem Hain an einer Quelle, in dem sich die in einer wunderschönen Frau personifizierte Intelligenz aufhält. Die Metaphern sind unübersehbar: Der Hain ist seit jeher ein Ort, an dem sich Mystisches ereignen kann; die Quelle steht für die frische Wahrheit; die Frau könnte auch eine Göttin sein, mindestens aber treffen sich hier das Schöne und das Gute, wie es bei Platon anzutreffen ist, wenn von der Wahrheit die Rede ist. Antikes, neuplatonisches Gedankengut wird bei Raimundus gepaart mit christlich-mystischem Gedankengut, so dass der Weg des Dialogs vorgezeichnet ist: Die Wahrheit ist über die Vernunfterkenntnis zu suchen, und diese wird bei der christlichen Wahrheit ankommen. Auch Raimundus’ Intention ist sofort offensichtlich: Es geht um ein freundliches Gespräch5 im geschützten und unangreifbaren Raum der Weisheit, der es ermöglicht, »durch zwingende Vernunftgründe eine Übereinstimmung« zu finden, wo dies »mit Hilfe von Autoritätsbeweisen«6 nicht möglich ist. Ein immerhin interessanter Gedanke, der einiges von dem preisgibt, was gemeinhin christliche Überzeugung ist: Dass die Schrift als Gottes Wort eine Autorität besitzt, die nicht hinterfragt werden kann, wird hier zugunsten einer allgemein einsehbaren, weil logisch nachvollziehbaren Argumentationsstruktur aufgegeben. Und das zum Zweck, dass »Streit und Hass zwischen den Menschen, die wegen der verschiedenen Glaubensüberzeugungen und der gegensätzlichen Gesetze der Völker entstehen«7 beigelegt werden mögen.
Damit dieser Weg auch wirklich zur Zufriedenheit aller gegangen werden kann, legt Raimundus zu Beginn die Struktur des in vier Bücher gegliederten Werkes und die Gesprächsregeln fest: »Nachdem ich viel Zeit damit zugebracht hatte, an Gesprächen mit Ungläubigen teilzunehmen und ihre irrigen Meinungen kennenzulernen, habe ich […] alle meine Kräfte gesammelt, um mit Hilfe einer neuen Methode und neuartiger Argumente die Irrenden vom Weg des Irrtums abzubringen […]. Jede Kunst, sei es handwerklicher oder wissenschaftlicher Art, erfordert eine eigene Begrifflichkeit, um sich gut verständlich zu machen. Meine Wissenschaft, die sich als beweisende Geisteswissenschaft versteht, verwendet ungebräuchliche und absonderlich klingende Begriffe, die schwer zu verstehen sind. Da mir jedoch das Gemeinwohl sehr am Herzen liegt und ich dieses Buch sowohl für ungebildete Laien wie für fortgeschrittene Denker angelegt habe, ist es zu Beginn unabdingbar, diese Wissenschaft grob zu umreißen. […] Im ersten Buch wird mit zwingenden Argumenten bewiesen, dass Gott existiert […]. Das zweite Buch enthält die Überzeugungen des weisen Juden, der versucht, seinen Glauben gegenüber Islam und Christentum als den besseren zu beweisen. Das dritte Buch führt die Argumente des weisen Christen auf, der seinerseits versucht, den christlichen Glauben gegenüber dem islamischen und jüdischen als den besseren zu erweisen. Im vierten Buch schließlich werden die Gründe des weisen Sarazenen dargestellt, der ebenso zu zeigen versucht, dass sein Glaube dem der Juden und der Christen überlegen ist.«8 Das ist bemerkenswert! Jede der drei monotheistischen Religionen erhält – in der Reihenfolge ihres Alters – Gelegenheit, die Überzeugung von der Wahrheit der eigenen Religion darzulegen. Alle werden unterschiedslos als Weise deklariert, eine irgendwie beabsichtigte Abwertung oder umgekehrt eine Aufwertung einer der Religionen und ihres Vertreters ist nicht zu erkennen. Der kleinste gemeinsame Nenner wird von Raimundus im puren Dass der Existenz des einen Gottes erblickt. Das klingt zunächst nach nicht viel. Aber vergegenwärtigt man sich, dass damit einem eigentlich sehr modernen Gedanken schon im 14. Jahrhundert das Wort geredet wird, ist Raimundus für seine Zeit unglaublich fortschrittlich: Niemandem wird der Glaube abgesprochen, weil sein Gottesbild möglicherweise anders ist als das der anderen. Dass sie alle an den einen Gott glauben, wie immer dann dieser Glaube konkret gefüllt und weiter begründet ist, spielt erst an zweiter Stelle eine Rolle. Und allen wird Verstand und Vernunft genug zugetraut, sich auf ein Gespräch auf gleicher Ebene einzulassen und nicht aus einem bloßem Fanatismus heraus oder auf dem Niveau eines Meinungsaustausches zu argumentieren, sondern nach den gebotenen Regeln der Wissenschaftlichkeit.
So überrascht es nicht, dass am Ende keine der Religionen als »Sieger« aus diesem Gespräch hervorgeht. Der suchende Heide hat für sich zwar eine Antwort ...