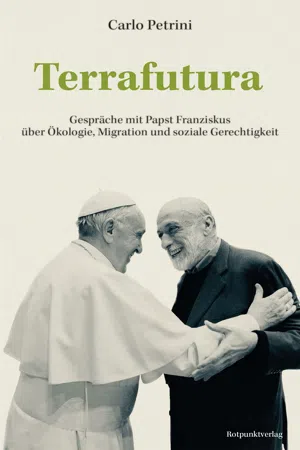![]()
Zweiter Teil
Fünf Themen
![]()
Biodiversität
Carlo Petrini
Meine persönliche Geschichte als politisch engagierter Aktivist reicht in die Linke der späten sechziger Jahre zurück. Es waren Jahre, in denen die Ideologie dominierte und die Welt eindeutig (und in wohl Sicherheit vermittelnder Manier) in Kommunisten und Kapitalisten, Unterdrücker und Unterdrückte, Reiche und Arme, Industrie- und Entwicklungsländer unterteilt war. Es waren turbulente Jahre, in denen jeder angehalten war, Stellung zu beziehen, sich einer Seite zuzuordnen, auf der man stehen und mit der man sich eindeutig identifizieren konnte, manchmal ohne sich dessen selbst vollständig bewusst zu sein. In diesem Spiel gegensätzlicher Lager wurde auch der Spiritualität eine bestimmte Rolle zugewiesen, und die Alternative zum praktizierten Christentum war ein absolut strikter Atheismus. Dazwischen gab es nur wenige Grauzonen, die kaum Beachtung fanden.
Wir jungen Linken von damals hatten klar vor Augen, wer wir waren – oder besser, wer wir laut unseren damaligen politischen Anführern zu sein hätten – und wer unsere Gegner waren. Verschanzt im jeweils eigenen Lager, warteten wir von Mal zu Mal auf die nächste Schlacht. Doch, wie so oft, widerspiegelt diese kurze Skizze mitnichten die Vielschichtigkeit einer historischen Epoche und wird in keiner Weise all den unterschiedlichen Menschen gerecht, die sie durchlebt und mitgestaltet haben. So erinnere ich mich zum Beispiel gut daran, dass die Schule, die wir angehenden Revolutionäre in meiner kleinen Heimatstadt Bra, im Herzen der Provinz Cuneo, durchlaufen haben, keine geringere war als die wohltätige katholische Vinzenz-Gemeinschaft Società San Vincenzo de’ Paoli. Als freiwillige Helfer haben wir dort Engagement und Organisation gelernt, haben Kreativität an den Tag gelegt und unsere Weltsicht entwickelt. In jenen Jahren nahmen wir sowohl an der Vinzenz-Gemeinschaft als auch am laizistischen Freizeitverband ARCI teil, frequentierten sowohl den linksradikalen Partito di Unità Proletaria als auch jene Bars in unserer Stadt, in der eindeutig die Christdemokraten das Sagen hatten.
Das alles schicke ich voraus, da ich heute, ein wenig über mich selbst schmunzelnd, nicht anders kann, als meine Entwicklung gänzlich als das Ergebnis dieser Vermengung, dieser scheinbar unvereinbaren, aber nebeneinander existierenden Denkrichtungen, dieser Zeit der Diskussionen, Auseinandersetzungen und des gewagten Miteinanders zu begreifen. Unsere Identität bildete sich durch die gegenseitige Durchdringung dieser vielfältigen Ansätze heraus. Es gab eine kulturelle und intellektuelle Vielfalt, die jeden von uns dazu nötigte, sich in den anderen hineinzuversetzen, ganz gleich, wie nah oder fern er uns stand, eine Vielfalt, die uns dazu anhielt, nach den Gründen des Gegners zu suchen, so mühsam das auch sein mochte. Jedenfalls lässt sich feststellen, dass die heutige Zeit gar nicht so viel anders ist und man – abgesehen von den gesellschaftlichen, technologischen, wirtschaftlichen und politischen Veränderungen der letzten fünfzig Jahre – durchaus an den Begriff der kulturellen Vielfalt anknüpfen kann, um die Gegenwart und vielleicht gar Zukunftsszenarien fassbar zu machen. So, wie wir damals als heranwachsende Individuen Nutzen und Anregung daraus zogen, auf teils gegensätzliche menschliche und kulturelle Erfahrungen zurückgreifen zu können, so müssen die Menschen heute wieder die Unterschiede anerkennen, deren Wert schätzen und als Grundlage zur Schaffung eines pluralen Humanismus nutzen. Die Welt hat sich tatsächlich radikal verändert, und die »kleine« kulturelle Vielfalt, die man in einem norditalienischen Städtchen zu Zeiten des Wirtschaftsbooms erleben konnte, ist durch den beispiellosen Zugang zu einer menschlichen und kulturellen Vielfalt ersetzt worden, mit all ihren unterschiedlichen Lebensweisen und Lebenseinstellungen und ganz anderen Konzeptionen von gesellschaftlichem Miteinander und Spiritualität als den unseren. Doch ist dieser unermessliche Schatz permanent bedroht und läuft Gefahr, vor unseren Augen zu verschwinden, der ungehemmten Globalisierung zum Opfer zu fallen. Obwohl die Welt durch die Zugänglichkeit einerseits tatsächlich »enger zusammengerückt« ist, hat dies doch andererseits zu Ethnozentrismus und Herrschaftsanspruch geführt, gepaart mit einer wirtschaftlichen Profitgier, mit der die Erde und ihre Bewohner ausschließlich als ein einziger großer auszubeutender Markt betrachtet werden.
Mit dem Begriff der Biodiversität oder Artenvielfalt bezieht man sich auf die Gesamtheit des auf unserem Planeten vorhandenen Erbgutes, oder anders gesagt, auf die enorme Vielfalt der auf der Erde beheimateten Organismen. Leider kommt aber dieser Begriff häufig in negativem Sinn in die Schlagzeilen, im Zusammenhang mit einem die Umwelt und eben diese Vielfalt zerstörenden menschlichen Entwicklungs- und Produktionssystem. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, sind von 1900 bis heute über 70 Prozent der landwirtschaftlichen Artenvielfalt verloren gegangen, also mehr als zwei Drittel der einstmals vom Menschen für die Ernährung genutzten Tier- und Pflanzenarten. In derselben alarmierenden Geschwindigkeit schreitet der Artenschwund bei den nicht landwirtschaftlich genutzten Tieren und Pflanzen voran, sodass die genetische Verarmung in einer zukünftigen Welt zum Kennzeichen unseres Daseins wird. Es ist kein Zufall, dass man in unserer Epoche erneut von »Massenaussterben« spricht, ein Begriff, mit dem üblicherweise vergangene geologische Zeitalter gemeint sind (zum letzten Massenaussterben kam es, wohlgemerkt, vor 65 Millionen Jahren, und zwar bei den Dinosauriern). Doch jetzt ist zum allerersten Mal allein menschliches Handeln für die Tragödie verantwortlich. Die wahllose Ausbeutung der natürlichen Ressourcen wirkt sich tatsächlich auf zwei entscheidende Bereiche aus: Einerseits werden Ökosysteme zerstört, und Lebensräume, die bisher außerhalb menschlicher Reichweite lagen, werden vom Menschen vereinnahmt und eignen sich nicht mehr für das Überleben einiger dort beheimateter Arten (dadurch wiederum werden gefährliche Artensprünge begünstigt, wie wir sie auf dramatische Weise mit dem Coronavirus erlebt haben, dessen Ursprung in der unversehens herbeigeführten Nähe zwischen Wild- und Haustieren zu suchen ist). Andererseits sind das industrielle und das postindustrielle Produktionsmodell verantwortlich für die Emission gewaltiger Mengen an Treibhausgas, die das Klima verändern (und zur Erderwärmung führen), wodurch der natürliche Lebensraum zahlreicher Arten unwiederbringlich zerstört wird und diese am Ende aussterben.
Das Wort Biodiversität hat also in den letzten drei Jahrzehnten einen zentralen Stellenwert erhalten, wenn es darum geht, zu einer anderen Konzeption des Verhältnisses zwischen der Spezies Mensch und der ihr Lebensraum bietenden Umwelt zu gelangen. Der Verlust an Biodiversität ist keine gangbare Option für unsere Erde, und wenn wir das Steuer nicht herumreißen, wird es zu nichts weniger als einer Katastrophe nie da gewesenen Ausmaßes kommen, deren letztes Opfer tatsächlich der Homo sapiens sein wird. So lautet das Mantra aller Umweltverbände und -bewegungen, denn ihnen ist bewusst, dass die Biodiversität für die Sicherung des menschlichen Überlebens das wichtigste natürliche Gut überhaupt ist. Darüber besteht kein Zweifel und die gesamte Wissenschaft stimmt darin überein – die Herausforderung des Jahrhunderts ist es, die Zukunft unserer Spezies zu sichern.
Aus dem Begriff der biologischen Vielfalt ergibt sich schließlich der Begriff der kulturellen Vielfalt, der uns zwingt, das Augenmerk von den strikt naturwissenschaftlichen auf die sozialen Belange zu lenken und die außergewöhnliche Vielfalt menschlicher Lebensformen auf diesem Planeten in den Blick zu nehmen, von den gesprochenen Sprachen bis zum Ausdruck von Spiritualität, von den Formen der Kunst bis zur Rechtsprechung, von den Bestattungsritualen bis zur Organisation des Warenaustausches. Diese neue begriffliche Kategorie ist insofern wichtig, als sie uns zu analysieren hilft, was zu verlieren und zu opfern wir im Begriff sind. Das westliche Fortschrittsmodell des Turbokapitalismus beschränkt sich nicht nur auf die wahllose Ausbeutung der natürlichen Ressourcen. Mit ihm hat sich vielmehr ein einseitiges Zivilisations- und Gesellschaftsmodell durchgesetzt, das nach und nach alles, was sich ihm nicht vollständig angepasst hat, verdrängt und ausgegrenzt hat. So mussten all jene Volksgruppen und Völker, die eine andere Vorstellung von Gemeinschaft und Gesellschaft haben – in erster Linie die Indigenen – mitansehen, wie ihnen allmählich, und oft gewaltsam, die eigenen Lebens- und Kulturräume streitig gemacht wurden. Sprachen sind verloren gegangen, die seit Jahrtausenden gesprochen wurden, ebenso wie Bräuche, Umgangsformen oder auf Gegenseitigkeit und Schenkung basierende Tauschmodelle, ein ausgeglichener, nachhaltiger Umgang mit der Natur. Man ist zu jener von Papst Franziskus oft zitierten Wegwerfkultur gelangt, die er als eine der gefährlichsten Entwicklungen unserer Zeit anprangert. Die soziale Ungleichheit nimmt weltweit permanent zu, und das Gefälle zwischen den wenigen privilegierten Reichen, die materiellen Wohlstand, Bewegungsfreiheit, Zugang zu Kultur, Gesundheitsversorgung und Bildung genießen, und der großen Masse der Entrechteten und Armen, die nicht nur für die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, sondern auch für die Umweltzerstörung den höchsten Preis zahlen müssen, schreit zum Himmel.
Auf dieser Ausgangslage basiert das in der Enzyklika Laudato si’ eingehend thematisierte Konzept der »ganzheitlichen Ökologie«, das sich mit der Formel »kein Umweltschutz ohne soziales Engagement« zusammenfassen lässt. Es ist im Kern unmöglich, die gewaltigen Probleme des Umweltschutzes nachhaltig anzugehen, solange wir sie nicht eng an die Frage der sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheit knüpfen. Dazu bedarf es jedoch einer Wende zurück zu kultureller Vielfalt. Freilich ist diese nicht nur in ihrem Wortsinn, sondern vielmehr als zentrales politisches Element, als Entwurf einer neuen Menschlichkeit, als neues Paradigma zu begreifen, welches es anzustreben und zu verinnerlichen gilt.
So gesehen kann die Situation am Amazonas exemplarisch zur Vertiefung dieser Diskussion beitragen. In den neun Ländern, die die Panamazonasregion bilden, leben etwa drei Millionen Indigene, die 390 verschiedenen Ethnien angehören. Hinzu kommen, laut Schätzungen, zwischen 110 und 130 sogenannte indigene Völker in freiwilliger Isolation, das heißt Völker, die beschlossen haben, nicht in Kontakt mit der Außenwelt zu treten, also mit dem, was man ethnozentristisch als »Zivilisation« bezeichnen könnte. In dem Vorbereitungsdokument für die Pan-Amazonien-Synode heißt es entsprechend: »Jedes einzelne dieser Völker verfügt über eine kulturelle Identität, einen eigenen geschichtlichen Reichtum, eine eigene Weise, die Welt zu sehen und sich mit ihr in Beziehung zu setzen, je ausgehend von ihrer Kosmosvision und ihren territorialen Eigenheiten.« Diese Tatsache wird nicht nur von der katholischen Kirche anerkannt. Sie ist tatsächlich von allen wichtigen öffentlichen und privaten Akteuren auf nationaler wie internationaler Ebene schriftlich fixiert worden, angefangen bei den Verfassungsurkunden einiger Amazonasstaaten wie Ecuador und Bolivien. Die indigenen Völker genießen besondere Rechte zum Schutz und zur Wahrung ihres Lebensraums. In einigen Fällen ist sogar eine der Grundlagen ihrer Weltanschauung – das Prinzip des Sumak Kawsay, das üblicherweise mit »das gute Leben« übersetzt wird, wobei es weitaus komplexere Konnotationen birgt – als vollwertiges theoretisches Modell anerkannt worden, das es zur Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Mensch und Natur anzustreben gilt. Doch die Tatsache, Rechte auf dem Papier zu haben, garantiert noch nicht deren Umsetzung und ebenso wenig deren Befolgung im realen Leben. Der Bedarf an neuem, landwirtschaftlich nutzbarem Land, das Vorkommen seltener Bodenschätze und die Gier der großen Bergbaukonzerne, gepaart mit der permanenten Abholzung von Edelhölzern, stellen weiterhin eine ernsthafte Gefahr für das Überleben der Urwaldvölker dar. Es werden unzählige Gewalttaten und Morde an denen verübt, die sich für den Schutz Amazoniens einsetzen, wobei die Täter oft straflos davonkommen und von der Politik auf allen Ebenen gedeckt werden.
Angesichts der schwierigen aktuellen Lage darf man nicht vergessen, dass ihr jahrhundertelange Gewalt und unsagbare Ausbeutung vorangegangen sind, die ihren Anfang mit den ersten Kolonisationswellen im 16. Jahrhundert genommen haben und danach eigentlich nicht mehr zum Stillstand gekommen sind, wobei die Kirche oft genug als Deckmantel diente. Eine Kirche, die die kulturelle Vielfalt heute als Wert anerkennt, die jedoch in der Vergangenheit ein Konzept der Evangelisierung vorantrieb, das auf Ausrottung und Zwangsanpassung an das klassische abendländische Modell basiert. Hier gelangen wir an einen Punkt, an dem sich unsere persönlichen Lebensgeschichten mit dem gesamten Menschheitsgeschick verknüpfen und die kulturelle Vielfalt zu etwas wird, das einen jeden von uns als Mensch, als Kinder einer einzigen Mutter Erde und somit als Teil aller miteinander verschwisterten Geschöpfe betrifft. Die indigene Kosmogonie, die Betrachtung des Planten, der Natur und der Stellung des Menschen in ihr offenbart uns eine der faszinierendsten Sichtweisen auf die Zukunft überhaupt. Dieser Zugang fußt auf Gleichgewicht und zyklischer Wiederkehr, auf Mäßigung und Teilung sowie auf einer Form der Spiritualität, die in den unaufhörlichen Schwingungen des Planeten das Göttliche zu erfassen vermag.
Auch die Kirche in Rom erkennt heute die Besonderheit dieses spirituellen Ansatzes an, und mit der Pan-Amazonien-Synode vom Oktober 2019 hat sie die Wertschätzung und Achtung der Indigenen in den Mittelpunkt der Evangelisierung Südamerikas gerückt. Und an welchem Punkt steht die säkulare Welt? Wir haben bereits von dem nach wie vor alltäglichen Drama gesprochen, bei dem indigene Führungsköpfe von skrupellosen Drogenhändlern und Spekulanten aller Art ermordet werden, nur weil sie ihr natürliches Umfeld und ihre Wälder verteidigen wollen. Für uns, die wir an keine Konfession gebunden sind, kann der Ansatz der Indigenen in dieser von großen Umwelt- und Gesellschaftskrisen geprägten Zeit einen Lichtpunkt darstellen, dem wir folgen sollten, um den selbstzerstörerischen Kurs grundlegend zu ändern. Wenn sich die mit rasender Geschwindigkeit auf den Abgrund zusteuernde Menschheit (hoffentlich noch rechtzeitig vor dem Absturz) gezwungen sieht, umzudrehen und in den eigenen Fußstapfen zurückzukehren, werden die Letzten, die Ausgegrenzten und Ausgeschlossenen, diejenigen sein, die den Weg weisen. Die Indigenen werden an der Spitze dieses Laufs von Wiedergeburt und individueller sowie kollektiver Befreiung stehen. Sie können uns lehren, wie man im Einklang mit Mutter Erde lebt, wie man die Früchte erntet, ohne die Wurzeln zu zerstören, und Nutzen gewinnt, ohne Leiden zu verursachen.
Es gibt noch ein weiteres Element, das sich alle konfessionslosen und nicht religiösen Menschen wieder zu eigen machen sollten, die Spiritualität. Viel zu lange, seit dem Beginn der Aufklärung, haben wir Vertreter des Abendlands uns der Illusion hingegeben, der Mensch könne ohne Spiritualität auskommen, da er von Wissenschaft, technologischem Fortschritt und reiner Vernunft gesteuert werde. Das war ein gewaltiger Irrtum, denn wir haben Spiritualität mit Religion verwechselt und geglaubt, dass alles, was nichts mit der materiellen Welt zu tun hat, Erbe einer fortschrittsfeindlichen Vergangenheit sei. So haben wir uns selbst den Zugang zu einem Element verwehrt, das zentral für die Definition des Menschseins ist, nämlich das Streben nach etwas außerhalb von uns, die Suche nach einem universalen Entwurf, einer Verbindung zwischen allen Menschen sowie zwischen den Mens...