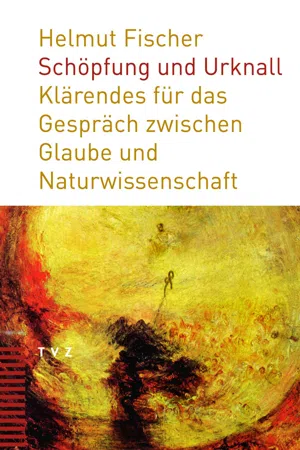![]()
|59| Welt in der Sicht der Naturwissenschaften
Naturverstehen vor der Zeit der Naturwissenschaften
Wir erklären uns Welt in Modellen
Seit es Menschen gibt, die über sich selbst und über ihr Sein in der Welt nachdenken, wird auch die Frage gestellt, wie es kommt, dass nicht nichts ist, sondern ein Gebilde wie unsere Welt existiert. In allen alten Religionen wird die Antwort auf die Frage nach dem Ursprung unserer Welt in der Gestalt von Erzählungen (Schöpfungsmythen) gegeben. So unterschiedlich die Antworten sein mögen: gemeinsam ist ihnen, dass alle Modelle von Weltentstehung der Anschauung jener Lebenswelt entnommen sind, in der die Menschen sich bereits vorfinden. Menschliches Denken kann gar nicht anders, als sich das Unbekannte in Modellen des Bekannten vorzustellen.
Schöpfungsmythen sind Denkmodelle
Wir hatten gesehen: die Hochreligionen der Alten Welt sehen das Universum durch Götter hervorgebracht. In ihren Schöpfungsmythen kommt zum Ausdruck, wie Menschen ihre Welt und sich selbst in ihr verstanden. Diese Erzählungen geben Antwort auf die beiden elementaren menschlichen Fragen nach dem Sinn und dem Grund des Daseins. Im Handeln der Götter wird der Sinn und der Grund von Welt, von Völkern, von Geschichte und von Menschsein offenbar. Was im Mythos als vorzeitiges oder als urzeitliches Geschehen erzählt wird, das hat sinnstiftende und |60| bleibende Bedeutung für jede Gegenwart und wird in diesem Sinn als »wahr« erfahren.
Denkmodelle sind in Gesamtparadigmen eingebettet
Was ist ein Paradígma? Das Wort kommt aus dem Griechischen. Es bedeutet »Beispiel« und »Muster«. Auf eine ganze Kultur bezogen, versteht man unter einem Paradigma ganz allgemein das Grundmuster der leitenden Vorstellungen, nach denen in einer Kultur die Menschen ihre Welt und sich selbst verstehen und dieses Verständnis ausdrücken.
Im Bereich polytheistischer und polydämonischer Religionen sieht man die Welt und das menschliche Leben gewirkt und gelenkt durch das Handeln der Götter oder magischer Kräfte. Die Denkmodelle, in denen sich die Menschen ihre Welt und ihr Leben vergegenwärtigen, entsprechen dem Paradigma und sind insofern für alle Mitglieder dieser Kultur unmittelbar plausibel.
Das Paradigma des Mythos
Die Religionen der Alten Welt artikulieren sich alle im Paradigma des Mythos. Gott und Welt bilden hier eine Einheit, ohne aber miteinander identifiziert zu werden. In den Worten und Taten der Götter kommt das Verständnis von Welt und Mensch zur Sprache. Die Götter werden zwar anthropomorph (menschengestaltig) oder theriomorph (tiergestaltig) vorgestellt; sie werden aber nicht als eigenständige jenseitige Wesenheiten wahrgenommen, die der Welt gegenüberstehen, sondern als die Lebenswirklichkeiten verstanden, mit denen es der Mensch in seiner Welt zu tun hat. |61| Wir sagen aus der Außensicht: Die Götter stehen für bestimmte Lebensbereiche oder repräsentieren sie. Aus der Innensicht stehen sie eher für die Begegnung mit dem Göttlichen, in dem, was sich in der erfahrbaren Wirklichkeit ereignet und dem Menschen darin begegnet und widerfährt.
Israels Monotheismus sprengt das mythologische Paradigma
Israel bekennt sich zu dem einen und einzigen Gott. Die Gestirngötter werden zu Lampen degradiert (Gen 1). Die Götter und Götterbilder der Nachbarvölker werden zu Nichtsen erklärt. »Sieh, sie alle sind nichtig, nichts sind ihre Werke, Wind und Nichts ihre gegossenen Bilder« (Jes 41,29 – Zeit des babylonischen Exils). Indem der eine Gott als der Schöpfer verstanden wird, der seiner Schöpfung gegenübersteht, ist zwar der polytheistische Hintergrund überwunden, aber die mythologische Denkweise als Anschauungsform beibehalten.
Das Paradigma der griechischen Naturphilosophie
Der Wechsel zu einem nichtmythischen Paradigma wird in Griechenland vollzogen, und zwar in Gestalt einer ganzen Reihe unterschiedlicher, ja gegensätzlicher Entwürfe, die aber eines gemeinsam haben: Gott wird nicht mehr anthropomorph, gegenständlich und personal verstanden, sondern abstrakt als ein transzendentes Seiendes. Der Götterglaube wird zunächst offen als menschliche Projektion kritisiert und später gar nicht mehr diskutiert. Xenophanes (580–485 v. Chr.), der früheste Religionskritiker, schreibt: »Die Äthiopier stellen sich die Götter schwarz und stumpfnasig |62| vor, die Thraker dagegen blauäugig und rothaarig, … wenn Kühe und Pferde oder Löwen Hände hätten …, dann würden Pferde pferde-, die Kühe kuhähnliche Götterbilder malen …« Xenophanes postuliert einen einzigen Gott, der freilich nichts Menschliches an sich hat, sondern sich als perfekte Kugelform darstellt, ein Gott zudem, der unveränderlich, unvergänglich, jeglichem Leid entrückt ist und das größte, mächtigste und weiseste Seiende darstellt, das gedacht werden kann. Dieser von allen polytheistischen Vorstellungen gereinigte Monotheismus sollte zum Leitbild des abendländischen Gottesverständnisses werden. Es wurde erst nach mehr als zwei Jahrtausenden erkannt, dass wir es auch hier mit einer menschlichen Projektion zu tun haben.
Parmenides (539–480 v. Chr.), Schüler des Xenophanes, geht noch einen entscheidenden Schritt über seinen Lehrer hinaus. Er streift nicht nur die anthropomorphen Anschauungsformen aus dem Umgang mit den griechischen Göttern ab; er schließt sogar alle Elemente der Erfahrung aus und lässt allein das Denken als den Weg zur Wahrheit gelten. Selbst die Bezeichnung »Gott« wird vermieden. Was Xenophanes noch »Gott« nennt, das bezeichnet Parmenides als das »Sein«. Er entfernt alles Individuelle aus dem Seinsverständnis und setzt die Wahrheit des Seins mit der äußersten Abstraktion des Denkens gleich. Wie die reinen Begriffe, so stellt sich ihm auch das Sein als unveränderlich, als überzeitlich, als ungeworden und als ewig dar. Auf diese Weise ergeben sich zwei Welten: die Welt der Sinneserkenntnis und der Erfahrung, in der wir unseren Alltag leben, und die Welt der Verstandeserkenntnis; das ist die Welt des Seins und der ewigen Wahrheit. Diese Zweiteilung der Welt sollte die Gestalt der Philosophie, |63| der Theologie und der Kultur des Abendlandes ebenfalls tiefgreifend prägen.
Das Paradigma des philosophischen Naturdenkens
Seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. treten in Griechenland eigenständige Denker der Religion ihrer Zeit und deren religiöser Weltdeutung kritisch und mit eigenen Konzepten des Weltverständnisses gegenüber. Sie sehen mit kritischer Distanz, dass die Götterkulte die erfahrbare Welt von göttlichen Ereignissen in einer mythischen Urzeit her deuten, also göttliches Handeln und weltliches Geschehen miteinander verbinden: Der Ursprung unserer Welt wird auf einen Götterkampf oder auf einen göttlichen Schöpfungsakt zurückgeführt.
Thales von Milet (etwa 625–545 v. Chr.), der von Aristoteles als »Vater der Philosophie« bezeichnet wird, fragt ebenfalls nach dem Ursprung der Welt. Er antwortet aber nicht mit einem Mythos von der Weltentstehung, sondern sucht den »Urgrund für alles Sein« in der Welt selbst. Das Verständnis Gottes bleibt davon unberührt. Thales sieht im Wasser das Ursprungselement der Welt. Nicht Gott und dessen Handeln, sondern ein irdisches Element ist für ihn letzte Ursache und Erklärungsgrund für alles, was ist. In allem lässt sich zwar auch Gott finden, und Gott gibt der Welt und dem Leben seinen Sinn, aber kausal betrachtet, ist für Thales der Urgrund der Welt ohne Gott begründbar.
Anaximenes (585–528 v. Chr.) sieht die Welt aus Luft entstanden. Heraklit (535–475 v. Chr.) findet die Welt im Urfeuer und in einem immanenten Gesetz des Werdens begründet. Dieses »Weltgesetz« (logos) kann er mit Gott oder |64| mit dem Göttlichen gleichsetzen, ohne freilich damit eine transzendente oder persönliche Größe zu verbinden. Empedokles (etwa 492–432 v. Chr.) nimmt vier Ursubstanzen an. Für ihn ist alles Sein durch Mischung und Trennung aus Feuer, Wasser, Luft und Erde entstanden.
Anaximander (etwa 610–545 v. Chr.), Nachfolger des Thales, erkennt das Ursprünglichste in der Materie selbst. Ihr spricht er unbegrenzte und unendliche Möglichkeiten (apeiron) und die Kraft zu, Unbelebtes und Belebtes aus sich selbst hervorzubringen. Damit ist erstmals der Gedanke des Werdens und der Evolution ins Gespräch gebracht, und zwar als ein Prozess, der aus sich selbst hervorgeht. Gott ist damit nicht aus dem Spiel, denn der Urstoff wird als das Göttliche identifiziert. Das Göttliche lässt sich aber nicht als statische Größe festmachen, sondern es zeigt sich im Werden als gegenwärtig.
Neu an diesem Denkansatz der philosophischen Naturerklärung ist zweierlei: Zum einen ist es der Versuch, die natürliche Welt aus sich selbst zu erklären, ohne dabei auf Gottheiten oder übernatürliche Kräfte zurückzugreifen. Zum anderen ist hier die Welterklärung im Unterschied zum religiösen Schöpfungsmythos keine unbefragbare Wahrheit mehr, sondern ein Entwurf, der zur Diskussion steht. Beides richtet sich nicht gegen Religion und Gottesglauben. Es ist aber ein anderer Ansatz, den Ursprung und das Wesen der Welt zu verstehen. Innerhalb dieses Paradigmas sollte im Laufe der abendländischen Geistesgeschichte bis hin zu Hegel noch eine Vielzahl von Modellen zum Verständnis der Welt entworfen werden.
Bereits die alten Kulturen in Mesopotamien und in Ägypten haben Natur und Himmel beobachtet. Sie waren auch schon in der Lage, Himmelsereignisse vorauszusagen, |65| ihren Ackerbau den Überschwemmungen anzupassen, erstaunliche Bauwerke zu errichten, Bier zu brauen, Tote zu konservieren, Hebelgesetze anzuwenden. Ihre Beobachtungen zielten aber nicht darauf, die Ursprünge und das Wesen der Welt zu verstehen. Sie suchten nach Techniken, um ihr Leben besser, sicherer und bequemer zu gestalten. Die genannten griechischen Philosophen hingegen befassten sich mit der Natur, um Ursprung, Wesen und Bau der Welt zu ergründen. Sie experimentierten auch nicht mit der Natur, sondern sie dachten über die Natur nach. Dabei dominierte die philosophische Spekulation.
Schritte zu einer Naturwissenschaft
Die ersten Schritte auf dem Weg zum Paradigma einer Naturwissenschaft werden ebenfalls bereits im vorchristlichen Griechenland unternommen. Von Thales an beschäftigen sich die griechischen Philosophen mit Fragen nach Ursprung und Anfang (arché) des Kosmos oder des Universums, wie wir seit dem 18. Jahrhundert das Weltall als den astronomischen Gesamtkosmos nennen. Philosophie, Theologie, Kosmologie und Naturbetrachtung bilden für viele Jahrhunderte eine Einheit. Es ist daher nicht auf Jahr und Person festzulegen, wann und wo sich eine konsequent naturbezogene Denkweise zu verselbstständigen beginnt.
Der Philosoph Demokrit (etwa 460–370 v. Chr.) mag hier nur als Beispiel für eine neue Denkweise stehen. Sein Grundsatz ist die These, dass sich die physische Wirklichkeit aus Atomen zusammensetzt. Die Atome (von átomos/ unteilbar) sind letzte und kleinste Bausteine der Materie. Sie nehmen Raum ein, sind undurchdringlich, sie haben Gewicht, sie sind ewig und unzerstörbar. Ihre Zahl ist unendlich. |66| Alle Atome sind substanziell von gleicher Art, aber verschieden in Größe, Form und Anordnung. Da alle Atome von gleicher Art sind, sind auch alle Gegenstände des Kosmos qualitativ von gleicher Art. Die Dinge sind nur verschieden, weil sie aus verschieden vielen, aus verschieden großen, aus verschieden geformten und aus verschieden angeordneten Atomen bestehen. Die Qualität der Dinge beruht auf den Unterschieden quantitativer Art. Die Welt ist demnach nicht durch Eingriffe von Göttern zu erklären. Sie ist streng kausal festgelegt durch die Zahl der Atome und durch die Mechanik, nach der diese sich miteinander verbinden oder voneinander trennen. Die Welt ist somit rational durchschaubar, sobald man sie quantitativ und damit gemäß der Mechanik erfasst, der sie folgt. Diese quantitativ-mechanistische Naturbetrachtung sollte in der Kulturgeschichte des Abendlandes bis ins 20. Jahrhundert viele Anhänger finden.
Pythagoras (570–496 v. Chr.), Arzt, Priester und Philosoph aus Samos erklärt: »Alles ist Zahl«. Er sagt damit: Das Prinzip des Seienden ist nicht der Stoff, sondern die Form. Das Formgebende aber ist die Zahl. Das ist z.B. daran abzulesen, dass bestimmte Saitenlängen zu bestimmten Tönen führen, die sich in Zahlenverhältnissen ausdrücken lassen. So verhalten sich die Saitenlängen von Grundton und Oktave wie 2 : 1. Die Quart verhält sich zum Grundton wie 4 : 3, die Quint wie 3 : 2. Der Leitgedanke einer in Zahlen darstellbaren Sphärenharmonie bleibt länger als zwei Jahrtausende lebendig. Zweieinhalb Jahrtausende nach Pythagoras sieht auch der Physiker Werner Heisenberg (1901–1976) die sinnvolle Ordnung der uns umgebenden Natur in dem mathematischen Kern der Naturgesetze begründet.
|67| Solange Sonne und Mond als Götter galten, konnte der Gedanke gar nicht aufkommen, sie als Himmelskörper zu sehen und sie als natürliche Gegenstände zu erforschen. Das änderte sich mit dem Auftreten des ionischen Philosophen Anaxagoras (etwa 500–428 v. Chr.) in Athen. Er bestreitet, dass Sonne und Mond Götter sind, und er versteht die Sonne als glühenden, den Mond als kalten Steinhaufen. Das trägt ihm in der Stadt, die allenthalben mit Götterstatuen geschmückt ist, einen Prozess wegen Gottlosigkeit ein.
Die Gedanken des Anaxagoras und des Pythagoras werden von deren geisti...