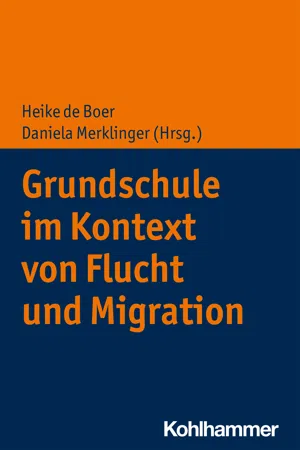![]()
1
Migration, Wohlbefinden und Schule
Heike de Boer
Die Fremdheit des Fremden wird durch die Wiederherstellung von Vertrautheit überwunden oder zumindest gemildert.
Thomas Bauer, Die Kultur der Ambiguität: 347. © Verlag der Weltreligionen im Insel Verlag Berlin 2011.
Kinder mit Zuwanderungsgeschichte leben in einer besonderen Situation, in der es einen Ausschluss von Freizeitangeboten und Kontakten mit Gleichaltrigen aufgrund ökonomischer, sprachlicher und behördlicher Hindernisse gibt, der besonders schwer wiegt. Zusätzlich kommt für viele Familien mit Fluchtgeschichte die Belastung durch die Erfahrungen der zurückliegenden Flucht hinzu (
Kap. 2), genauso wie die Erfahrungen des Lebens in Erstaufnahmeunterk
ünften (Lewek/Naber 2017). Einige Familien berichten, dass sie innerhalb Deutschlands mehrmals die Unterkunft wechseln mussten, bis ihnen ein fester neuer Wohnort zugewiesen wurde. Für Kinder bedeutet dies, dass sie über einen langen Zeitraum in einer unsicheren Umgebung mit wenig Stabilität leben, in der nicht nur die Sprache, sondern auch Orte, Räume, Rituale, Menschen u. v. m. unbekannt und auch beängstigend sind (
Kap. 7). In dieser Phase des Ankommens und der Asylbeantragung, in der in vielen Bundesländern noch kein geregelter Schulbesuch vorgesehen ist, fehlt ein Rahmen, der Struktur und Sicherheit gibt, genauso wie der Kontakt zu Kindern, die (schon länger) in Deutschland leben. Diese Situation birgt für die psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen erhebliche Risiken, die den Alltag schutzsuchender Familien mit Kindern und Jugendlichen längerfristig prägen und erheblich belasten (ebd.;
Kap. 6).
Vor diesem Hintergrund wird in diesem Beitrag reflektiert, welche Faktoren die schulische Inklusion neu zugewanderter Kinder befördern. Dazu werden aktuelle Studienergebnisse im Kontext der Well-Being-Kindheitsforschung einbezogen. Darauf aufbauend wird gefragt, welche blinden Flecken in der Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie in der Professionalisierung von Lehrkräften im Umgang mit Flucht und Migration bestehen. An einem Projektbeispiel werden Bildungsprozesse Studierender vorgestellt, die sie in einem Mentoring-Projekt mit Kindern mit Fluchtgeschichte als Mentor*innen machen, indem sie ihre eigenen Wahrnehmungs- und Handlungsmuster bearbeiten. Abschließend werden zentrale Faktoren resümiert, die zur Entstehung von Wohlbefinden und zur Inklusion beitragen.
1.1 Inklusion durch social bonds und social bridges
Im 2016 erschienenen europäischen Forschungsbericht zur Migration (King/Lulle 2016) wird eindrücklich darauf hingewiesen, dass Inklusion im Kontext von Migration ein komplexer Prozess ist, der wirtschaftliche, soziale, kulturelle und bildungsorientierte Faktoren umfasst, die nicht losgelöst voneinander wirken, sondern sich wechselseitig bedingen (vgl. King/Lulle 2016: 53). Dort wird vor allem die soziale und kulturelle Inklusion als förderlich für Bildungsprozesse eingeschätzt (ebd.). Unterschieden wird hier zwischen social bonds und social bridges (Ager/Strang 2004 in King/Lulle 2016: 59). Social bonds werden definiert als »connections within the ethnic, migrant or refugee community«. »Social bridges are relations developed within the mainstream host society and with other communities« (King/Lulle 2016: 58). Besonders neu entstandene, interethnische Kontakte durch neue Beziehungen oder Netzwerke im Aufnahmeland unterstützen den Inklusionsprozess (ebd.).
In der neueren Kindheitsforschung haben sich in den letzten Jahren Ansätze des Child Well-Being etabliert (Andresen 2018; Betz 2018). Andresen differenziert unterschiedliche Typen des Child Well-Being-Ansatzes aus und hebt Studien mit kindheitstheoretischer Rahmung hervor (Andresen 2018: 77). Diese Studien interessieren sich dafür, welche Dimensionen des Wohlbefindens aus der Perspektive von Kindern relevant sind, und zeigen u. a. eine Schnittmenge zu den oben genannten Faktoren. Interessant sind in diesem Kontext Untersuchungen, die die Perspektive von Kindern im Kontext von Flucht und Migration näher untersucht haben. Im Folgenden wird dieser Ansatz aufgegriffen und vertieft.
1.2 Child Well-Being – kindheitstheoretische Forschungszugänge
Die Untersuchung des Wohlbefindens von Kindern als eigenständigen Akteuren ist besonders aufschlussreich und ermöglicht es, Kinder als Experten ihrer Lebenswelt zu befragen. Fattore, Mason und Watson (2017) haben eine Untersuchung in Australien durchgeführt und 126 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren zu ihrer Perspektive auf Wohlbefinden befragt. Auf der Datenbasis von Gruppengesprächen, dialogischen Interviews und sachbezogenen Projekten konnten sie ein mehrdimensionales Konzept entwickeln, das von vier Dimensionen gerahmt wird:
wirtschaftliches Wohlbefinden
Im Zentrum dieser Rahmung stehen die drei zentralen Faktoren (vgl. ebd.: 46):
Diese einzelnen Faktoren hängen zusammen und beeinflussen sich wechselseitig. Denn die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, steigert das emotionale Wohlbefinden genauso wie Aktivitäten, die wichtige Könnenserfahrungen ermöglichen.
Kämpfe (2019) hat jüngst eine Untersuchung vorgelegt, in der sie Gruppendiskussionen mit Kindern mit Migrationshintergrund durchgeführt hat. Ihre Analysen schließen unmittelbar an die Ergebnisse von Fattore et al. (2017) an und differenzieren Faktoren des Wohlbefindens weiter aus. Kämpfe arbeitet heraus, dass Dimensionen der Zugehörigkeit bedeutend sind; denn Aufwachsen im Migrationskontext bedeutet auch, dass es Mehrfachzugehörigkeiten und hybride Identitäten gibt (ebd.: 281). Kinder erleben, dass ihre Familien räumlich getrennt sind und sich transnationale Zugehörigkeiten bilden, die ein hohes Verbundenheitsgefühl hervorrufen. Durch Besuche, Telefonate und Onlinekontakte wird der Zusammenhalt weiter gepflegt (ebd.: 282). Interessant ist, dass einige Kinder »das gute Leben«, so Kämpfe, in Relation zum vergleichsweise schwierigen Leben in ihren Herkunftsländern konzeptualisieren und dementsprechend ihre eigene Situation im Aufnahmeland positiv einschätzen. Sie berichten ferner, dass interethnische Freundschaften und gemeinsame sportliche Aktivitäten (ebd.) für sie bedeutsam sind.
Kämpfe arbeitet zwei grundlegende Typen von Selbstpositionierungen der Kinder heraus. Die Kinder des einen Typs erfahren sich in unterschiedlicher Ausprägung als aktiv Handelnde mit einem hohen Maß an Eigenverantwortlichkeit und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Kämpfe spricht von »Selbstpositionierung als planvolle Akteur*innen« (ebd.: 274). Anerkennung in der Peergroup und freundschaftsbezogene Orientierungen spielen dabei eine wichtige Rolle, genauso wie intraethnische und interethnische Kontakte. Dahingegen erfahren sich die Kinder des zweiten Milieutyps in ihrer »Selbstpositionierung als irritierte und unsichere Akteure« (ebd.). Kämpfes Analysen machen sichtbar, dass das Wohlbefinden in der Kindergruppe sowohl im Aufnahme- als auch im Herkunftsland eine wichtige Rolle spielt und durch Rassismuserfahrung oder Diskriminierung eingeschränkt werden kann (ebd.: 287). Kämpfe zeigt weiter, dass Wohlbefinden immer auch Wohlbefinden in der Familie bedeutet und dass der transnationale Raum dabei eine besondere Bedeutung erfährt. Wohlbefinden ist nach Kämpfe »vor dem Hintergrund unterschiedlicher Zugehörigkeitsdimensionen in ihrer Verwobenheit und Ambivalenz« zu verstehen und auch »vor dem Hintergrund von migrationsbezogener Differenz und Machtasymmetrien im Migrationskontext« zu betrachten. Nicht zuletzt ist Wohlbefinden an den Aspekt Sprache gekoppelt (ebd.).
Diese sehr ausdifferenzierte und aktuelle Analyse der Perspektiven auf das Wohlbefinden von Kindern in der mittleren Kindheit zeigt nicht nur, dass sich die untersuchten Kindergruppen in ihren Erfahrungen und Perspektiven unterscheiden, sondern auch, dass sich Wohlbefinden im Kontext von Peerbezügen, Familie1 und Sprache im Kontext der Situation im Aufnahme- und im Herkunftsland herausbildet.
Dementsprechend ist davon auszugehen, dass ein Integrationsprozess besser gelingt, wenn diesen unterschiedlichen Dimensionen Rechnung getragen wird.
1.3 Migration und Schule
Vor dem Hintergrund der dargestellten aktuellen Forschungsergebnisse ist erstaunlich, dass Schule und Unterricht bezogen auf Flucht und Migration noch weitgehend an den Normalitätserwartungen der gesellschaftlichen Mehrheit orientiert sind (Gomolla 2016: 14; Karakaşoğlu/Mecheril 2019) und Integrationsmaßnahmen meistens als singuläre oder additive Einzelmaßnahmen mit dem Schwerpunkt Sprachförderung angesetzt werden. Nur wenige Konzepte denken die sprachliche, sozio-kulturelle und religiöse Heterogenität zusammen und legen ein Umdenken für Schule in der Einwanderungsgesellschaft Grund (vgl. z. B. das Hamburger MIKS Projekt).2
Gomolla konstatiert zutreffend:
»Wenn die Strukturen und Schulorganisationen nicht konsequent auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit einer Bandbreite an sprachlichen oder familial bedingten Bildungsvoraussetzungen und Bedürfnissen ausgerichtet sind, wird der Umgang mit migrationsbedingter sprachlich-kultureller Heterogenität nicht nur von Berufsanfängern und Berufsanfängerinnen, sondern auch von praxiserfahrenen Lehrpersonen tendenziell als Verunsicherung erlebt« (2016: 14).
Gefordert wird, dass es auch an Universitäten einer Lehrerbildung in der Einwanderungsgesellschaft bedarf (Karakaşoğlu/Mecheril 2019; Stifterverband 2020)3, in der nicht nur Konzepte für mehrsprachiges, bildungs- und fachsprachliches Handeln entwickelt werden, sondern eine systemisch-konzeptionelle Perspektive eingenommen wird, die soziokulturelle, religiöse und sprachliche Bedingungsfaktoren zusammendenkt. Genauso wichtig sind in diesem Kontext die Aufarbeitung von defizitorientierten und kulturalisierenden Sichtweisen von Studierenden und Lehrer*innen und die Entwicklung einer diversitätsbewussten und antidiskriminierenden Haltung. Auch wenn der Begriff Haltung ein eher schillernder und wissenschaftlich unpräziser Begriff ist, hat er in diesem Kont...