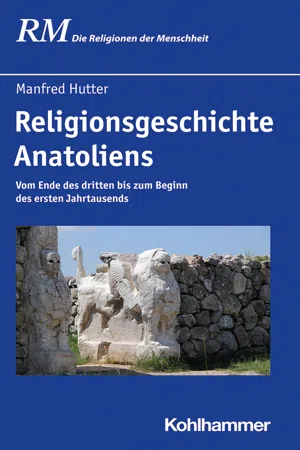
eBook - ePub
Available until 5 Dec |Learn more
Religionsgeschichte Anatoliens
Vom Ende des dritten bis zum Beginn des ersten Jahrtausends
- 356 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Available until 5 Dec |Learn more
Religionsgeschichte Anatoliens
Vom Ende des dritten bis zum Beginn des ersten Jahrtausends
About this book
This volume describes the interactions between religions and political and social institutions in Anatolia on the basis of religious ideas and practices, starting with archaeological evidence from the end of the third millennium BCE. The first written information about religious matters appears in ancient Assyrian letters, before a rich written tradition started with the emergence of the ancient Hittite Empire in the 17th century BCE. Following the downfall of the Hittite Empire at the beginning of the 12th century, a few neo-Hittite states used the older religious traditions to support their claim to legitimacy, but combined them with innovations, which are presented in conclusion in the book=s final chapter.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Religionsgeschichte Anatoliens by Manfred Hutter, Peter Antes, Manfred Hutter, Jörg Rüpke, Bettina Schmidt in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Theology & Religion & Comparative Religion. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
F Zum Weiterwirken religiöser Traditionen in der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends
Nach dem Untergang des hethitischen Großreiches im frühen 12. Jahrhundert kam es zu wesentlichen Veränderungen in Anatolien. Von nun an fehlte eine zentrale politische Macht, so dass bis ins 8. Jahrhundert einzelne (Stadt-)Staaten die Verbindung zu den verschiedenen Traditionen des Hethiterreiches aufrechterhielten und beanspruchten, legitime Erben des Großreiches zu sein. Diese so genannten neo-hethitischen Staaten1 bilden – im weitesten Sinn vergleichbar mit der Situation vor der althethitischen Zeit – einzelne Machtzentren in Anatolien. Damit setzte sich der Prozess der Dezentralisierung der Macht fort, der bereits unter den letzten Großkönigen von Ḫattuša begonnen hatte, indem neben der Dynastie des Großkönigs in Ḫattuša zumindest in Karkamiš und in Tarḫuntašša weitgehend selbstständige und fast nur noch nominell mit Ḫattuša verbundene Herrscher residierten. Somit führte der Untergang des Hethiterreiches in Kleinasien nicht zu »dunklen Jahrhunderten« der Geschichte, sondern zu einer Periode der Neustrukturierung politischer Verhältnisse, wovon vor allem vier geographische Areale unterschiedlich betroffen waren. Die schon in den letzten Jahrzehnten des Großreiches einsetzende Verschiebung der Schwerpunkte nach Tarḫuntašša und nach Karkamiš bereitete den Boden dafür vor, dass sich in diesen Gebieten ab dem 12. Jahrhundert verschiedene neo-hethitische (Stadt-)Staaten etablierten: Einerseits im Bereich von Tarḫuntašša und im nördlich davon angrenzenden Areal von Tabal, das ungefähr dem »Unteren Land« der Großreichszeit entspricht, andererseits im Raum der hethitischen Sekundogenitur Karkamiš sowie in den westlich und nördlich davon liegenden Gebieten von Kizzuwatna (östliches Kilikien), Gurgum (Maraş), Kummuḫu (Kommagene) und Melid. Diese verschiedenen (Klein-)Staaten2 setzen religiöse Traditionen der hethitischen Großreichszeit fort, die im Folgenden als Ausdruck der Kontinuität vom 2. zum 1. Jahrtausend – trotz veränderter politischer Situation – darzustellen sind. Unberücksichtigt bleiben im Folgenden jedoch die nordsyrischen Bereiche wie Tell Tayinat, Ain Dara, W/Palastin, Ḫalab oder Hama.3 Denn obwohl hieroglyphen-luwische Inschriften aus diesen Staaten vorliegen, heißt dies nicht, dass die Bevölkerung luwisch ist bzw. die Religionen anatolische bzw. hurritische Traditionen fortsetzen, die schon im hethitischen Großreich verbreitet waren. Denn religionsgeschichtlich sind diese nordsyrischen Gebiete eng mit älteren semitischen Traditionen bzw. mit der zunehmenden Bedeutung der Aramäer ab dem Ende des 2. Jahrtausends zu verbinden, auch wenn es kulturelle Wechselwirkungen zwischen dem syrischen und dem anatolischen Raum auch nach dem Zusammenbruch des Hethiterreiches gegeben hat.
Östlich von diesen so genannten »neo-hethitischen« Staaten etabliert sich ab dem 9. Jahrhundert Urartu als politische Größe, dessen westliche Ausdehnung bis ins Gebiet von Išuwa, Azzi und Ḫayaša der hethitischen Großreichszeit reicht und mit dem neo-hethitischen Staat Melid eine gemeinsame Grenze hat. Mit Urartu taucht eine neue politische und kulturelle Größe4 auf, die jedoch – abgesehen von wenigen Berührungspunkten mit hurritischen religiösen Vorstellungen – kaum Verbindungen zur Religionsgeschichte des vorhin beschriebenen 2. Jahrtausends hat.
Im zentralanatolischen Raum innerhalb des Halysbogens und im westlich davon gelegenen Gebiet kommt es durch die Phryger zu größeren Veränderungen der religiösen Traditionen des 2. Jahrtausends, auch wenn die Phryger vereinzelte lokale Vorstellungen, die seit den Hethitern in diesem Raum bekannt waren, rezipiert haben.5 Wie umfangreich die religiöse Kontinuität6 zwischen den in der hethitischen Großreichszeit in Südwest- und Westanatolien gelegenen Lukka-Ländern bzw. den Gebieten von Arzawa und Mira einerseits und Lykien bzw. Lydien andererseits war, lässt sich schwer sagen, da – anders als auf dem Gebiet der neo-hethitischen Staaten mit den hieroglyphen-luwischen Inschriften – eine sehr große zeitliche Lücke zwischen der ohnehin spärlichen Überlieferung zu den religiösen Verhältnissen in diesem Raum in der Großreichszeit und den lykischen bzw. lydischen Inschriften klafft. Einzelne anatolische Traditionen, die in diesen Inschriften greifbar werden, deuten aber zumindest auf eigenständige religiöse Traditionen in diesen Gebieten, die nicht direkt mit den Überlieferungen des 2. Jahrtausends, wie wir sie aus hethitischen und keilschrift-luwischen Texten kennen, zu verbinden sind.
1 Tabal und das ehemalige »Untere Land«: Luwisches Kerngebiet im Kontakt mit zentralanatolischen und südwestanatolischen Nachbarn
Als luwisches Kerngebiet am Ende des 2. und zu Beginn des 1. Jahrtausends sind jene Gebiete zu betrachten, die im hethitischen Großreich ungefähr das Areal von Tarḫuntašša und das nördlich davon liegende Untere Land umfassten; letzteres wird nach der hethitischen Zeit als Tabal bezeichnet.7 Im Wesentlichen bildet der Halys die Grenze zwischen Tabal und jenen Gebieten in Zentralanatolien, die nach dem Ende des Hethiterreiches Kaškäer und Phryger besiedelten, auch wenn sich anscheinend an einigen Stellen das tabaläische Gebiet nördlich über den Halys hinaus ausdehnte, wie einige dort gefundene hieroglyphen-luwische Inschriften (z. B. KARABURUN, ÇALAPVERDİ 1–2, KIRŞEHİR) zeigen. Im Südosten waren die Ebenen von Adana und Kilikien die Nachbarn, im Südwesten der lykische Raum. Dadurch bestehen Kontakte und materielle sowie kulturelle Austauschprozesse mit Phrygien und Lykien, den luwisch beeinflussten Gebieten in Südostanatolien sowie vereinzelt bis nach Urartu.8 Für das Gebiet von Tabal und des ehemaligen Tarḫuntašša ist davon auszugehen, dass es – aufgrund der hier gefundenen hieroglyphen-luwischen Inschriften – einen relativ hohen Anteil von Luwiern an der Bevölkerung gegeben hat, was in den südöstlich daran anschließenden Staaten nicht so stark der Fall war.
Das Textkorpus aus diesem Raum umfasst eine ältere und eine jüngere Gruppe: Erstere sind die KARADAĞ-KIZILDAĞ-Inschriften, die schon bald nach dem Ende des hethitischen Großreiches zu datieren sind. Insbesondere König Hartapu und sein Vater Muršili, die beide die Titel »Großkönig« bzw. »Held« trugen,9 zeigen – ähnlich wie dies auch bei den Herrschern von Karkamiš und Melid gesehen werden kann – den Anspruch auf das kulturelle und politische Erbe des hethitischen Königtums. Abgesehen von dem Namen des Wettergottes Tarḫunt (z. B. KIZILDAĞ 2; KARADAĞ 1 § 1) geben diese älteren Inschriften jedoch kaum Informationen über die religiösen Verhältnisse. Eine im Juni 2019 neu entdeckte Inschrift (TÜRKMEN-KARAHÖYÜK 1)10 wirft nun weiteres Licht auf dieses westliche Herrschaftsgebiet. Diese Inschrift stammt aufgrund paläographischer Beobachtungen erst aus dem frühen 8. Jahrhundert, nennt jedoch wiederum einen Großkönig Hartapu, Sohn eines Muršili. Einerseits ergibt sich daraus, dass in der lokalen Dynastie die beiden Namen Hartapu und Muršili mehrfach verwendet wurden, d. h. der Großkönig in TÜRKMEN-KARAHÖYÜK ist mindestens der zweite Herrscher dieses Namens; ferner erwähnt die Inschrift, dass Hartapu Phrygien – unter der damals gängigen Bezeichnung Muška in § 1: mu-sà-ka(REGIO) – erobert und 13 andere (Klein-)Könige unterwirft.11 Unter letzteren kann man wohl lokale Fürsten im östlichen Tabal sehen; dass die Inschrift propagandistischen Wert hat, ist kaum zu bezweifeln, so dass man aus der »Eroberung« Phrygiens und der Besiegung der Kleinkönige sicherlich nicht auf eine flächendeckende Herrschaft schließen sollte. Allerdings könnte die rund 150 Kilometer entfernte Inschrift BURUNKAYA, in der ein Großkönig Hartapu ebenfalls von einem militärischen Erfolg berichtet, mit dieser – wohl zeitweiligen – Ostexpansion der Herrschaft der Hartapu-Dynastie zu verbinden sein.
Texte der jüngeren Gruppe aus Tabal12 stammen erst aus der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts, dazu gehören beispielsweise Inschriften, die mit der Dynastie des Warpallawa von Tuwana und mit der Dynastie des Tuwati und seines Sohnes Wasusarma verbunden sind; andere Texte stammen von nicht-königlichen Verfassern. Die Bleistreifen aus KULULU behandeln wirtschaftlich-administrative Inhalte. Der Aufstieg und die Expansionspolitik des neuassyrischen Reiches von der Mitte des 8. bis zum frühen 7. Jahrhundert, die die Unabhängigkeit der östlichen neo-hethitischen Staaten beenden, haben Tabal nicht direkt berührt. Allerdings haben die Kimmerier ab 714 zum Untergang dieser politischen Einheiten und zum Verschwinden der luwischen Schreibtradition beigetragen.13 Die einzelnen lokalen politischen Einheiten sind dabei weitgehend unabhängig voneinander gewesen, weisen jedoch in religiöser Hinsicht Gemeinsamkeiten auf, so dass diese hier gemeinsam beschrieben werden.
1.1 Die Eigenständigkeit der Götterwelt
Die beiden Inschriften14 ÇİFTLİK §§ 8–10 und KULULU 5 § 1, die beide aus dem 8. Jahrhundert stammen, nennen folgende Gottheiten in gleicher Reihenfolge. Auch wenn man darin nicht den Ausdruck eines »Staatspantheons« von Tabal sehen sollte, haben die beiden Inschriften dennoch repräsentativen Charakter für die zentralen Gottheiten: Tarḫunt, Ḫebat, Ea, Kubaba, Šarruma, Alasuwa/Alanzuwa. Beide Götterlisten weisen einige interessante Eigenschaften hinsichtlich der Entwicklung des »luwischen« Pantheons in Tabal auf. Dass der Wettergott Tarḫunt als Erster in beiden Listen – aber auch in anderen Inschriften (AKSARAY §§ 2, 5; BOHÇA § 2; BULGARMADEN § 4) – genannt ist, ist nicht ungewöhnlich, da dies zweifellos eine Kontinuität der älteren luwischen Vorstellungen widerspiegelt. Daneben sind aber auch lokale oder spezifische Hypostasen dieses Wettergottes zu erwähnen: Warpallawa, der König von Tuwana, stiftete um 740 einen Weinberg für Tarḫunt des Weinbergs15 (SULTANHAN § 2; İVRİZ 1 § 1; BOR §§ 3–4). Die Verehrung dieses Wettergottes durch den König ist auch auf den Felsreliefs von İvriz und von Ambardere dargestellt, wobei der Gott Trauben und Getreide hält.16 Eine weitere lokale Ausprägung des Wettergottes ist in KULULU 1 § 5 als Tarḫunt des Gebirges genannt, eine Vorstellung, die bereits in luwischen Texten des 2. Jahrtausends (KUB 7.53+ i 58f.; KUB 9.34 i 11’) aus dem Unteren Land bekannt ist. Tarḫunt ist in diesen Aufzählungen manchmal mit Ḫebat verbunden, so dass Matthieu Demanuelli betont, dass der hurritische Teššub in Tabal durch den luwischen Tarḫunt ersetzt wurde.17 Mit dem hurritischen Milieu Ḫebats sind auch Šarruma und Alasuwa/Alanzuwa18 (als hieroglyphen-luwische Entsprechung der älteren hurritischen Namensform Alanzu) zu verbinden. Die vier Gottheiten – Wettergott, Ḫebat, Šarruma und Alanzu19 – sind in der Götterdarstellung der Großreichszeit in Yazılıkaya als Familie zusammengestellt, so dass hier möglicherweise diese Tradition kontinuierlich in Tabal weitergewirkt hat. Da diese vier Gottheiten aber auch in Kummuḫu um 800 in Götteraufzählungen nebeneinander genannt werden (ANCOZ 1 § 4; ANCOZ 9 § 2), ist es genauso möglich, dass dieser hurritische Einfluss von Kummuḫu nach Tabal gelangt ist. Dies scheint sogar der wahrscheinlichere Prozess, denn Kubaba, die in den Inschriften aus ÇİFTLİK und KULULU 5 ebenfalls in dieser Götteraufzählung aufgenommen wird, f...
Table of contents
- Deckblatt
- Impressum
- A Einleitung und Forschungsstand
- B Frühe religiöse Vorstellungen Anatoliens am Beispiel der Gräber von Alaca Höyük und der Briefe aus den altassyrischen Handelskolonien in Zentralanatolien
- C Religion in der althethitischen Zeit
- D Religiöser Wandel und Neuerungen zwischen der althethitischen Zeit und dem hethitischen Großreich
- E Religion in der Großreichszeit
- F Zum Weiterwirken religiöser Traditionen in der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends
- G Anhang