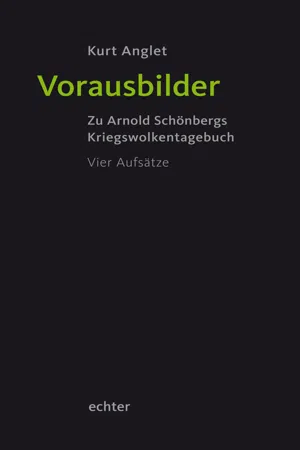![]()
Das Erkalten der Liebe
Stifters kleine Urgeschichte der Moderne
Gemeinhin gilt das Jahr 1857 als Anbeginn der literarischen Moderne, das Erscheinungsjahr von Baudelaires »Fleurs du Mal«, von Flauberts »L’Éducation sentimentale« und von Stifters »Nachsommer«. Ihre Geburt indessen reicht Jahre zurück, mitten hinein in die Romantik, schon dem Titel nach von ihr kaum zu unterscheiden: »Wiesenbocksbart«. So jedenfalls ist die sechste Erzählung aus Adalbert Stifters Zyklus »Feldblumen« überschrieben, ein fiktiver Brief an einen gewissen Titus unter dem Datum vom 12. Mai 1834. Neben den Erzählungen »Der Condor« und »Das Haidedorf« trugen sie im Jahre 1840 zu Stifters literarischem Durchbruch bei, gelten als »ein Stück romantischer Bekenntnisliteratur« (Wolfgang Matz). Stifter soll für die Buchfassung »allzu deutliche Jean-Paul-Anklänge«, den er bewunderte, beseitigt haben, gleichsam eine stilistische Begradigung, denn inhaltlich zielt eine Erzählung wie »Wiesenbocksbart« in eine ganz andere Richtung, die aus der Welt der Romantik weit mehr als in einem literarischen, ja ästhetischen Sinne hinausweist.
Ein neues Selbstbewusstsein
Buchstäblich über Nacht scheint sich die Situation des jungen Schriftstellers grundlegend geändert zu haben; wenigstens registriert er aufmerksam die neue Lebenseinstellung am frühen Morgen: »Die Nacht ist vorübergegangen und hat mancherlei geändert. Vom Himmel hat sie die Perlen der Fruchtbarkeit herabgeschüttet, und ihn gänzlich rein gefegt, daß er mit klaren frühen Morgengelb zu mir hereinsieht – die Schornsteine und nassen Dächer schneiden sich scharf gegen ihn, und die kühle Luft regt die Nachbarzweige, und strömt zu meinem offengebliebenen Fenster herein. – Ich schreibe noch im Bette.«
Keine nächtliche Traumwelt, aber auch kein Sonnenaufgang, der mit seinem Lichte die Natur verklärt oder zum Aufbruch in die Ferne lockt. Über eine nahezu impressionistisch wirkende Dächerwelt hinweg schaut der klare Himmel in die Stube seines keineswegs übernächtigten Betrachters, obschon dieser offensichtlich die Nacht durchschrieben hat. Und doch nicht wie jemand, der, an einem langen Roman schreibend, darüber die Nacht vergisst, indem er sie zum Tage macht. Nein, sein Schreiben markiert eine Zäsur zwischen dem neuen Tag und dem Tag, der mit der Nacht vergangen ist. Sein Selbstbewusstsein ist ein anderes als gestern, ja selbst sein Ich, das fragt: »Was ist es nun mit dem Menschen, wenn er heute dieser ist und morgen jener? Auch mein Herz, wie der Himmel, ist frisch und kühl, und sucht sich auf gestern zu besinnen.« Alles andere als rhetorisch die sich anschließende Frage: »Was ist’s nun weiter?«
Der Rückblick freilich reicht nicht bis zum gestrigen Tag, sondern bis zur Nacht, mit der das Schreiben einsetzt. »Hat die Flasche Rüdesheimer, die ich gestern zu meinen Nachtpoesieen getrunken, die Seele so voll Sehnsucht angeschwellet – und ist sie heute leer, so wie die Flasche, die dort so wesenlos auf dem Tische steht, daß das Morgenlicht hindurch scheinet?« Trotz der Desillusion keinerlei Katerstimmung. Ernüchterung wohl, jedoch keine, die dem Gestern in irgendeiner Weise nachtrauert, ja nicht einmal dem Genuss des Weins am Abend, sondern Neubesinnung mit der wiederholten Frage: »Wie ist’s nun weiter?«
Die Antwort keine großen Erklärungen; kein Diskurs, der Rechenschaft über den veränderten Zustand gibt; keine langatmigen Selbstrechtfertigungen, sondern ein gewandeltes Selbstbewusstsein, das sich in einer bunten Bilderfolge ergießt: »Ein prachtvoller Blitz, eine schöne Rakete, eine ausbrennende Abendröthe, ein verhallendes Jauchzen, eine gehörte Harmonie, ein ausschwingendes Pendel – – – und wer weiß, was es noch alles ist.«
Nach einem Wort Nietzsches gehe bei ihm das Denken nach dem Gedankenstrich los. Hier sind es derer drei, die auf ein neues Denken nach den nachhaltigen Bildern und Klängen zum Abschluss des gestrigen Tages und dem Verlauf der feuchtfröhlichen Nacht mit sich allein, so ganz bei sich, zu deuten scheinen. Ein drittes Mal stellt sich der Protagonist der Erzählung nicht die Frage, was nun weiter sei. Er scheint nun klarer zu sehen als vor der Flasche Rüdesheimer, im Vollrausch einer Selbstbesinnung, wie ihn der geborene Romantiker weder im Traum seiner Sehnsucht noch in seiner Wehmut bei Tageslicht kennt: »Mein Herz ist kraftvoll und jede Fiber daran gesund, – und Du darfst schon heute auf Scherze rechnen, lieber Titus, denn wenn auch die zauberische Armida im Spiegel meines Innern schwebte, so ist selbiger doch ein fester blanker Stahlspiegel, der mir das Bild hält, daß ich es untersuchen möge. Vor der Hand bleibt sie als Studie, als neue Kunstblüthe da, als schönes Bild im Odeon, wo die andern stehen. Heute muß noch versucht werden, ob ich den Eindruck nicht in Farben herstellen kann, um mir seine reine Schönheit in alle Zukunft hinüber zu retten.«
Der Eheverzicht
In unserem Zeitalter, im Zeitalter nicht allein der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks, hätte ein kurzer Klick auf einen Fotoapparat oder einen Rechner genügt, um sich »seine Schönheit in alle Zukunft hinüber zu retten.« So einfach wäre es, ja man bräuchte nicht einmal ein professioneller Maler zu sein, um die derzeitige Herzensdame mit den verflossenen Geliebten in ein Kabinett von »Kunstblüthen« zu vereinen, um nicht etwa ihre reine Schönheit, sondern »seine reine Schönheit«, also die des Kunstwerks, alle Zeit bewundern zu können. – So revolutionär uns heute die technischen Neuerungen erscheinen, sie sind gar nichts gegenüber dem revolutionären Gedanken, wie ihn Stifter im Goethe-Zeitalter hegt (Armida ist eine Figur aus Torquato Tasso), als sich bekanntlich Männer um die Gunst einer Frau duellierten oder ihr – wie ein Novalis seiner im Alter von dreizehn Jahren verstorbenen Braut – ein Leben lang nachtrauerten. Die Sehnsucht, die trennende Entfernung zu überwinden, ob die geographische Ferne oder den bestehenden Standesunterschied, füllte ganze Romane und die Herzen der Menschen. »Zahlreiche Millionen Jungfrauen Europa’s habe ich hier zu Gegnerinnen«, weiß Stifters Held, »weil ein Riesenentschluß dazu gehört, alle künftigen Himmelreiche freiwillig bei Seite zu stellen, und weil sie thöricht meinen, diese müssen erst recht angehen, da die Aufschrift an der Pforte so schön gewesen sei – aber das Prachtthor führt nur zu oft in einen artigen Garten, der sich in Steppen verflachet, oder gar in einen Sumpf vergeht.«
Nicht die Vertreibung aus dem Paradies erscheint Stifters jungen Helden als eine Folge des Sündenfalls, sondern das Eheglück, weshalb er dieser »Pforte« zum Paradies ein so tiefes Misstrauen entgegenbringt, dass er den Gedanken des Glücks – als Krönung aller Liebe – vorab preisgibt, gleichsam die Treue aufkündigt, bevor er überhaupt in Verlegenheit käme, sie der angebeteten Schönheit zu versprechen. Ein Abziehbild ihrer Schönheit soll für alle Zukunft zu beider Glück gereichen – ein »närrischer Gedanke«, wie Stifters Held selbst einräumt, um ihn sodann näher auszuführen: »Außerordentlich schwärmerische Menschen, Genies, halbe Narren und dergleichen sollten gar nicht heirathen, aber die erste Liebe äußerst heiß, bis zu dem ersten Kusse treiben – und dann auf und davon gehen.« So unglaublich der Gedanke – er ist nicht um eine eingehende Begründung verlegen. »Man warte mit dem Zorne, die Gründe kommen erst. Der Halbnarr nämlich, und das Genie, und der besagte schwärmerische Mensch tragen so ein Himmelsbild [!] der Geliebten für alle zukünftigen Zeiten davon, und es wird immer himmlischer, je länger es seiner Phantasie vermählt ist; denn bei dieser ist es unglaublich gut aufgehoben, – die Unglückliche aber, der er so entflieht, ist eben auch nicht unglücklich; denn derlei herrliche Menschen, wie der Flüchtling, werden meist spottschlechte Ehegemahle, weil sie über vierzig Jahre immer den ersten Kuß und die erste Liebe von ihrer Frau verlangen, und die dazugehörige Glut und Schwärmerei – und weil es ihr nicht durch die Flucht so zuwider wird, wie er es als Ehemann mit seinen Launen und Excentricitäten würde, sondern sie sieht auch durch alle Zukunft in ihm den liebenswürdigen schönen, geistvollen, starken, göttergleichen Mann, der sie gewiß höchst beseligt hätte, wenn er nur nicht früher fortgegangen wäre.«
So närrisch, ja buchstäblich »phantastisch« jener Liebhaber erscheint, der um das Bild einer reinen, unverstellten Liebe willen seine Liebe preisgibt, so uneigennützig wirkt er nun auch wieder nicht. Nicht nur dass in den letzten Zeilen ein Unterton von Selbstmitleid mitschwingt, wenn die einstige Geliebte sich einmal vor Augen führen wird, welchen Göttergatten sie da doch verloren hat. Es geht offensichtlich längst nicht mehr um das Bild der Frau, um das Bild ihrer Schönheit und Jugend, um »ein Himmelsbild der Geliebten für alle künftige Zeiten«, das ein dem Realitätsprinzip abgeneigter Liebhaber gleich einer Reliquie in seinem Herzen pflegt. Auch das Lustprinzip stößt auf seine Grenzen, insofern nach Nietzsches Zarathustra alle Lust Ewigkeit will. Denn auch eine Liebe im ganz irdischen, erotischen Sinne, reine Leidenschaft ist auf Wiederholung aus; wer sie um ihrer Konsequenzen willen scheut, darf sie immerhin der Geliebten zugestehen.
Genau davor aber scheut Stifters Protagonist zurück, weil Liebe eines bedeutet, was er um keinen Preis zu geben bereit ist: Hingabe, Selbsthingabe. Es widerspricht seinem eiskalten Kalkül, sich nach den Stürmen seines Herzens, ja nach dem Ausleben seiner Leidenschaften und Träume im Hafen der Ehe zu finden, sich also an die Geliebte zu binden. Daher weist er samt dem Bild der Geliebten auch den Gedanken der Ehe ins Reich der Phantasie. »Und ist eine solche Phantasieehe nicht besser und beglückender, als wenn sie beide im Schweiße des Angesichtes an dem Joch der Ehe tragen und den verhaßten Wechselbalg der erloschenen Liebe langsam und ärgerlich dem Grabe hätten entgegenschleifen müssen.« Was hier als Frage gefasst ist, endet nicht mit einem Fragezeichen, sondern mit einem Punkt, also als Feststellung. Denn für den Menschen Stifters steht es fest, dass die Ehe einer Depravation der reinen Liebe entspricht; dass sie das Ideal beschmutzt, für das er nun einmal lebt. Daher der Bruch mit dem Gedanken der Ehe, wie ihn kein Ehebrecher radikaler vollzogen hat, weil es dem Ehebrecher wenn schon nicht um den Besitz der Frau, so doch um die Befriedigung seiner Lust geht. Und so spricht er einen Gedanken aus, der nicht nur den Abschied vom Zeitalter der Romantik bedeutet, sondern in der Aufkündigung jeglicher ehelichen Bindung geradezu einer religiösen Apostasie gleichkommt. Ja, er schwört bei seinem Schöpfer: »Bei Gott, Titus, da ich auch so ein Stück eines Phantasten bin, so wäre ich im Stande, wenn ich die Unbekannte je finde, mich immer tiefer hineinzuflammen, und wenn dann einmal eine Stunde vom Himmel fällt, wo ihr Herz und mein Herz entzündet, selig in einander überstürmen – – – dann sag’ ich ihr: ›Nun drücken wir auf diese Herrlichkeit noch das Siegel des Trennungsschmerzes, daß sie vollendet werde, und sehen uns ewig nicht mehr – sonst wird dieser Augenblick durch die folgende Alltäglichkeit abgenutzt, und wir fragen einst unser Herz vergeblich nach ihm; denn auch in der Erinnerung ist er verfälschet und abgesiecht.‹« Um des einen Augenblicks willen, ja damit er durch seine Folgen auch nicht in der Erinnerung getrübt werden kann, wird der Gedanke an die Möglichkeit der Dauer der Liebe preisgegeben. Wer darauf hofft, sieht sich getäuscht. Getäuscht wird, wer auch nur dem Liebenden vertraut, der einem Spieler gleicht, der im Genuss des Augenblicks alles, was er besitzt, auf eine Karte setzt, wobei ihm sein Glück so gleichgültig wie nur sonst etwas ist. Es ist die Logik des Lustmörders, der für den Genuss des Augenblicks bereitwillig ein Leben hinter Gittern in Kauf nimmt; die Logik eines Amokläufers, der um der Sensation seiner Tat willen den Tod zahlreicher unschuldiger Menschen, einschließlich seines eigenen schuldhaften Todes in Kauf nimmt. Es ist die Logik eines Tyrannen, der den Tod von Millionen auf sich nimmt, um Weltruhm zu erlangen. Nur würde Stifters Held sicher gern auf jeglichen Weltruhm verzichten, ja selbst sein Leben hinter Gittern verbringen, wenn er von jeder ehelichen Bindung frei wäre, die ihm als Hölle auf Erden aufstößt. »So spräche ich, denn mir graut es, sollte ich auch einmal die Zahl vermehren jener Gestalten von Eheleuten, wie ich viele kenne, die mit ausgeleertem Herzen blos parallel neben einander existieren, bis eines stirbt und das andere ihm ein schönes Leichenbegräbniß veranstaltet. Himmel! lieber eine ächte unglückliche Ehe, als solch ein Zwitterding.« Es sei nur angemerkt, dass Stifter wohl beides erhielt, wobei er sich einerseits in sein Schreiben stürzte, das seiner Gattin gleichgültig war, andererseits das ausbleibende Eheglück durch reichlich Essen und Trinken kompensierte, so dass sich etwa Dichterkollege Gottfried Keller recht bestürzt von Stifters »philisterhafter« Erscheinung zeigte, die dem eigenen Herrenideal spottete.
Traum und Ideal
Wäre Stifter lediglich ein heimlicher Anarchist, der dem Lustprinzip frönte, ein verfeinerter Marquis de Sade gewissermaßen, nach einem Diktum Kafkas der Schutzpatron unseres Zeitalters, so verdiente es die kleine Geschichte »Wiesenbocksbart« wohl, als Abschied von der Romantik in die Literaturgeschichte einzugehen, aber keine nennenswerte Aufmerksamkeit aus theologischer oder philosophischer Sicht. Auch muss niemand eine Erzählung schreiben oder auch nur ein Verächter einer ehelichen Bindung sein, um etwas über die mögliche Banalität des Ehealltags in Erfahrung zu bringen. Die Gefahr seines Abgleitens ins Banale wird zu jeder Zeit eine Herausforderung zumal für die Liebenden darstellen, die sich im siebten Himmel wähnen, und kann den Tod für jede Ehe bedeuten, die über das Alltägliche nicht hinausfindet.
Das Tödliche, gar Häretische bei Stifter liegt indessen nicht etwa in irgendwelchen Gefährdungen oder Schwächen der Ehe durch Routine oder Nöte; gibt es doch erfahrungsgemäß durchaus so etwas wie das Glück des gemeinsamen Älterwerdens. Es liegt in einer unglaublichen Idealisierung des Glücks und der Liebe, so dass die wirkliche Liebe, das wirkliche Glück, dem Schmerz und Leid unabdingbar ist, gar nicht mehr dagegen ankommt. Hat doch ein unbekannter Dichter »den Weg des Glücks« auf den Punkt gebracht: »Verloren. / Gefunden. / Verloren gefunden: // der Weg des Glücks.« Keine Liebe, die nicht um die Verlorenheit, um die Selbstverlorenheit des geliebten Menschen weiß, der darauf wartet, aus ihr gelöst, ja von ihr erlöst zu werden durch den Liebenden. Auf keine andere Weise nimmt sich Gott des verlorenen Menschen an, in seiner Selbstverlorenheit.
Der Mens...