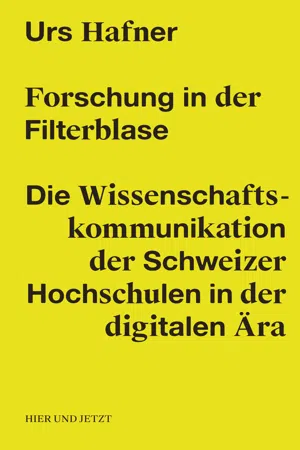![]()
Im Dienstleistungsmodus: Die Wissenschaftskommunikation
Wie steht es um die Wissenschaftskommunikation der Hochschulen? Insbesondere die Kommunikationsabteilungen der grossen Hochschulen sind grundsätzlich zufrieden mit ihrer Arbeit. Ihr Ausstoss wie ihr Portfolio sind denn auch beeindruckend. Die ETH Zürich (ETHZ) und die ETH Lausanne (EPFL) warten mit vielen starken News von der Forschungsfront auf. Manche Wissenschaftskommunikatoren indes sind mit der Auswahl des Stoffs nicht zufrieden, wie sie bemerkenswert freimütig bekennen. Sie sehen sich mit einem grossen Themenangebot konfrontiert, das sie nicht überblicken, oder sie haben zu viel vom Gleichen vorliegen. Einige wissen zwar, wovon sie gerne mehr hätten, aber nach eigenen Angaben fehlt das kompetente Personal, das die Themen ausfindig macht und aufbereitet. Die Wissenschaftskommunikatoren wissen: Theoretisch könnten sie aufgrund des vorhandenen Fundus eine bessere Wissenschaftskommunikation machen, das heisst journalistischer arbeiten: vielfältiger, kontroverser, aktueller.
Genf sagt, die Abteilung bräuchte mehr Kompetenzen, um fundiert über die Rechtswissenschaften und die Ökonomie berichten zu können. Die beiden Disziplinen sind in der Tat je auf ihre Weise ausgesprochen abstrakt, abstrakter als beispielsweise die Archäologie, die im Boden die alten Mauern eines Palastes findet, der dann spekulativ restauriert wird, oder als eine technische Wissenschaft, die einen neuen Roboter konstruiert, den man vorführen kann. Das heisst: Die Übersetzung eines rechts- oder wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsergebnisses ist aufwendig und nicht einfach. Ein Neuling schafft dies nicht ohne Weiteres. Und überlässt der Wissenschaftskommunikator bei der Erstellung der Medienmitteilung der Wissenschaftlerin die Federführung, die davon überzeugt ist, einen unpräzisen, nicht von ihr verfassten Entwurf berichtigen zu müssen, wird am Ende ein zu komplizierter und eben auch zu abstrakter, umständlich formulierter Text herauskommen. Er bleibt für das Zielpublikum, die breite Öffentlichkeit, schwer verständlich.
St. Gallen hätte gerne mehr Personal, das in den einzelnen «Schools» den genauen Überblick über die laufenden Forschungen hätte, stuft diesen Wunsch aber als unrealistisch ein. Basel findet selbstkritisch, die Auswahl des Stoffs folge keiner Strategie, sondern erfolge oft zu pragmatisch; man nimmt, was vorhanden ist beziehungsweise was man aus institutionspolitischen Gründen nehmen sollte. Die USI meint, die Auswahl des Stoffs hänge letztlich von der Proaktivität der Professoren ab: Es liegt also wenig Stoff vor, wenn diese passiv bleiben und die Kommunikationsabteilung nicht kontaktieren. Die Abteilung produziere zudem deutlich mehr News zur Biomedizin als zu den Sozialwissenschaften. Das sei bedauerlich, aber es sei nun einmal schwieriger, zu «female narratives on literature» eine gute Medienmitteilung zu verfassen als zu einem neuen Medikament gegen Malaria. Zürich wünscht sich eine bessere Planung der Themen, damit diese zielkonformer ausfallen. Es versucht, Schwerpunkte in den Bereichen Digitalisierung, Innovation und Biodiversität zu setzen. Das Unbehagen über eine von Zufällen abhängige Stoffauswahl wird deutlich geäussert. Luzern hätte gerne einen «Newsroom mit Spezialisten», welche die «Übersetzungsarbeit von den Wissenschaften in die Medien» besser meistern könnten. Ohnehin will Luzern die Forschung besser zeigen: deren Ergebnisse, aber auch, wie sie gemacht wird, etwa in Porträts.
Viele Kommunikationsabteilungen fühlen sich also für eine ihrer Kernaufgaben, nämlich die Kommunikation der Wissenschaften und besonders der Sozial- und Geisteswissenschaften, nicht kompetent genug, weil ihnen die geeigneten Leute fehlen. Das ist ein erstaunlicher Befund, erstaunlicher jedenfalls als der ebenfalls häufig geäusserte Wunsch nach mehr und kompetenterem Personal, das die Kanäle der sozialen Netzwerke betreut. Der Wunsch zeigt, dass die Wissenschaftskommunikation nicht überall höchste Priorität geniesst und zuweilen im Wissen darum praktiziert wird, dass sie besser gemacht werden könnte. Besser heisst auch: konzentrierter. Wie St. Gallen aber andeutet, ist es wohl tatsächlich illusorisch, mit beschränkter Personalzahl den totalen Überblick über alle laufenden Forschungsprojekte haben zu können. Was die viertkleinste universitäre Hochschule konstatiert, dürfte in noch höherem Mass für die vielen grösseren Hochschulen und Volluniversitäten gelten. Und tatsächlich dürfte oft der Fall sein, was unter anderen Basel, die USI und sogar die EPFL andeuten: Dass die Kommunikation, eine Dienstleistungseinheit, nehmen muss, was ihr angeboten und vorgesetzt wird, weil sie den Professor, die Forschungsgruppe oder vielleicht sogar die Hochschulleitung nicht brüskieren will. Diese nämlich will das Forschungsprojekt, das einen Exzellenzausweis erhalten hat oder dessen Autoren als Koryphäen gelten, weil sie in renommierten Journalen publizieren und preisgekrönt sind, kommuniziert wissen.
Nur: Als exzellent gelabelte Forschung ist oft nicht kommunikationsgeeignet. Und umgekehrt ist vielleicht die mediokre oder gar biedere Forschung viel spannender zu kommunizieren. Sowieso aber ist die Kommunikationsabteilung der Professorin, die sich die Mühe macht, ihr Projekt schon mal auf fünf Seiten zusammenzufassen, dankbar. Im Gegensatz zu anderen engagiert sie sich immerhin für die Öffentlichkeitsarbeit. Das heisst dann zuweilen im Ergebnis: Quantität vor Qualität. Zu kommunizieren gibt es immer etwas. Einige Kommunikationschefs deuten es an: Es wäre besser, wenn die Kommunikation auf keine Befindlichkeiten und Autoritäten Rücksicht nehmen müsste und nur das kommunizieren könnte, was in ihren Augen die breite Öffentlichkeit wirklich interessiert.
DER NUTZEN DER ORGANISATION
Wie jede Organisationseinheit eines Unternehmens oder einer Institution sind die Kommunikationsabteilungen angehalten, den Erfolg ihrer Arbeit auszuweisen. Es reicht selbstredend nicht aus, auf die neu gestaltete Webseite mit ihren Interaktionsmöglichkeiten zu verweisen oder auf einen gut besuchten öffentlich zugänglichen Anlass. Der Erfolg sollte mit Zahlen belegt werden. Und die Abteilungen müssen nicht nur belegen können, was sie produzieren, sondern auch, ob die Produkte ihrer Arbeit dazu führen, dass die gesetzten Ziele erreicht werden. Wenn etwa das Ziel lautet, den Nutzen der Universität aufzuzeigen oder deren Legitimation zu stärken, ist allerdings die Erfolgskontrolle nicht einfach durchzuführen. Diese erfolgt in den einzelnen Kommunikationsabteilungen unterschiedlich. Wahrscheinlich alle benutzen das einfachste Mittel: den klassischen Medienspiegel. Wie oft werden Medienmitteilungen in der Presse und im Internet aufgegriffen? Die Hochschulen nehmen dafür die Dienste des 1896 in Genf gegründeten Medienbeobachtungsunternehmens Argus – neuerdings Argus Data Insights – in Anspruch, das seit 2004 auch die sozialen Netzwerke nach den Namen ihrer Kunden durchforstet.
Überraschend entpuppt sich die EPFL, eine der potentesten Wissenschaftskommunikatorinnen der Schweiz, als bekennende Minimalistin: Sie würden nicht viel machen, um den Erfolg zu messen, nur Statistiken zu ihren verschiedenen Kanälen führen, sagt die Kommunikationsleiterin. Basel sagt, sie mässen den «Output», also die Anzahl der von der Abteilung produzierten Beiträge und News, und mit Argus den «Outcome», also die Rezeption in den Medien, im Internet und die Interaktionen mit der Aussenwelt. Den weitergehenden Erfolg zu bestimmen, sei schwierig. Die Universität Lausanne gibt sich skeptisch: Sie schaue sich den Medienspiegel an und die Besucherzahlen bei den Tagen der offenen Türen, führe aber keine grossen quantitativen Messungen durch, das ergebe keinen Sinn. Vielmehr setzt Lausanne auf «qualitative Gespräche», zum Beispiel mit Parlamentariern. Genf sagt, man müsse die Messungen vorsichtig beurteilen und die Ausrichtung auf möglichst hohe Zahlen kritisch hinterfragen. Die Universität sei kein privates Unternehmen, sondern habe einen öffentlichen Auftrag; sie informiere auch dann, wenn es sich nicht rentiere, also wenn ein Medienunternehmen die Arbeit einstellen würde.
Was man messen könne, das messe man. Gerade die Kommunikation in den sozialen Netzwerken könne man extrem gut messen; es gebe fast unendlich viele Indikatoren. Luzern sagt, es benutze das Argus-Medienmonitoring und beobachte, in welchen Kontexten und wie die Universität und ihre Forschenden erwähnt würden. Das sei aber mit Vorsicht zu geniessen. Die Anzahl der Nennungen in den Medien und auf Plattformen nehme stets zu, es werde immer unüberschaubarer. Ähnlich äussert sich Freiburg.
Alle diese Institutionen beobachten also die Medien, zählen die Veröffentlichungen und führen unter Umständen auch Gespräche. Sie sind mit diesem Zustand zufrieden. Sie sagen, was sie machen – und was sie nicht machen: Reputation messen. Ohne dass sie nach ihr gefragt worden wären, führen sie die «Reputation» ins Feld; eigentlich ging es in den Interviews um den Erfolg der Arbeit. Der Erfolg könnte auch anders formuliert werden, zum Beispiel in der Gesellschaft das Reflexionswissen erhöht zu haben. Bern sagt, es nehme keine Reputationsmessung vor, würde das aber gerne tun, und sowieso bräuchte es eine Wirkungsforschung und ein Instrument, um den Erfolg der Arbeit zu messen. Eine kleine Gruppe von Hochschulen bedient sich für die Erfolgskontrolle explizit der Reputationsmessung. St. Gallen sagt, es mache klassisches Medienmonitoring und benutze das Medienreputationsmanagement des Forschungsinstituts Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich. Gleiches gilt für Zürich, die ETHZ und die FHNW. Die USI benutzt neben Argus und einem weiteren Medienbeobachtungsdienst ein Instrument für die quantitative und qualitative Reputationsmessung. Die Frage nach dem Erfolg der Arbeit führt also in den meisten Fällen zur Frage nach der Reputation. Wenn St. Gallen und die USI betonen, sie würden strikt zwischen Marketing und Wissenschaftskommunikation trennen, wirkt das wie eine Schutzbehauptung, denn Reputationspflege ist kaum vom Marketing in einem erweiterten Sinn zu trennen. Luzern sagt denn auch, die Arbeit der Kommunikationsabteilung sei nicht immer einfach, weil im Selbstverständnis mancher Wissenschaftler das Marketing der Universität keinen Platz habe, als ob Marketing etwas Verwerfliches wäre. Die Luzerner Kommunikationsabteilung sieht sich also mit marketingfeindlichen Professoren konfrontiert.
Was ist das Ziel der Wissenschaftskommunikation? Ein Begriff taucht in Interviews und Dokumenten immer wieder auf, explizit oder implizit: der Nutzen – der Wissenschaften, der Forschung, der Universität. Nutzen meint definitionsgemäss den Vorteil, Gewinn und Ertrag, den eine Tätigkeit oder Fähigkeit abwirft. Bern sagt, die Forschungskommunikation habe den Auftrag, den Nutzen der Universität für die Gesellschaft stärker sichtbar zu machen. Die Universität solle selbstbewusst ihre Leistungen aufzeigen; stark sei sie insbesondere in den Bereichen Astrophysik, Zahnmedizin, Klima und Weltraum. In der Öffentlichkeit werde viel zu wenig diskutiert, was eine Universität alles leiste, was der Judaistik-Student mache und wie die Geisteswissenschaftlerinnen lernten, über eine Sache nachzudenken. Die Universität bilde kreative und kritische Geister aus. Auch Luzern sagt, die Kommunikationsabteilung wolle einem breiten Publikum die Wichtigkeit und den Nutzen der Universität vermitteln. Die Universität Luzern sei eine Institution, deren Forschung sich um die Menschen drehe, wie sie glaubten, handelten, Verträge abschlössen, wirtschafteten und sich um die Gesundheit kümmerten. Diese «Menschbezogenheit» der Universität sei zugleich ihr Image: Dass sie eine persönliche und überschaubare Institution sei, wo man einander kenne und aufeinander zugehe.
Die ETHZ betont, die Hochschulen müssten beweisen, dass sie nützlich seien. Die Kommunikation zeige, dass die ETHZ kein Elfenbeinturm sei, sondern für die Öffentlichkeit eine grosse Relevanz habe. Ähnlich äussert sich St. Gallen: Die Kommunikationsabteilung müsse aufzeigen, wie die Universität zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitrage. Einer der in dieser Hinsicht wichtigen Sätze laute: «Aus einem macht die HSG fünf Franken.» Lausanne sagt, alle Menschen in der Region Genfersee müssten wissen, dass die Hochschulen diesem Raum etwas brächten. Hingegen sei es – das ist bemerkenswert – kein Ziel, dass sie etwas von Wissenschaft verstünden. Die Wissenschaften seien für die meisten Personen zu kompliziert. Die Botschaft der Kommunikation sei einfach: Die Universität rentiere für den Kanton, die Hochschulen würden Unternehmen schaffen, die Dynamik sei täglich sichtbar. Die heute so stark entwickelte Region sei vor noch nicht allzu langer Zeit reines Landwirtschaftsland gewesen.
Andere sprechen den Nutzen eher indirekt an. Für Zürich besteht die Aufgabe der Wissenschaftskommunikation darin, die Legitimation der Universität zu stärken. Das bedeute, dass die Kommunikation positiv sein müsse. Und das bedeutet auch, den gesellschaftlichen Nutzen der Universität aufzuzeigen. Die EPFL greift quasi nach den Sternen: Man berichte neutral über Dinge, welche die Gesellschaft vorwärtsbrächten, aber am Ende gehe es darum, dass die Hochschule zu einer besseren Welt beitrage, damit wir alle besser leben könnten und die Umwelt besser behandelten. Alle Personen, die an der EPFL arbeiteten, glaubten an dieses Ziel und teilten diese Idee. Und man müsse auch zeigen, dass unser Wohlstand von der offenen Forschung für eine bessere Welt abhänge. Weil Forschung so wichtig sei, sei sie auch so teuer. Das müsse man zeigen. Freiburg sagt, die Kommunikation habe drei Ziele: Wissensvermittlung, Imagebildung, Reputationssteigerung. Reputation ist also auch für Institutionen zentral, die sie nicht messen lassen. Für die Imagebildung diffundiert Freiburg drei Kernbotschaften: die Nähe der Menschen, die Nähe zwischen Dozierenden und Studierenden, der überschaubare Campus, die Mehrsprachigkeit und die Exzellenz. Die Marke Universität Freiburg müsse gestärkt werden. Basel verfolgt sowohl globale als auch regionale Ziele. Zur Erreichung Letzterer werden die Forschungsprojekte mit regionaler Verankerung hervorgehoben: invasive Pflanzen, Geothermie, Bitcoin. Die Bevölkerung soll merken, dass die Universität etwas zu ihrer Lebenswelt zu sagen hat, und die Institution, die von der Politik unter Spardruck geraten ist, auch in Zukunft unterstützen. Für die globale Ebene füttert Basel einschlägige Forscher-Communitys mit Wissenschaftsmeldungen, damit die Institution im Gespräch bleibt und in den Rankings gute Noten erhält. Das Tessin hat, wie bereits angemerkt, seine Identität zu seinem Image erkoren, dass nämlich die USI ein Ort der realen Chancen sei. Die Kommunikation soll dieses Image stärken.
Auffallend zurückhaltend äussern sich in Bezug auf die Ziele Genf und Neuenburg. Beide berufen sich auf die gesetzlich vorgegebene Aufgabe der Wissensvermittlung. Die beiden Institutionen erwecken den Eindruck, sie würden letztlich einer ganz einfachen Tätigkeit nachgehen: das an der Universität produzierte Wissen in der Öffentlichkeit verbreiten. Genf sagt, alle Meldungen müssten «wissenschaftlich fundiert» sein, so bekämpfe man Fake News. Da ist keine Rede von Reputationsbewirtschaftung, Imagepflege, Nutzenüberlegungen und dergleichen; die schnöde Welt des Marketings und die sich konkurrierenden Hochschulen sind weit weg. Genf und Neuenburg beschwören quasi die ideale Welt der Wissenschaftskommunikation – auch wenn sie einräumen, dass bei «heiklen Themen», also vorab bei Tierversuchen und der Ausbildung für Imame, ein von oben verordneter Kommunikationsplan vorliege – das Issue Management.
Die Wissensvermittlung an die Öffentlichkeit geben – ausser die Universität Lausanne – alle Hochschulen als Ziel an, aber bei den meisten Hochschulen steht diese im Dienst der Reputation, des Images, der Akzeptanz und Legitimation der Institution. In der Praxis dürften die Unterschiede wegfallen: Auch Neuenburg und Genf veröffentlichen keine Medienmitteilungen, die auf sie ein schlechtes Licht werfen oder von Teilen der Öffentlichkeit als Provokation aufgefasst werden könnten. Die Kommunikation dreht sich immer wieder um die Reputation der Institution, ob nun der konkrete wirtschaftliche Nutzen ins Feld geführt wird, den diese angeblich hat, oder ihr Beitrag zur Verbesserung der Welt.
Das Nutzenargument ist anschlussfähig an den Innovationsdiskurs, aber das macht es nicht besser. Die Innovation, von der in der Bildungspolitik, in der Wirtschaft und auch in der Wissenschaftskommunikation gesprochen wird, reduziert die wissenschaftliche Neuerung gewöhnlich auf das aus einer Erfindung gewonnene marktfähige Produkt. Innovativ ist also ein neues Navigationsgerät, das von einem Start-up-Unternehmen erfolgreich verkauft wird, oder eine leicht handhabbare Software, die einem Spital die Anzahl und den Standort der aktuell verfügbaren leeren Betten anzeigt, nicht aber das Reflektieren unreflektiert eingesetzter Begriffe wie Innovation und Nutzen. Aber der Grossteil der Grundlagenforschung ist keineswegs ökonomisch nützlich, vor allem nicht teure Forschung wie die unterirdischen Cern-Experimente oder astrophysikalische Ausflüge ins Weltall. Was nützlich überhaupt bedeuten könnte, wäre zu diskutieren. Und profitiert die Gesellschaft wirklich von Latein und Kunstgeschichte? Justin Stover, Lecturer für Mittellatein, hat kürzlich in einem provokanten Artikel geschrieben, die Geisteswissenschaften seien vor allem selbstbezüglich und sollten das endlich zugeben. Ihre Legitimierungsversuche seien so hilf- wie nutzlos.50 Das ist überzogen. Markus Zürcher, der Generalsekretär der Schweizerischen Akademie für Geistes- und Sozial-wissenschaften, hält dagegen, dass die Geisteswissenschaften die mittels Modellen und Experimentalanordnungen gewonnenen Erkenntnisse der Naturwissenschaften in ein alltagstaugliches und damit wirksames Wissen für die reale Welt transformierten.51 Das ist die offensive Gegenposition.
Bescheidener wäre, mit Max Weber folgenden Nutzen der Wissenschaften zu erörtern – mit dem Eingeständnis, dass er keineswegs der Normalfall ist.52 Erstens verschaffen sie uns Kenntnisse über die Technik: Wie man das Leben, die äusseren Dinge wie das Handeln, beherrscht und mit welchen Mitteln man zu welchen Zielen gelange. Zweitens vermitteln die Wissenschaften Methoden des Denkens. Wer einmal in der Forschung tätig war, wird die Dinge nicht nur seines Fachgebiets fortan mit anderem, systematischerem und vielleicht auch reflektiertem Blick sehen. Und drittens bringen die Wissenschaften den Einzelnen dazu, sich selbst Rechenschaft zu geben über den letzten Sinn seines eigenen Tuns. Und dazu gehört die Einsicht, so Webers philosophische Pointe, dass Wissenschaft an sich sinnlos sei. Sie gebe keine Antwort auf die Frage, was wir tun und wie wir leben sollten. Der Weg zum richtigen Sein, zur schönen Kunst, zum perfekten Staat, zur echten Natur – er führe nicht über die Wissenschaft.
Kommt dazu: Wissenschaft und Technik haben, wie Niklas Luhmann schrieb, auch dämonische Wirkungen.53 In der Tat: Man denke an Atombomben, chemische Gifte, das Klonen, an den toxischen Abfall der forschungsgetriebenen Digitalindustrie. Der von der Gesellschaft installierte Ethiktank sei nicht gross genug, um genug ethische Gesinnung an alle Schwachstellen unserer Gesellschaft zu leiten, sagt Luhmann sarkastisch. Und mit den Lehrstühlen für Ethik, die zu Luhmanns Zeit noch nicht en vogue waren, delegieren Gesellschaft und Politik ihre Verantwortung an die Wissenschaften. Auch die selbstfahrenden Autos haben sich bisher nicht als Segnung erwiesen. Angesprochen auf die zahlreichen, von den Entwicklern provozierten und meist vertuschten Unfälle, gab ein Programmierer in Kalifornien kürzlich im New Yorker zu Protokoll: «If is your job to advance technology, safety cannot be your No. 1 concern. If it is, you’ll never do anything.»54
SOCIAL MEDIA: KEINE WUNDERWAFFE
Die sozialen Netzwerke sind für alle Hochschulen ein grosses Thema: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Snapchat. Sie halten die Kommunikationsabteilungen auf Trab. In den Augen der meisten Befragten gehören sie zu den Desideraten ihrer Abteilungen, zusammen mit Videos, Multimedia, Datenvisualisierung und interaktiven Webseiten. Selbstredend sind die sozialen Netzwerke davon nicht zu trennen. Wer über ein neues Video verfügt, lädt es auf YouTube hoch, bettet es in Facebook ein, bewirbt es mit Twitter und Instagram. Alle Kommunikationsabteilungen verfolgen die Strategie, möglichst viele Follower und Likes zu sammeln. Meine gemäss dem Verhältnis der Anzahl Facebook-Likes zur Anzahl Studierender erstellte Reihenfolge sieht so aus (Stand 2018): An erster Stelle liegt die EPFL (72 600 Likes), gefolgt von der USI (1200 bei nur 3000 Studierenden), St. Gallen und der ETHZ – wobei ich nur die Hauptkanäle berücksichtigte, nicht die Kanäle einzelner Institute, die je nach Betreuung des Kanals und der Gemeinschaftsbildung hohe Werte aufweisen. Zuhinterst auf der Facebook-Rangliste liegt Freiburg. Es hat als einzige Institution weniger Likes als Studierende.
Generell gilt: Je grösser eine Kommunikationsabteilung ist, desto grösser sind ihr Social-Media-Output und desto zahlreicher ihre Social-Media-Fans und -Follower. Allerdings: Je höher deren Zahl ist, desto schwieriger wird es selbst für eine grosse Abteilung, diese noch weiter zu erhöhen. Es ist einfacher, schnell einen stattlichen Grundstock anzusammeln. Eine kleine Hochschule kommt einfacher zu einer relativ hohen Zahl als eine grosse Hochschule. So hat die Universität Zürich, die grösste Hochschule, nicht die meisten Fans. Die Social-Media-Königin ist die EPFL. Die Anzah...