![]()
INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG
GESCHICHTE UND GESCHICHTEN
Unverheiratete Frauen ...
... verheiratete Männer
Die Historikerin als Teil der Geschichte
Aufbau
Quellenlage
METHODE
Geschlechtergeschichte: ledige Frauen – verheiratete Männer
Alltagsgeschichten und Fallstudien von Familien
Forschungsgeschichten und der Blick der Historikerin
Geschichte als Kunst der Textinterpretation
ZEITLICHE UND ÖRTLICHE HINTERGRÜNDE
DIE NATIONALE BÜHNE – HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER SCHWEIZ 1910–1950
GEOGRAFISCHE SCHAUPLÄTZE UND NETZWERKE
TABELLARISCHE DARSTELLUNG DER WOHNORTE UND LEBENSDATEN DER GESCHWISTER SCHNYDER
KURZBIOGRAFIEN
Ernst Schnyder
Lilly Schnyder
Hedwig Schnyder
Hans Schnyder
Hanna Schnyder
Sophie Hablützel-Schnyder
Rosa Schnyder
Martha Schnyder
Karl Schnyder
Gertrud Schnyder
Paula Schnyder
Walter Schnyder
FAMILIENTAFEL
BAUERNSOHN UND HÖHERE TÖCHTER: WURZELN UND WERTE DER BILDUNGSBÜRGERLICHEN PFARRFAMILIE
RELIGION, ERZIEHUNG, BILDUNG UND DIE POSITION DES VATERS
Vom Heimarbeitersohn zum Pfarrer
Der Aufstieg ins Bildungsbürgertum und die Heirat mit höheren Töchtern
Die «positive» Theologie und der Zofinger Abendmahlshandel
Pfarrer und Vater: Seelsorge und Unterricht auf Schritt und Tritt
Innere und äussere Mission – Pietismus im Pfarrhaus des 19. Jahrhunderts
RELIGION, ERZIEHUNG, BILDUNG UND DIE POSITION DER ERSTEN MUTTER MUTTER
Die Pfarrerstochter wird Pfarrfrau
Die Kinder sind eine von Gott zugewiesene Aufgabe
RELIGION, ERZIEHUNG, BILDUNG UND DIE POSITION DER ZWEITEN MUTTER
Die Rentierstochter wird Lehrerin
Die neue Frau Pfarrer als begabte Pädagogin
GEBURT UND TOD ALS MASSGEBENDE ERLEBNISSE
Geburten
Tod
MUSIK UND LITERATUR: DIE BÜRGERLICHE KUNST, SICH SELBST ZU ERKENNEN
Gesang und Musik als Ausdruck des Herzens
Gemeinsames Musizieren und die Sonderstellung des Klaviers
Lesen, Vorlesen, Zuhören und der Drang nach Austausch und Bestätigung
BEDEUTUNG DER FAMILIÄREN GEMEINSCHAFT
Tradition, Religion und bürgerliche Normen: Memoiren des ältesten Bruders
Ausschluss bei Normüberschreitungen: Gedichte der Schwester Sophie
BERUF, BERUFUNG, SCHICKSAL UND ÖKONOMIE
BERUFSWAHL UND DIE THEORIE DER GESCHLECHTSCHARAKTERE
Der so genannte Frauenüberschuss
Männliche und weibliche Geschlechtscharaktere und die Ergänzungstheorie
DIE GESCHWISTERFOLGE UND DIE BESTIMMUNG VON BERUFEN
Die Ausbildung der Brüder
Der Beruf der Schwestern
Geistige Mütterlichkeit
Ungleich nicht nur im Geschlecht, sondern auch in der Geschwisterreihe
DIE SCHWESTER ALS HAUSMÜTTERCHEN: ÖKONOMISCHE UND BERUFLICHE ENTSCHEIDUNGEN DES ÄLTESTEN BRUDERS UND SEINER KLEINEN SCHWESTER
Gottes Weg, Bruders Wille und die Entscheidung der Schwester
Schluss
«MEIN LIEBER BUB!» – WISSENSAUSTAUSCH UND RAT DER ÄLTEREN SCHWESTER UND IHRES KLEINEN BRUDERS
Klavierstunden und Literaturkritik: die Schwester als Lehrerin
Schluss
DIE ÄLTERE SCHWESTER ALS VORGÄNGERIN DER JÜNGEREN – 50 JAHRE PRIMARSCHULE EINER SCHWEIZER LANDSTADT
Wo bleiben Stimmrecht und gleicher Lohn? – eine der ersten Lehrerinnen im Thurgau
«Die Erziehung der Kinder wird einem wichtiger als das Wissen» – Unterrichtspraxis um 1900
Wohltätigkeit und öffentliche Ämter
«Überzeugtes Einspannertum» – die neue Generation der Lehrerinnen
Schluss
SCHWESTERN ALS ERGÄNZENDE LEBENSPARTNERINNEN – 30 JAHRE EVANGELISCHES TÖCHTERINSTITUT HORGEN
Vielfältiges Institutsleben, kaum Privates
Wandel der Jugendkultur und die strenge Vorsteherin
Ergänzende Partnerinnen bis ins hohe Alter
Schluss
DIE SCHWESTER ALS DIAKONISSE – AUSGESANDT AUF STATION – HEIM INS MUTTERHAUS
Evangelische Schwesterngemeinschaft und Mutterhaus
Ausgesandt und «versucht»
Aufgehoben im doppelten Sinn
Schluss
DIE SCHWESTER ALS GOUVERNANTE – FLORENZ UND MAILAND 1906–1943
Die Schwester in der Ferne
Die Bedeutung der Schweizer Gouvernanten
«Ich bin halt stets verliebt in Florenz» – unsichere Bindungen, die das Leben bedeuten
Rückkehr
SCHLUSSFOLGERUNG
ALLTAGSLEBEN UND ALLTAGSERLEBEN
WOHNRÄUME ZWISCHEN ÖFFENTLICHKEIT UND INTIMITÄT
«Daheim» bei Mama – lebenslänglich
Die eigene Wohnung
Vom Stübchen zur Schwesternwohngemeinschaft
Schluss
GESCHWISTER ALS DIE BESTE GESELLSCHAFT – ODER: WIE VIEL PLATZ BLEIBT BEI ZWÖLF GESCHWISTERN FÜR DIE PFLEGE VON AUSSERFAMILIÄREN BEZIEHUNGEN?
Unterdrückte Sexualität der Schwestern, institutionalisierte Sexualität der Brüder
Verbotene Schokolade
Verbotene Liebe
Der verheiratete Bruder und der Kinderwunsch
Schluss
BESUCHSRITUALE UND FESTE
Der Vier-Uhr-Tee und andere Besuchsrituale
Besondere Anlässe und Feste
Familienfeste, Geburtstage und Weihnachten
Schluss
WANDERN DURCH GOTTES SCHÖNE WELT – PATRIOTISMUS UND RELIGIOSITÄT IM INTENSIVEN NATURERLEBNIS
Wandern als Freizeitbeschäftigung
Wandern mit den Geschwistern oder allein
Schluss
POLITISCHE POSITIONEN IN DER FAMILIE – HELVETISCHE DISKUSSIONEN ÜBER ZWEI WELTKRIEGE
Militärische Positionen und politische Standpunkte der Brüder 1914–1918
Einmachen, Sparen, Stellung halten – die Schwestern 1914–1918
Das Geschwisternetzwerk in der Zwischenkriegszeit
Zweiter Weltkrieg: politische Einigkeit der Brüder und das Schweigen der ledigen Schwestern
Schluss
TRADIERTE FAMILIENGESCHICHTEN UND DER BLICK DER FORSCHERIN
MÜNDLICHE FAMILIENGESCHICHTEN UND DAS FRAGMENTARISCHE
Mündliche Erzählungen und schriftliche Quellen
Mündliche Erzählungen und fehlende schriftliche Quellen
Verstummte Familienerzählungen und das Schweigen der Quellen
Der Ausflug auf den Stockberg – aktiv gelebte Familienerinnerung
SELBSTÄNDIGWERDEN DER HISTORISCHEN AKTEURE IM NARRATIVEN PROZESS DES SCHREIBENS
GESCHICHTE ALS SPURENSUCHE, DIE DEM JETZT BEDEUTUNG GIBT
ANHANG
Abkürzungen
Archive
Anmerkungen
Quellen- und Literaturverzeichnis
Gespräche
Ungedruckte Quellen
Nekrologe
Gedruckte Quellen
Sekundärliteratur
Bildnachweis
![]()
Die Welt braucht auch Schwestern, nicht Mütter nur.
Martha Schnyder, 1920.
VORWORT
Die konzentrierte und rasche Verwirklichung dieser Dissertation wurde durch Stipendien des Schweizerischen Nationalfonds, der Max Geldner Stiftung und der Akademischen Gesellschaft Basel ermöglicht. Meine Doktormutter Prof. Regina Wecker hat mich während der ganzen Zeit ermutigt und bestärkt, den eingeschlagenen Weg zu beschreiten. Dr. Heidi Witzig danke ich herzlich für ihre Bereitschaft, meine Arbeit zu begleiten, für die vielen Anregungen, Ergänzungen und für die klärenden Gespräche. Prof. Rosi Braidotti und Prof. Bertekke Waldijk am Center for Women Studies an der Universität Utrecht erweiterten meinen Blick auf Geschlechtergeschichte und bewegten meine Position innerhalb der Arbeit nachhaltig.
Einen ganz besonderen Dank möchte ich an meine Eltern Christoph und Züsi Schnyder-Scheuermeier und an meine Tante Brigitte Schnyder richten. Sie standen mir mit reger Anteilnahme und grossem Interesse zur Seite, öffneten Tore zu Materialien, lasen Texte, gaben Feedbacks und eilten mit Rat und Tat in allen Belangen zu Hilfe. Ich danke auch Ernst Gysel, Hans Schnyder, Hans Walter Schnyder, Rudolf Schnyder und Beth Werner-Schnyder für Informationen, den Zugang zu grundlegenden Quellen und die Bereitschaft zu Gesprächen.
Sibylle Meyrat und Claudia Settelen winde ich für ihr kritisches Gegenlesen ein Kränzchen, Dietrich Seybold für die vielen Tipps und kritischen Gedanken während der ganzen Arbeit.
Michael Gärtner danke ich für die treue Begleitung, seine Unterstützung und sein geduldiges Verständnis. Die Betreuerinnen des «Schnäggehüsli» liessen mich bis zum Ende mit einem guten Gefühl meiner Arbeit nachgehen, und Helena und Joachim sorgten in den vielen lustigen Stunden, die mich von der Arbeit abhielten, dafür, dass ich mich der Welt nicht entfremdete.
Basel, im Januar 2008
Arlette Schnyder
![]()
![]()
GESCHICHTE UND GESCHICHTEN
Ernst, Marie, Hedwig, Hans, Hanna, Sophie, Rosa, Martha, Karl, Gertrud, Paula, Walter. Zwölf Geschwister, geboren in der Schweiz, zwischen 1873 und 1897. Acht Schwestern, sieben blieben unverheiratet, nur eine – Sophie – heiratete und liess sich zehn Jahre später wieder scheiden. Keine hatte Kinder. Vier Brüder, alle waren verheiratet und hatten Kinder. Sie standen in wichtigen offiziellen Ämtern: Pfarrer, Posthalter, Arzt und Gymnasiallehrer. Auch alle Schwestern lernten einen Beruf. Alle hatten eine Ausbildung als Lehrerin, Kindergärtnerin oder Erzieherin. Einige entschieden sich später für andere Wege: Eine wurde Diakonisse, eine andere Sekretärin und eine gar Institutsleiterin.
Die erste Frage, die sich bei dieser Fallstudie aufdrängt, ist die, weshalb alle diese Frauen ledig blieben. Diese schwierige Frage soll zunächst zurückstehen und der Frage, wie sie alle ledig blieben, weichen.1 Dieses Wie zeigt sich in unzähligen Geschichten. Ich erzähle also Geschichten. Denn Geschichte ist immer Geschichten erzählen. Geschichte ist eine Auswahl von Geschichten im Geschehen eines bestimmten Zeitraumes, einer bestimmten Personenkonstellation. Geschichte ist eine Perspektive. Von einem späteren Zeitpunkt auf einen früheren Zeitpunkt.2 Bereits 1978 verwies Hayden White mit seinem Artikel «The Historical Text as Literary Artifact» auf die narrative Arbeit der Historiker. Er wollte der Arbeit mit ...
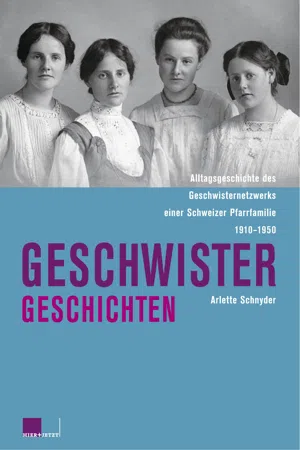
![1 Familie Johannes und Caroline Schnyder-Wyttenbach, Bischofszell 1898 (v. l. n. r. stehend: Söphy, Hans, Hedwig, Vater Johannes, Lilly, Ernst, Marthy; v. l. n. r. sitzend: Karl, Trudi [stehend], Hanna, Mutter Caroline mit Walter, Paula, Tante Julie von Wyttenbach, Rösy).](https://book-extracts.perlego.com/2809693/images/1-plgo-compressed.webp)