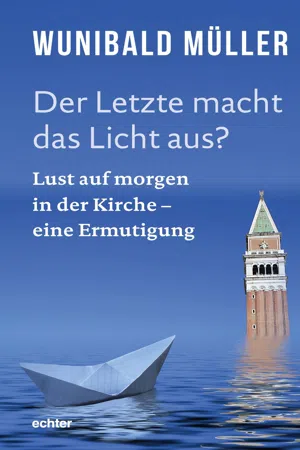![]()
III. TEIL
![]()
7. Kapitel
Wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten
Sich mit unserem Schatten auseinandersetzen
Wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten. Gerade Einrichtungen, die großen Wert auf Ideale legen, die sich mit viel Licht umgeben, um gut herauszukommen, dürfen das nicht vergessen. Denn: je größer das Licht, desto größer der Schatten. Das kann auch gar nicht anders sein. Denn wollen wir im Licht erscheinen, wollen wir glänzen, dann dürfen andere nur unsere Sonnenseite sehen, unsere anscheinend garstige Seite hat da natürlich keinen Platz, also wird sie in den Schatten abgestellt. Die Außenwelt soll vor allem die Sonnenseite sehen, die man mit Begriffen wie Uneigennützigkeit, Hingabe, Demut, Liebe umschreiben könnte. Die weniger schöne Seite, die es aber natürlich auch gibt und für die Begriffe wie Geltungsdrang, Verschwendung, Machtgier stehen, wird in den Schatten abgestellt.
Was ich über Institutionen und ihren Schatten sage, die anscheinend sehr ideal ausgerichtet sind, gilt auch für jeden Einzelnen von uns und in besonderer Weise auch für Personen, die als besonders ideal eingestellt, gut, gar heiligmäßig gesehen werden, sich selbst so sehen oder von denen man erwartet, dass sie so sind. Die Folge davon ist: Die Person, die wir wirklich sind, unsere ganz eigenen, auch einzigartigen Eigenschaften, Eigenheiten und Charaktermerkmale werden dementsprechend gestutzt und eingeschränkt. Das, was wir wirklich denken, wie wir tatsächlich fühlen, von dem wir persönlich überzeugt sind, kommt nur gefiltert zum Zuge. Bei dem, was in den Schatten verfrachtet worden ist, kann es sich um sogenannte schlechte Eigenschaften handeln, wie Egoismus, Neid, Eifersucht, aber auch Seiten von uns, die entscheidend dazu beitragen, dass wir emotional lebendig bleiben und Zufriedenheit in unserem Leben erfahren, wie Neugierde, Kreativität, selbstbestimmtes Auftreten, Freude an sinnlichen Erfahrungen.
Unseren Schatten annehmen
Unser Schatten ist im Laufe unseres Lebens in einem Anpassungsprozess an die Gegebenheiten und Erwartungen unserer Umwelt entstanden. Dabei wurden viele Seiten, Eigenschaften, Neigungen von uns, die zu uns gehören und uns ausmachen, dem Außen geopfert, in den Schatten abgestellt, da sie anscheinend vor der Außenwelt nicht bestehen oder uns dort möglicherweise in Konflikte mit ihr bringen könnten. Damit einher ging die Herausbildung unserer Außenseite, auch persona genannt. Sie ist das Gesicht, mit dem wir uns der Welt präsentieren, vergleichbar der Maske, die die römischen Schauspieler vor sich hertrugen.
In der Regel verbinden wir mit Schatten zunächst etwas Negatives. Dass unser Schatten nicht nur aus moralischen verwerflichen Tendenzen besteht, sondern eine Reihe guter Qualitäten aufweist, ja 90 Prozent von ihm, wie C. G. Jung einmal gesagt haben soll, schieres Gold ist, wird manchem daher zunächst suspekt erscheinen. Ja, so manches, das in den Schatten gestellt wurde, beinhaltet vitale Aspekte unseres Seins, auf die wir nicht verzichten können, wollen wir, dass unser Leben spannend, bunt, wertvoll bleibt oder ganz wird. Nicht selten haben wir unsere Originalität an den Schatten abgegeben.
Wollen wir ganz der Mensch werden, der wir werden sollen, wollen wir ein Leben in Fülle leben, wollen wir, dass unser Leben lebendig, leidenschaftlich, spannend, bunt bleibt oder wieder wird, müssen wir die Seiten von uns, die im Dunkeln sind, die ein Schattendasein führen, ans Licht bringen, in unser Leben bringen, jedenfalls die Aspekte davon, die sich bei näherem Hinsehen als Gold im Schatten und als Kraftquellen erweisen.
Das kann in gleicher Weise von der Kirche gesagt werden. Will sie wirklich der Ort sein, an dem und von dem aus Leben in Fülle und Lebendigkeit gefördert wird, Heuchelei, Unwahrhaftigkeit, Lieblosigkeit, altes und abgestandenes Denken, das den Geist der Unerlöstheit und Unfreiheit atmet, dagegen verbannt, muss sie den Blick auf ihre dunkle Seite aushalten. Dann und erst dann und nicht, solange sie nur die Zuckerseite von sich zeigt, die man ihr längst nicht mehr abkauft, wird auch sie ganz.
Das aber setzt voraus, sich des Schattens, den man wie einen dunklen Schlauch hinter sich herzieht, bewusst zu werden und ihn als einen wichtigen Teil von sich anzuerkennen und anzunehmen. Das gilt auch für die Aspekte des Schattens, die anzunehmen einem schwerfällt. Wer will sich schon zugestehen, wenn er glaubt, ein anständiger und vielleicht sogar frommer Mensch zu sein, dass er auch Neid, Ärger, Hassgefühle, Ehrgeiz kennt? Welche caritative oder kirchliche Einrichtung mag schon gerne hören, dass es vielleicht nicht nur edle Motive sind, die sie zu ihren Aktionen verleiten, sondern auch Prestigedenken, persönliche Vorteile und vieles mehr dabei eine Rolle spielen können.
In seinem Roman Konklave deckt der Bestsellerautor Robert Harris die Schattenseite der Mitglieder des Konklave auf, die sich in der Sixtinischen Kapelle versammelt haben, um den neuen Papst zu wählen. Von ihnen heißt es, dass sie alle heilige Männer seien, aber jeder auch von irdischem Ehrgeiz getrieben sei. Da ist manches überzogen, doch es ist der Wahrheit näher als so manche Darstellungen der Kardinäle, die in großer Demut und ohne irgendwelche eigenen Interessen zu verfolgen das Ganze dem Heiligen Geist überlassen. Da wird vieles verspiritualisiert, vernebelt, auch banalisiert. Das ist ein Beispiel dafür, wie unehrlich man sich verhält, wie Seiten von einem, die es gibt, einfach anscheinend keine Rolle spielen, die sich dann aber natürlich doch, jetzt aber auf eine subtile Weise, Ausdruck verschaffen.
Die lebenslange Auseinandersetzung mit dem Schatten
Der Schatten holt uns ein, erinnert uns an unsere Menschlichkeit. Er verhindert, dass wir wie schattenlose Geistwesen, die so tun, als verfügen sie nicht auch über einen Körper, durch die Welt ziehen. Auch das, was ich vielleicht als minderwertig oder verwerflich erachte, gehört zu mir, „gibt mir Wesenheit und Körper“ (C. G. Jung). Es ist mein Schatten. „Wie kann ich wesenhaft sein, ohne einen Schatten zu werfen?“, fragt C. G. Jung (GW16, § 134), um dann festzustellen: „Auch das Dunkle gehört zu meiner Ganzheit, und indem ich mir meines Schattens bewusst werde, erlange ich auch die Erinnerung wieder, dass ich ein Mensch bin wie alle anderen.“
Das macht uns demütig und ist zugleich befreiend. Wir werfen uns, so C. G. Jung, der Menschheit wieder in die Arme, befreien uns von der Last des moralischen Exils, in das wir uns begeben haben. Dabei ist es wichtig, dass wir nicht nur intellektuell feststellen, einen Schatten zu haben, sondern von unserem Herzen her dazu stehen und uns dazu bekennen, weil erst dann die ersehnte innere Befreiung stattfinden kann. C. G. Jung (2001,43 f.) weiß, wie schwer uns das zunächst fällt. Er verdeutlicht das anhand von zwei Personen und ihren Träumen:
„Der eine träumte von einem betrunkenen Vagabunden, der im Straßengraben lag, der andere von einer betrunkenen Prostituierten, die sich in der Gosse wälzte. Ersterer war ein Theologe, letztere eine distinguierte Dame der großen Gesellschaft, beide empört und entsetzt und durchaus nicht gewillt zuzugeben, dass man von und aus sich selber träume. Ich gab beiden den wohlwollenden Rat, sich ein Stündchen Selbstbesinnung zu gönnen und fleißig und mit Andacht zu betrachten, wo und inwiefern sie beide nicht viel besser seien als der betrunkene Bruder im Straßengraben und die Schwester Prostituierte in der Gosse. Mit einem solchen Kanonenschuss beginnt oft der subtile Prozess der Selbsterkenntnis. Der ‚andere‘, von dem wir träumen, ist nicht unser Freund und Nachbar, sondern der andere in uns, von dem wir vorzugsweise sagen: ‚Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser da.‘ Gewiss hat der Traum, dieses Naturkind, keine moralische Absicht, es stellt bloß das allgemeine Gesetz dar, nach welchem keine Bäume in den Himmel wachsen.“
Das ist in der Tat eine schwere Kost, die man erst einmal verdauen muss. Sich vorzustellen, dass das, was man in den anderen oft verachtet, auch bei mir vorhanden ist, der anscheinend heiligmäßig lebenden Person, als die ich mich selbst sehe oder die andere in mir sehen, dass dieser eine andere, ganz und gar nicht heiligmäßige Person gegenübersteht, die nicht weniger zu mir gehört, sosehr ich auch versuche, sie mir vom Hals zu halten. Es gibt viele Beispiele von Personen, die als Bischöfe oder etwa in den USA als bekannte Fernsehprediger nach außen hin eine Aura des besonders spirituellen Menschen umgibt, die aber, wenn man genauer hinschaut oder wenn sie selbst zu Opfern ihres Schattens geworden sind, sich als ausgesprochen rücksichtslos, selbstbezogen entpuppen.
Will ich aber verantwortlich mit dieser Seite von mir umgehen können, muss ich dazu stehen, dass sie auch zu mir gehören. Sie annehmen heißt nicht, dass ich ihr Zulassen, ihr Ausagieren in bestimmten Situationen gutheiße. Sie anzunehmen ermöglicht mir, besser mit ihnen umgehen, sie steuern und gestalten zu können. Zunächst aber muss ich mich mit dem, was ich in den Schatten ausgelagert habe, auseinandersetzen. Dabei mag ich feststellen, dass nach außen hin mein Verhalten mit Begriffen wie Hingabe, Frömmigkeit, Liebe bezeichnet werden könnte, während der nicht sichtbare Teil von mir recht gut mit Worten wie Geltungsdrang, Eitelkeit, Verschwendung, Habsucht, Leere, Machtgier usw. beschrieben werden könnte.
Wenn unsere Schattenseite zur Homilie wird
Damit wir nicht zu Opfern unserer Schattenseite werden, müssen wir uns mit ihr auseinandersetzen. Erst in den Momenten, in denen wir ihr von Gesicht zu Gesicht begegnen, werden sie zu Homilien, die uns sagen, wie wir uns anderen und uns selbst gegenüber verhalten sollen, so der Tiefenpsychologe James Hillmann. Ich kann sie nicht allein durch Aufforderung oder Moralisieren vertreiben. Auch wenn ich lieber nichts mit ihr zu tun haben möchte, gehört sie zu mir. Ich predige zum Beispiel Demut und ich predige etwas zu laut darüber, weil ich sehr wohl die Seite an mir kenne, die sich gerne im Mittelpunkt sieht. Und Nietzsche dürfte richtig liegen, wenn er meint, dass jene, die sich selbst erniedrigen, gerne erhöht werden möchten. Oder ich hasse mich dafür und mache mich ständig herunter, weil ich, obwohl ich versprochen habe, auf das Ausleben meiner Sexualität zu verzichten, diese Seite nicht in den Griff bekomme.
Der andere Weg wäre, dazu zu stehen, dass ich auch ehrgeizig bin, es auch eine narzisstische Seite in mir gibt, die auf ihre Kosten kommen will und in Maßen auch darf. Das gilt auch für meine Sexualität und mein sexuelles Verlangen und Verhalten. Ich muss meinen Frieden damit finden. Ich muss hinhören, was mein sexuelles Verlangen mir sagen will, wie ich es in mein Leben integrieren kann. In dem Wort integrieren steckt das Wort integer. Wenn ich zum Beispiel meine Sexualität nicht von mir abspalte, wenn ich mein sexuelles Verhalten – auch da, wo es der gesellschaftlichen oder kirchlichen Norm nicht entspricht – nicht einfach nur verteufle, also schlechtmache, sondern dazu stehe, mir das Almosen der Güte mir selbst gegenüber nicht versage, um eine Formulierung von C. G. Jung zu gebrauchen, findet – wie es bei einem alchemistischen Vorgang der Fall ist – eine Verwandlung in mir statt. Jetzt vermischen sich die unterschiedlichen Seiten und Strebungen in mir, jetzt hat das Schwarz-Weiß-Denken ein Ende, so dass Neues entstehen kann. Ich muss mich mit dem Schatten nicht identifizieren. Auch muss ich ihn nicht ausagieren. Aber meinen Schatten und wofür er steht zu lieben, heißt, mit ihm Frieden zu schließen, ihn mitzutragen und zu ertragen. Die Annahme unserer Wirklichkeit ist wahre Demut. Die Sorge um den Schatten ist die Voraussetzung dafür, ihn zu heilen.
Was kann die Kirche, was können ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch viele Gläubige, daraus lernen? Auf dem Hintergrund meiner Erfahrungen im Recollectio-Haus, meiner vielen Begegnungen mit kirchlichen Mitarbeitern, meiner eigenen Erfahrungen als kirchlicher Mitarbeiter und aktives Mitglied meiner Kirche kann ich nur dafür plädieren, sich intensiver und ehrlicher mit unserer Schattenseite auseinanderzusetzen. Zum einen, um uns dadurch besser kennenzulernen, die ganze Wahrheit über uns zu erfahren und dadurch auch in die Lage versetzt zu werden, bewusster und verantwortlicher mit Seiten von uns umgehen zu können, die vielleicht nicht so schmeichelhaft sind. Zum anderen, um das Positive, das Gold, das sich dort befindet, zu entdecken und zum Segen der Kirche, ihrer Mitarbeiter und der Gläubigen zu nutzen.
![]()
8. Kapitel
Transparent sein
Die Kirche hat eine Vorbildfunktion
Beginnen wir bei der Kirche als Institution. Die Kirche muss beziehungsweise will von ihrem moralischen und spirituellen Anspruch her so etwas wie ein Vorbild sein. Sie hat sich mehr, als das für andere Organisationen gilt, Idealen und Werten verschrieben und es ist verständlich, dass die Außenwelt mehr als bei anderen darauf schaut, ob sie diesen Idealen auch entspricht und gerecht und kritisch reagiert, wenn das nicht der Fall ist. Das haben wir beim Missbrauchsskandal erlebt, bei dem die Kirche ihr Kapital, als glaubwürdig und vertrauenswürdig eingeschätzt zu werden, verspielte. Von diesem Vertrauensverlust hat sie sich bis heute nicht erholt.
Ein anderer Bereich, bei dem die Kirche immer wieder in Kritik gerät, bezieht sich auf das Finanzgebaren der Kirche und wie in der Kirche mit Macht umgegangen wird. Grundsätzlich muss es nicht schlecht sein, dass die Kirche reich ist. Auch ist es eine Tatsache, dass es in einer Institution unterschiedliche Verantwortungsebenen gibt. Entscheidend ist, was die Kirche mit dem Geld macht, wofür sie es ausgibt. Ob sie das transparent macht. Oder dass man, wenn es um Einfluss und Macht geht, nicht so tut, als gäbe es das in der Kirche nicht, und jene, die tatsächlich Macht in der Kirche haben und diese auch ausüben, sich nicht selbst und anderen vormachen, dass ihr Amt nur Dienst sei, sie selbst aber nicht mehr als die Diener ihrer Gemeinschaft, und das noch auf die Spitze treiben, wenn sie sich im liturgischen Kontext als nichtswürdige Knechte bezeichnen.
Organisierte Nächstenliebe
Die Kirche finanziert in Deutschland und weltweit Projekte, bei denen Menschen – Arme, Flüchtlinge, Kranke, Hungernde – unterstützt werden, die dringend der Hilfe bedürfen. Das machen auch andere Organisationen, aber es ist auch eine elementare Aufgabe von Kirche. Sosehr Nächstenliebe und Barmherzigkeit immer wieder spontan und unmittelbar gelebt werden können und sollen, müssen sie auch organisiert werden, um wirkungsvoll helfen zu können. Es bedarf dazu Einrichtungen, Bewegungen, die etwas auf den Weg bringen. Man denke an manche Orden, die es als ihre Aufgabe sehen, genau das zu tun. Dafür braucht es Menschen, eine Organisation und natürlich auch Geld.
Man darf also auch kein falsches Verhältnis zum Geld haben, indem man das Geld von vorneherein zum bösen Mammon erklärt, sich dann aber wundert und darüber klagt, wenn man nicht genug hat und von der Unterstützung anderer abhängig ist, obwohl man bei einiger Phantasie selbst etwas dazu hätte beitragen können, zu mehr Geld zu kommen.
Richtiger Umgang mit Geld
Die andere Seite ist, wachsam zu sein und gut hinzuschauen, was Geld mit mir macht, welche Faszination es auf mich ausübt und inwieweit ich, wenn ich darüber verfügen kann – auch über Geld, das nicht mir gehört –, davor gefeit bin, diese Situation nicht doch auch zu meinem Vorteil zu nutzen. Ich mit der Zeit gar nicht mehr merke, wie ich meine Stellung da...