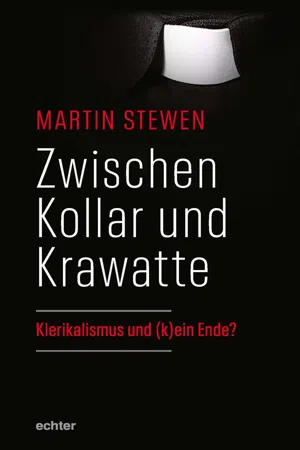![]()
1. Klerikalismus – Wie das Amen in der Kirche
Die Kirchenführer sind häufig Narzissten gewesen. Sie waren geschmeichelt und in schlechter Weise freudig erregt über ihre Höflinge. Der Hof ist die Lepra des Pontifikats. […]
Der Klerikalismus dürfte mit dem Christentum nichts zu tun haben.4
Im Interview mit Eugenio Scalfari, dem atheistischen Herausgeber der linken italienischen Zeitung „La Repubblica“, findet Papst Franziskus deutliche Worte. Der kräftige Ausdruck, den der Papst verwendet, erinnert an die Geschichte von der Heilung des Aussätzigen. Aussatz war ein großes Dilemma in der antiken Gesellschaft und hatte bekanntlich unmittelbaren sozialen und wirtschaftlichen Ruin zufolge. In genau diesen Kontext stellt nun der Papst den päpstlichen Hof. Wenn der Papst meint, der Hof sei die Lepra des Pontifikates, dann ist das nicht nur die Situationsbeschreibung eines Untergangs, sondern auch die Analyse einer historischen Entwicklung, eines Weges. Und ein tonnenschwerer Vorwurf gegen seine Vorgänger wie Papst Benedikt XVI. oder Papst Johannes Paul II. Lepra hat einen Infektionsherd, eine Inkubationszeit und ein Ausbreitungsgebiet, wogegen man sich schützen kann oder nicht. Höfischer Klerikalismus auch.
Die Situation des Klerikalismus, die heute in der Kirche vorherrscht, ist nicht vom Himmel gefallen. Klerikalismus hat sich eingenistet und hat sich ausgebreitet. Und weil ihn niemand bekämpfen wollte, ist diese Ausbreitung sehr nachhaltig vorangeschritten. Es ist wie bei der Lepra: Die Patienten konnten sich nicht gegenseitig helfen und Ärzte trauten sich nicht ins Infektionsgebiet oder waren relativ bald ebenfalls infiziert. Schon lange ist die narzisstische Haltung von Kirchenführern kein Problem mehr, das es allein im Vatikan zu lösen gilt. Klerikalismus ist eine systemimmanente Erscheinung des katholischen Kirchensystems. Und genau jene, die von diesem ‚Aussatz‘ befallen sein könnten, wollen und müssen ihn heilen. – Wie soll das gehen?
1.
In Deutschland mag man sich noch an die Affäre rund um den ehemaligen Limburger Bischof Franz-Peter Tebartzvan Elst erinnern. Dieser hatte 2012 zum einen öffentlich einen First-Class-Flug zur Visitation eines Dritt-Welt-Projektes im indischen Bangalore geleugnet und zum anderen seine Residenz in Limburg mit dem Mehrfachen eines veranschlagten Betrages luxuriös ausgebaut. Die Liste der Unanständigkeiten in dieser Affäre war lang. Wichtig und bemerkenswert bleibt aber, dass dem Bischof keinerlei juristisches Fehlverhalten bescheinigt wurde. Und dennoch blieb am Ende nur sein Rücktritt. Bleibt die Frage: Wo war der Skandal? – Wenn man sich diese Affäre genauer ansieht, dann sind es nicht zuerst die Fakten, die so aufregen. An denen kann man sich wohl abarbeiten, aber das ist auch ein wenig heuchlerisch. Denn: Auch andere Bischöfe sind schon First Class geflogen und zur gleichen Zeit des Umbaus des Limburger Bischofshauses hat die Erzdiözese München und Freising ihr Ordinariat für 130 Millionen Euro renoviert, was nahezu ohne jegliche Nebengeräusche in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Magnus Lux vom bayrischen Zweig der Initiative „Wir sind Kirche“ hat den Vergleich von München und Limburg kommentiert:
Das ist ein gewaltiger Unterschied. Das eine ist ein Verwaltungsgebäude, das andere mehr oder weniger ein Privatgebäude.5
Was hat Bischof Tebartz-van Elst im Vergleich zu Erzbischof Marx so grundlegend falsch gemacht? Es ist sicher zum einen die Weise, mit der er sein Bischofsamt benutzt hat, um offensichtlich persönliche Vorteile zu erwirken. In einer angespannten Bistumssituation hat der Bischof sein Amt ausgeübt zum eigenen Nutzen. Dabei sind es eben nicht die Fakten selbst, die den Skandal kreiert haben, es sind die Verhältnisse, in denen es passiert ist. Dass ein Vertreter der Nachfolgegemeinschaft Jesu, dem persönliche Bereicherung völlig abging, in luxuriösen Verhältnissen zu den Armen fliegt, das stinkt. Dass der Nachfolger von Bischof Franz Kamphaus, dessen bischöflicher Wahlspruch ist: „den Armen das Evangelium verkünden“, der das Bischofshaus zeitweilig einer eritreischen Flüchtlingsfamilie überließ und stattdessen in einem Apartment im Priesterseminar wohnte, nun als das absolute Gegenteil des über die Bistumsgrenzen hinaus beliebten Altbischofs auftrat, war bis ins Letzte fahrlässig. Es ging in der Affäre Tebartz-van Elst in keiner Weise um eine theologische Diskussion hinsichtlich des Bischofsamtes, es ging ausschließlich um ein – gelinde formuliert – situativ höchst unangebrachtes Verhalten eines prominenten Kirchenvertreters. Während der Limburger Altbischof zur Begeisterung des Kirchenvolkes pure Bescheidenheit lebt, tat sein Nachfolger das genaue Gegenteil. Das mangelnde Einfühlungsvermögen, das der fehlbare Bischof in einer angespannten Bistumssituation an den Tag gelegt hat, grenzt schon fast ans Groteske. Als von Seiten der römischen Bischofskongregation Kardinal Giovanni Lajolo die Situation in Limburg in Augenschein nahm, bemerkte er im Anschluss:
In meinen Gesprächen konnte ich feststellen, dass die Spannungen latent schon über Jahrzehnte existieren und jetzt offen zutage treten.6
Statt Empathie und Hirtenverhalten hat Tebartz-van Elst in seiner Amtsführung genau jenen Narzissmus an den Tag gelegt, den Papst Franziskus im La-Repubblica-Interview wenige Tage nach der Visite Kardinal Lajolos in Limburg bemängelte. Hier liegt das Problem der Affäre Limburg, nicht in einem 40 Millionen Euro teuren Bischofspalais.
2.
Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang, dass nicht überall der Aufschrei gegen den Limburger Bischof gleich groß war. Nicht jeder nahm das Verhalten des Kirchenoberen mit gleicher Empörung wahr. Viele scherte in keiner Weise, dass der Bischof die Spannungen im Bistum mit seinen Bauplänen und Reiseansinnen verstärkte. So hat etwa das „Forum deutscher Katholiken“ mit gut 4000 Unterschriften das Pontifikat des umstrittenen Limburger Bischofs unterstützt. Da fragt man sich als Zuschauer nur verwundert: Was ist da los? Was finden diese Leute so unterstützungswürdig am Umgang des Bischofs mit der Wahrheit oder an seinem zweifelhaften Umgang mit Kirchensteuern und Stiftungsgeldern?
Wer so fragt, hat übersehen, dass Fakten eben nur einen Teil einer kirchlichen Skandal-Partitur darstellen. Da wäre eben immer auch noch die schon erwähnte Stimmung. Zur Genüge gab es immer wieder die Stimmen jener, die sich nachhaltig an der Aura des Klerikalen festbissen und gar nicht wieder loskamen. Die zugunsten einer „klerikalen Würde“ jenseits alles Rationalen jedes Missverhalten und jegliches Unrecht übersahen, guthießen oder schönredeten. Selbst wenn diese „klerikale Würde“ schon längst in Grund und Boden ruiniert war. Man mag solche Menschen nehmen und schütteln und ihnen zurufen: Mach die Augen auf und schau hin! Aber das nutzt nichts, nicht in Limburg, nirgends auf der Welt: Der Blick ist verstellt, getrübt. Alles Klerikale wird von Grund auf an sich bereits als jene Falten- und Fleckenlosigkeit angesehen, die die Kirche anstreben soll:
So will er die Kirche herrlich vor sich hinstellen, ohne Flecken oder Falten oder andere Fehler; heilig soll sie sein und makellos (Epheser 5,27).
Der Klerus ist aber davon weit entfernt. Das sollte auch in der eigenen Reflexion von Klerikern immer wieder ins Bewusstsein kommen. Passiert das nicht, sind dem Klerikalismus Türen und Tore geöffnet. Aber auch Nichtgeweihte sollten sich dessen bewusst sein, wenn sie mit Klerikern zu tun haben. Doch das funktioniert oft nicht. Und auch das bereitet einer anderen Art von Klerikalismus den Weg, jenem Klerikalismus der Laien, ohne den der Klerikalismus der Kleriker gar nicht überlebensfähig wäre.
3.
Schauen wir nun mal genauer hin und wenden wir uns der Frage zu, die sich vielleicht einfach aus dem Bauch heraus beantworten lässt, deren Antwort aber doch in einer so schwierigen Diskussion auf einem möglichst soliden Fundament stehen sollte: Was ist eigentlich Klerikalismus?
Wenn Pfarreiangehörigen der Priester nicht passt, weil er eine ungemütliche Entscheidung getroffen hat oder die Predigt merkwürdig war, heißt es oft: „Der ist aber konservativ – oder eben: klerikalistisch“. Klerikalistische Kleriker sind halt einfach Kleriker, die ich nicht mag. Die mir mit ihrer Amtsführung querliegen. Und auf der anderen Seite findet man: Ein Kleriker, den ich mag, dem ich anhänge, der kann einfach nicht klerikalistisch sein. – So geht das nicht. Weder Klerophilie noch Klerophobie sollte unsere Beziehungen zu Klerikern ausmachen, sondern ein ganz normaler zwischenmenschlicher Umgang. Aber was ist dann Klerikalismus?
Klerikalismus meint ein hierarchisch-autoritäres System, das auf Seiten des Priesters zu einer Haltung führen kann, nicht geweihte Personen in Interaktionen zu dominieren, weil er qua Amt und Weihe eine übergeordnete Position innehat.7
So klingt es in der Studie zum sexuellen Kindesmissbrauch, die von der Deutschen Bischofskonferenz 2018 in Auftrag gegeben wurde. Das mag ein wenig irritieren. Wenn wir von einem System sprechen, dann meint das eigentlich eine Gesamtheit von Elementen, die miteinander verbunden sind und deren Existenz einander bedingen. Soll heißen: Ein Kleriker kann gar nicht anders als klerikalistisch sein, weil andere Umstände ihn dazu drängen. Also: Nicht der Kleriker ist schuld, sondern das, was sein Verhalten bedingt. Wer will denn das glauben: der Kleriker als Produkt eines Systems? – Wer restaurativ Klerikalismus schützen will, argumentiert systemisch. Eine systemische Sichtweise verhindert nämlich letztendlich individuelle Verantwortung.
Die MHG-Studie befindet sich mit diesem Ansatz übrigens in prominentem Kontext. Am 11. April 2019 veröffentlichte die Website CNA.Deutsch unter dem Titel „Benedikt im Wortlaut: Die Kirche und der Skandal des sexuellen Missbrauchs“ eine Stellungnahme des emeritierten Papstes Benedikt XVI. zum Treffen der Vorsitzenden der Bischofskonferenzen sowie anderer hochrangiger Verantwortlicher der Kirche zum Thema „Sexueller Kindesmissbrauch in der Kirche“ in Rom im Februar 2019. Dieser reflektiert darin, wie es dazu kommen konnte, dass Priester ihre Rolle missbrauchen und sich an Kindern vergehen konnten. Benedikt XVI. schreibt über die Ursachen der Krise:
Die Sache beginnt mit der vom Staat verordneten und getragenen Einführung der Kinder und der Jugend in das Wesen der Sexualität. […]
Zu den Freiheiten, die die Revolution von 1968 erkämpfen wollte, gehörte auch diese völlige sexuelle Freiheit, die keine Normen mehr zuließ.8
Daneben konstatiert er einen Zusammenbruch der Moraltheologie, der schließlich, so der emeritierte Papst und einstige oberste Glaubenshüter, darin gipfelte, dass „hier das Wesen des Christentums selbst auf dem Spiel steht“. Schließlich resümiert er:
Wieso konnte Pädophilie ein solches Ausmaß erreichen? Im letzten liegt der Grund in der Abwesenheit Gottes. Auch wir Christen und Priester reden lieber nicht von Gott, weil diese Rede nicht praktisch zu sein scheint.9
Wer in den Ausführungen des emeritierten Papstes über die Situation des sexuellen Kindesmissbrauchs in der Kirche ein Wort zur Verantwortung der Täter sucht, der sucht vergebens. Kleriker sind zu Missbrauchstätern geworden, weil Gesellschaft und Theologie sie dazu haben werden lassen. Der Freiburger Fundamentaltheologe Magnus Striet wertet das Schreiben Benedikts als Blockade im Aufarbeitungsprozess:
Die Missbrauchsproblematik wird die katholische Kirche noch lange beschäftigen, über missbrauchsbegünstigende theologische Denkfiguren ist noch viel zu wenig gearbeitet worden. Der Text von Benedikt XVI. bietet ein Lehrstück dafür, dass eine bestimmte Theologie die Probleme überhaupt nicht angemessen in den Blick bekommen kann. Die Gründe werden an die böse Welt oder an den Teufel externalisiert.10
Nein, niemand, der in der Kirche agiert, kann seine Verantwortung an ein System delegieren. Kindesmissbrauch ist ein Verbrechen, das ein Täter bewusst und vorsätzlich begangen hat. Auch klerikalistische Verhaltensweisen sind nicht das Ergebnis eines Kirchensystems. Vielmehr ist das Gegenteil doch der Fall: Das System Kirche mit seinem systemimmanenten Klerikalismus ist Produkt der Kleriker. Und vieler Nichtgeweihter – dazu später. Klerikalismus ist eine Verhaltensweise, zu der sich der Kleriker entschieden hat – er könnte auch anders. Wenn er sich nicht für eine klerikalistische Verhaltensweise entschieden hat, hat er sich zumindest nicht dagegen entschieden. Nicht das System macht doch den Menschen, sondern der Mensch kreiert das System. Es kann sicher eine Wechselwirkung nicht geleugnet werden. Wenn ich in einem System bin, in dem ich mich zu einer völlig anderen als der dominanten Verhaltensweise entscheide, kostet das Kraft. Es ist einfacher, sich so zu verhalten wie die Mehrheit. Das ist fraglos. Aber dennoch ist Klerikalismus eine Verhaltensweise, der zumindest keine Entscheidung dagegen vorausgegangen ist. Die systemische Definition von Klerikalismus führt am Ende in die Viktimisierungsfalle: Aufgrund des Systems können wir Ärmsten – die Priester – gar nicht anders als klerikalistisch sein. Der klerikalistische Kleriker als Opfer des Systems?
Noch einmal: Das kann doch nicht sein! Es ist gut und beruhigend, dass die Reaktionen auf das Schreiben Papst Benedikts massiv ausfielen. An vielerlei Stellen wurde dem emeritierten Oberhirten eine falsche Sicht vorgeworfen und damit deutlich gemacht, dass der Paradigmenwechsel eingeleitet ist. Nicht Systeme, nicht historische Umstände oder theologische Sichtweisen sind Verantwortungsträger in der Kirche. Vielmehr sind es die Menschen. Eine individuumszentrierte Sichtweise hat Einzug gehalten auch in den Spitzen der kirchlichen Hierarchie. Aber eben dort auch nur an einzelnen Stellen und das ist wiederum das Beunruhigende. Ein Papst allein wendet noch kein ganzes Kirchenschiff und an die Zeit nach diesem Papst will man lieber noch gar nicht denken. Der Paradigmenwechsel ist eingeleitet, aber noch lange nicht vollzogen. Es gibt keinen Anlass zu überschwänglichem Optimismus.
4.
Doch schauen wir zunächst einmal auf weitere Ansätze, wie man Klerikalismus beschreiben kann. Der Grazer Pastoraltheologe Rainer Bucher definiert Klerikalismus viel treffender als individuelle Verhaltensweise so:
Klerikalismus wird üblicherweise als Grenzüberschreitung des Klerus in weltliche, vorwiegend politische Handlungsfelder definiert. Der Klerikalismus startet historisch in der Spätantike als kirchlicher Herrschaftsanspruch über die Gesellschaft, wurde […] in der Neuzeit zu einem Führungsanspruch über das Leben der Laien, und wird heute […] zu einer mehr oder weniger fatalen Identitätstechnik von Priestern.11
Der Kleriker ist der klerikalistische Akteur. Aber auch hier fällt eines auf: Die klerikalistische Bewegung geht gemäß Buchers Definition allein vom Priester aus. Der klerikalistische Priester ist es, der seines „Schusters Leisten“ verlässt – oder vielmehr seinen Altarraum – und politisch oder gesellschaftlich oder in zwischenmenschlicher Beziehung in einer Weise aktiv wird, die dem nicht geweihten Volk Gottes die Freiheit nimmt. Der Priester ist es, der sich den Herrschaftsanspruch über das Leben der Laien anmaßt. Und er ist es, der mittels einer klerikalistischen Verhaltensweise seine Identität in Abgrenzung zu Nichtgeweihten sichert.
All das stimmt ganz sicher. Aber nur zur Hälfte. Denn es braucht zum Erfolg eines solchen Verhaltens auch immer die – wie auch immer geartete – andere Seite, die diese Herrschaft anerkennt und legitimiert. Es braucht den sozialen Kontext, der sich dem Herrschaftsanspruch des Klerikers nicht entzieht. Wie eine Medaille zwei ...