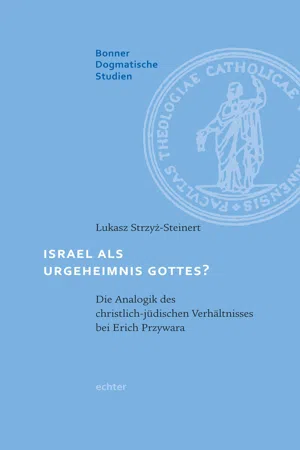![]()
1. Erich Przywara – der Denker und seine Welt1
Die Welt, in der Erich Przywara lebte, wirkte und dachte, war eine Welt der Brüche und Gegensätze. Der Grundimpetus von Przywaras Denken ist die Suche nach dem Einen, in dem das Vielfältige und Widersprüchliche begründet ist. Dieser Einheitsgrund ist das rechte Verhältnis, in dem alles zueinander steht. Da Erich Przywaras philosophisch-theologisches Werk und seine Existenz „wie kaum bei einem zweiten Theologen“1 seiner Epoche zusammengehören, ist auch seine Beschäftigung mit dem Jüdischen und dem christlich-jüdischen Verhältnis ohne die enge Verschlingung mit seiner Zeit und Umwelt, wie auch ohne Przywaras eigenwilliger Persönlichkeit, nicht zu verstehen. Die symbolischen Orte, die für Erich Przywaras Welt und seine eigene existenzielle Verortung stehen, sowie die Koordinaten seines Denkens seien nun skizziert.
1.1 Welt der Brüche und Gegensätze
1.1.1 Gegensätzliche Geburtserde
Dem oberschlesischen Industriebezirk, in dem „alle Gegensätze sich schnitten“2, verdankte Erich Przywara seine erste und damit für die weitere Entwicklung grundlegende Formung. Am 12. Oktober 1889 in Kattowitz geboren, wurde Przywara von Kindesbeinen an mit einer Stadt konfrontiert, die symptomatisch für die Gegensätze und Widersprüche seiner Epoche stehen kann. Im Zuge der rasanten Industrialisierung Oberschlesiens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stieg Kattowitz binnen weniger Jahrzehnte vom Dorf zum Zentrum des oberschlesischen Industriebezirks auf. Es war keine organisch gewachsene Einheit, sondern eine im Geist des Positivismus künstlich angelegte Stadt. „Es war darum eigentlich nicht ‚Erde‘, sondern Kohlen-Halden-Boden“, auf dem ein kalt nüchterner „Realismus von Grube, Fabrik, Handelskontor“ 3 herrschten. Den Geist dieser Entwicklung bekam Erich Przywara aus nächster Nähe zu spüren, da der Alltag in seinem Elternhaus dem Geschäft des Vaters, eines begabten und leidenschaftlichen Kaufmanns, gänzlich untergeordnet4 und somit durch „das rechnerisch Nüchterne der Atmosphäre von Kattowitz“5 zutiefst geprägt wurde.
Umgeben wurde diese Stätte eines entzauberten Realismus und harter Arbeitsbedingungen von tiefen, vom großen schlesischen Romantiker Joseph von Eichendorff besungenen, Wäldern, in derer unendlichen Weite Przywara aufatmen und eine ganz andere Welt erleben konnte: „Unendlichkeit, Wildnis, Zauber, Nacht“6. Das ist also der erste Gegensatz, dem Przywara ins Gesicht schaut: „So stark das Abgründig-Nächtige echter Romantik im Oberschlesien der Wälder lebt, ebenso stark wirkt ein schroffer rationalistisch nüchterner Technizismus im Oberschlesien der Hütten und Gruben“7. In Przywaras Welt stehen sich die Gegensätze in ihrer reinen Form gegenüber und es fehlt zwischen ihnen an einer vermittelnden und abmildernden Instanz.
Es ist eine unruhige Welt. Der rasante Fortschritt machte das bis hinein ins 19. Jahrhundert industriell zurück gebliebene Deutschland binnen einiger Jahrzehnte zu einer der führenden kapitalistischen Weltwirtschaften. Wie G. Aly beschreibt, verlief dieser Prozess jedoch „in immer rasanteren, den meisten Deutschen zu harten, zu schnellen Rhythmen“8, was sich in sozialen, tief in das Bevölkerungsgewebe und kollektive Bewusstsein reichenden Verunsicherungen und Spannungen auswirkte. Die Modernisierungsschübe überschlugen sich mit ökonomischen und politischen Krisen, denen sich viele Menschen wehrlos ausgeliefert fühlten.
Przywara ist Kind seiner Zeit, deren Grundgefühl im Existenzialismus ihren Ausdruck fand. Alles ist im Fluss, der Mensch bebt von Unruhe. Hoffnung und Angst, Fortschrittsenthusiasmus und Resignation geben sich die Klinke. Das Sein überhaupt wird durch seine Nichtidentität, nicht durch Seinsgewissheit, definiert. Die beruhigten, statischen Strukturen des anthropozentrischen Idealismus entlarvten sich spätestens im Zuge des I. Weltkriegs als nicht tragfähig. Die Unruhe ist das Welterlebnis, von der her Przywara das Ganze betrachtet. Er nimmt sie ernst und diskreditiert sie nicht, als ob sie nur eine Art Störung wäre. Die Unruhe ist bedrohlich, aber sie offenbart etwas Wesentliches.
Johann Wolfgang Goethe, der Schlesien 1790 bereiste, nannte es ein „zehnfach interessante[s] Land“ und „Brückenlandschaft“ zwischen West- und Osteuropa9. Przywaras Familienhaus illustriert diese Begegnung und das Miteinander, da sein Vater aus einer polnischen Bauernfamilie, seine Mutter hingegen aus einer deutschen Beamtenfamilie aus Neiße stammte. Der Oberschlesier, schreibt Przywara, „spürt immer gleichzeitig die Gegenseite im eigenen Blut“10, was ihn vor Einseitigkeit hütet, und zur „Brücke“ werden lässt, vorausgesetzt „er erkennt und anerkennt seine Aufgabe“11. Die Suche nach der Geisteseinheit zwischen Ost und West begleitet ihn lebenslang als die Herausforderung der Gegenwart schlechthin und wird ihm zur Chiffre der Einheit vor allem im Kontext seiner Begegnung mit dem Judentum.
Auch hier handelt es sich aber nicht um ein harmonisches Miteinander der Ethnien und Kulturen, sondern um einen angespannten Gegensatz. Als Przywara in Kattowitz aufwächst, liegt die Stadt in der Nähe des ‚Dreikaiserecks‘, zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn und Rußland. Die drei aneinandergrenzenden Kaiserreiche schließen sich auf dem Wiener Kongress in der ‚Heiligen Allianz‘ als Garanten „eines einzigen Abendlandes“ zusammen, um „hierdurch sowohl die Gefahr aus Asien wie die Gefahr aus dem Westen bannen zu können“12. Diese politische Ordnung auf der Basis monarchischer Legalität hat Mitteleuropa für ca. 100 Jahre relativen Frieden beschert, was jedoch auf Kosten national-staatlicher und demokratischer Bestrebungen erfolgte. Nun brechen die nationalen und ideologischen Gegensätze umso heftiger auf.
Wenige Jahre danach, als Przywara seine Heimatstadt verlassen hat, zerbricht diese Allianz endgültig. Nach dem I. Weltkrieg wurde Oberschlesien geteilt und Kattowitz dem wiedergegründeten polnischen Staat zugeschlagen. So traten auch viele nationale Anfeindungen zu Tage. In dieser Periode besuchte Przywara seine Heimatstadt, um 1920 seine Primizmesse zu feiern und einen Vortrag für den dortigen Männerverein zu halten. In einem handschriftlich gefertigten Verzeichnis aller seiner Vorträge bis 1938 steht der am 29. November 1920 geplante Vortrag über „Die katholische Geistesbewegung in Deutschland seit Beginn des Weltkrieges“ zu Beginn der langen Liste. Daneben wird angemerkt: „nicht gehalten, da der Saal abbrannte (Brandstiftung polnischer Insurgenten)“13. Dieser Einstieg in die Vortragstätigkeit in Przywaras Heimatstadt mag symbolisch gesehen werden: in der Zerrissenheit zwischen den benachbarten Völkern, im brodelnden Chaos nach dem Zusammenbruch der alten Ordnung, im Trauma des verlorenen Krieges.
Auch Ereignisse um Kattowitz in den drauffolgenden Jahren sind bezeichnend für die Welt, in der Przywara lebte. Unweit von seiner Heimatstadt wurde mit dem fingierten Überfall auf den Sender Gleiwitz der Paukenschlag für den Ausbruch des II. Weltkrieges gegeben. Nach dem Krieg blieb Kattowitz hinter dem Eisernen Vorhang, um 1953–56 sogar Stalinogród zu heißen. Ca. 30 km von Kattowitz entfernt liegt noch eine andere Stadt, die wie keine andere für das Dunkle des 20. Jahrhunderts steht: Auschwitz.
Diese Erde, die Przywara in seinen Kindes- und Jugendjahren geformt hatte, versank im Chaos des Weltgeschehens. Mit ihr versank aber auch ein weltanschauliches, philosophisches und politisch-gesellschaftliches Projekt. Der I. Weltkrieg zeigte, dass der „Kohlen-Halden-Boden“ am Dreikaisereck des ausgehenden 19. Jahrhunderts nur eine dünne Erdkruste der Technik und der Politik war, unter der die „versöhnten Gegensätze ein wahrhaft chthonisches Chaos blieben, das als sein Symbol Rauch und Feuer und Aschenstaub der Gruben- und Hüttenlandschaft emportrieb“14. Mit der Weimarer Zeit beginnt das Ringen um Strukturen in politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen, um letztendlich in die nächste Katastrophe zu münden. Für Przywara ist Oberschlesien ein symbolischer Zugang zur Welt, wie sie wirklich ist. Über das Erlebnis des I. Weltkrieges schreibt er:
„Das aber ist das eigentliche fruchtbare Erlebnis der Kriegsjahre, daß diese vergötterte Welt auseinanderflog in Fetzen, daß diese ganze Menschheit, in die man Gott verengt und vermenschlicht hatte, sich zeigte als ein Raubgesindel, daß diese ganze Schöpfung sich zeigt als ein Vulkan. Das ganze Kriegserlebnis war letztlich: daß wir erwachten, und jenes Erlebnis von der Welt hatten, wie sie Augustinus uns zeichnet: diese Welt ‚ist‘ eigentlich gar nicht.“15.
Diese Welt gibt es nur als eine Spannungseinheit. Da wo Entzweiung herrscht, müssen die Bezogenheiten und Verhältnisse neu durchdacht werden. Przywara scheint jede feste Form der Einheit von Gegensätzen suspekt utopisch, trügerisch und somit letztendlich gefährlich. Er warnt unablässig vor oberflächlichen und starren Konstrukten einer Einheit der real existierenden Gegensätze. Vielmehr will Przywara alle Konstrukte zerlegen und in das Chthonische der Gegensätze hinabsteigen, um den Er...