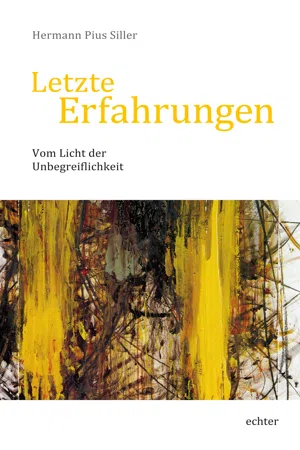![]()
D Begriffliche Annäherungen an letzte Erfahrungen
13. Erfahrung – Phrase oder Funktion?
Newman und Rahner
John Henry Newman und Karl Rahner, auf den ersten und zweiten Blick ist der Unterschied zwischen beiden groß und Gemeinsames kaum wahrnehmbar, wenn man von dem für einen Theologen selbstverständlichen Denkrahmen des kirchlichen Bekenntnisses absieht. Diesem wissen sich beide stets verpflichtet. Der Kluft und der Brücke zwischen ihnen wird man sich freilich schlagartig bewusst, wenn man an die beiden Großereignissen denkt, die jeweils ihr Jahrhundert und ihr Leben prägten: Das Erste und das Zweite Vatikanische Konzil. Je auf ihre Weise waren sie in diese kirchlichen Großereignisse verwickelt. Der Mentalitätswandel in Kirche und Gesellschaft in der Zeit zwischen den beiden Konzilien, die unterschiedlichen Problemlagen, ihr unterschiedlicher Blick auf diese Entwicklungen, die innertheologische Bandbreite möglicher Standpunkte dazu lassen einen direkten Vergleich beider miteinander vielleicht nicht sehr sinnvoll erscheinen. Auch biographisch sind Ähnlichkeiten kaum erkennbar. Herkunft, Bildung und die konfessionellen Überlieferungen, in die sie hineingewachsen sind, haben wenig Berührungspunkte. Und doch umgreift Newman und Rahner ein gemeinsamer epochaler Horizont: die Neuzeit. Diese bestimmt das Denken beider: Die Selbstbestimmung des Subjekts, die Aufklärung, der Säkularisierungsprozess, die historische Wissenschaft, die Geschichtlichkeit des Denkens, Fortschritt und Entwicklung, die Aufkündigung der Traditionen, die Naturwissenschaften, die technische Weltbeherrschung und der Geltungsanspruch der empirischen Forschung; zuletzt zunehmend dann aber auch die Unterbelichtung des Subjekts und seine Bedrohung durch die Funktionalisierung in den Systemen der Gesellschaft und der Wirtschaft. Beide, Newman und Rahner lassen sich zentrale Probleme ihrer theologischen Arbeit von diesem Zeithorizont her zutragen.
Beide, Newman und Rahner, hatten ziemlich klare Vorstellungen von der Lage der Christen und der Kirche in den kommenden Generationen. Beide arbeiteten daran, die kirchliche Glaubensüberlieferung und die alltägliche Lebenswelt zueinander in Beziehung zu setzen. Beide suchten die Christen in ihrer Lebensführung zu Entscheidungen aus dem Glauben und in ihrem Glauben zu befähigen, also Subjekt zu sein. Beide hatten unter den kirchlichen Instanzen ihrer Zeit nicht wenig zu leiden. Sie trugen dies mit Fassung. Newmans vorzüglicher Denkhorizont mit der zentralen Thematik, christliches Leben im kirchlichen Glauben zu verarbeiten, war die Biographie seiner eigenen Lebensgeschichte. Seine biographische Arbeit ist von vornherein theologisch qualifiziert. Die Kategorie, die sich ihm für die biographische Verarbeitung seines Lebens aus der Theologie und der Frömmigkeitsgeschichte anbot, ist der Begriff „Providenz“. Die Wahl dieses Begriffes ist alles andere als beliebig. Providenz bezeichnet aus biographischer Sicht zunächst die prinzipielle Unabschließbarkeit jeder eigenen Deutung der Lebensgeschichte, also den Vorbehalt, für sie einen umfassenden und abschließenden Sinn zu haben.216 Providenz macht anders als die Begriffe „Schicksal“, „Entwicklung“ und „Fortschritt“ zurück- und vorausblickend der endlichen Existenz eine offene Erfahrung möglich. Newman artikuliert mit Providenz die Erfahrung der führenden und tragenden Nähe des Geheimnisses in seiner Lebensgeschichte. Der Ort dieser Erfahrung ist das Gewissen.
Für Newman eindringlich ist die Erfahrung, dass er in die Pflicht genommen wird durch ein Anderes, einem Jenseits und Außerhalb des Subjekts. Dieser unbedingte und unabhängige Anspruch auf die konkrete Existenz ist ein schwerlich überhörbares und übersehbares Phänomen in der Lebensgeschichte. Das ist es, was er Gewissen nennt. Begrifflich wird dieses Phänomen lediglich abstrakt und diskursiv erfasst. Zu einer „realen Erfassung“ des Phänomens gehört auch, dass es den Erfahrenden angeht, ihn einbezieht, es nicht blind ist, dass sich darin eine von ihm unabhängige Autorität zeigt, dass die Deutlichkeit des „sprechenden“ Gewissens nicht objektiv normierend gegeben ist, sondern mit der Häufigkeit und der Intensität des Hinhörens seitens des Subjekts wächst. Mit Glaubenssätzen verhält es sich ähnlich. Der begriffliche Umgang mit Lehrsätzen ist abstrakt und diskursiv. Der Ort dieses Umgangs ist die wissenschaftliche Theologie. Sie spricht vorzüglich von Glaubensinhalten einzelner Sätze im Ganzen der Dogmatik. Aber jeder Glaubenssatz erheischt auch Zustimmung und artikuliert den Grund und das Gewicht seines Anspruches in einer bestimmten lebensgeschichtlichen Situation. Nur wenn der Glaubenssatz im Zusammenhang schon früher gemachter Erfahrungen erfasst wird, ist auch eine „reale Zustimmung“ möglich. Die lebensgeschichtlich gehäuften Erfahrungen mit konkreten und kontingenten Ereignissen machen die Zustimmung zu einem Glaubenssatz, aber auch zur Providenz wahrscheinlicher und fester.
In einer sachlichen Nachbarschaft dazu steht das Paradigma, von dem Karl Rahner ausging: die Entscheidungssituation über den persönlichen Lebensweg, wie sie in den geistlichen Übungen des Ignatius vorgesehen ist. Die leitende Frage dabei ist, nach aller vernünftigen Analyse des eigenen Vermögens, der Lebensverhältnisse, der Wünsche, der Projektionen und nach Gewinnung einer Äquidistanz zu all dem: Was ist der Wille Gottes? Diese paradigmatische Frage weitet sich dann allerdings aus auf den gewöhnlichen Alltag, in dem zwischen dem eigenen freien Wollen und Gottes führender Nähe nicht einfach gegenständlich unterschieden werden kann. Und sie weitet sich aus auf die christliche Glaubenslehre, die nur dann richtig verstanden wird, wenn sie interpretiert wird im Horizont der bleibenden Unbegreiflichkeit und Unverfügbarkeit der gnädigen Zuwendung Gottes zu dem konkreten Dasein in seiner Lebensführung. Soll das Geheimnis der Selbstmitteilung Gottes, die ungeschaffene Gnade also, in den Entscheidungen des Alltags relevant werden, dann muss sie im „Tun“ der Freiheit auch erfahrbar sein. Andernfalls wäre die Gnade dieser Nähe für die freie Entscheidung im Kontext der Lebensgeschichte kaum erheblich. So gelesen ist die ganze Theologie Karls Rahners theologisch rekonstruierbar als Erfahrung im Heiligen Geist.217
Für Newman und Rahner ist das kirchliche Bekenntnis Basis jeder theologischen Arbeit. Deshalb legt sich die Frage nahe: Will dieses Bekenntnis die persönliche Erfahrungen im Glauben unerheblich machen oder impliziert es schon in irgendeiner Weise Erfahrung, will es diese Erfahrung vielleicht sogar versprachlichen und in sie einweisen? Das Glaubensbekenntnis wird, das ist unbezweifelbar, unzureichend angeeignet, wenn es nur begrifflich für wahr gehalten wird. Die Zuspitzung des Bekenntnisses auf eine Unterscheidungslehre von Orthodoxie und Heterodoxie ist in der Geschichte der Entstehung von Bekenntnissen ebenfalls nur sekundär. Der ursprüngliche Ort des Bekennens ist der Gottesdienst, also der Zusammenhang mit Danksagung und Lobpreis. Danksagung und Lobpreis haben, wie jede liturgische Form, eine Verankerung im Alltag. Sie erwachsen aus konkret gelebtem Glauben, aus Vertrauen und aus dem Risiko der Liebe. Glauben, Hoffnung und Liebe haben als bewusste Handlungen, die auf Wirklichkeit bezogen sind, Erfahrungen in sich. Die Theologie des Paulus entspringt aus dem gelebten und erleuchteten Vertrauen auf eine absolut freie und bedingungslose Gegenwart des unergründbaren Geheimnisses im Leben (Röm 11,33–36). Eine rationale Selbstbegründung gibt es nicht. Der Erfahrungsboden des Bekenntnisses im ersten Johannesbrief ist die Liebe: „Wir haben die Liebe geglaubt“ (1 Joh 4,16). Der Wirklichkeitsgewinn des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe macht die Erfahrung des Heiligen Geistes aus.
Aktualität des Problems
Es gibt ohne Zweifel gegenwärtig eine Inflation der Rede von der Erfahrung und der Berufung auf Erfahrung. Was verspricht man sich von Erfahrung? Und was meint man damit? Welche Motive veranlassen diesen häufigen Gebrauch? Wozu soll die seit Schleiermacher in den Kirchen und in den Theologien stark verbreitete Rede von der Erfahrung dienen? Die in den Naturwissenschaften geltende Rolle der Empirie mag das Bedürfnis nach einem ebenso harten Kriterium in den Geisteswissenschaften und in der Theologie gefördert haben, an dem man Überzeugungen fest machen zu können hoffte. Dabei stellte sich ein Mangel in der kirchlichen Praxis und eine Unzufriedenheit mit der konventionellen religiösen Rede heraus. Beides war nicht eingerichtet für einen Glauben, über den der auf sich allein gestellte Einzelne zu entscheiden hat. Die kirchliche und die theologische Sprache, die überlieferte Lehre, die kirchlichen Institutionen und Riten setzten bis dahin fast nur auf einen im Voraus geschenkten und ungefragt vom Subjekt eingeforderten Kredit. In Mitteleuropa sind die Menschen seit Jahrhunderten in selbstverständlich geltende religiöse Überzeugungen hineingewachsen. Deshalb brauchten diese nicht in sich selber durchsichtig sein auf Erfahrungen, die ihnen wohl einmal zugrunde gelegen haben und die vielleicht in anderer Weise zwar aber doch auch heute wieder mit ihnen zu machen wären. Die in der Kirche überlieferte Sprache und die ihr entsprechenden Riten sind nicht ohne weiteres in der Lage, sich lebensweltlich verständlich zu machen. Zudem: Die in unserer Lebenswelt dominierenden und in den Medien artikulierten Vorstellungen lassen religiöse Erfahrungen schwerlich authentisch werden. Im Umgang mit religiösen Wörtern und Zeichen wird eine kulturelle Distanz zwischen Religion und Gesellschaft signifikant. Darin religiöse Erfahrungen zu identifizieren und für sie einen Ort in der Lebenswelt zu entdecken, bedarf eigener Anstrengungen. Nicht weniger aufwendig ist die Anstrengung, den ursprünglichen Bedeutungsgehalt der im Gottesdienst gebrauchten Glaubenssprache zu rekonstruieren. Der Christ ist heute zunächst fast genötigt, die offizielle Sprache des Glaubens wie eine Fremdsprache zu erlernen, um dann möglichst von der Theologie zu hören, was damit nun eigentlich gemeint ist. Das ist ein Hinweis darauf, wie wenig von selbst verständlich, sondern nur akademisch gedeutet die christliche Glaubenssprache einen Ort im Leben finden kann. Die Kluft zwischen Alltagssprache und Glaubenssprache macht historische, hermeneutische und rekonstruierende Anstrengungen nötig. Die Frage, was eigentlich Glaubenserfahrung ist und wie wir sie mitteilen können, wird dringend.
Der Mangel kontextueller Zusammenhänge für unsere Glaubenssprache erklärt noch etwas anderes. Kurzweilige, dafür dramatisch hochgezogene Events, scheinen an die Stelle von Erfahrungen in weit greifenden Zusammenhängen zu treten. Events wie Kirchentage, Weltjugendtage u.ä. sind zwar Erlebnisse, aber noch keine Erfahrungen. Sie scheinen eher funktional und ersatzweise an ihre Stelle zu treten. Erlebnisse allerdings bleiben punktuell und momentan; sie nehmen nicht nachhaltig die Zusammenhänge einer Lebensgeschichte und einer weitgespannten Lebenswelt auf. Sie können darin keinen bleibenden Ort finden. Auch greifen sie nicht in die Gestaltung von Identität ein, dies schon deshalb nicht, weil sie meist in keinem langfristigen Zusammenhang mit der Lebenswelt des Subjekts stehen. Das Subjekt in seinen nachhaltigen lebensgeschichtlichen Entscheidungen bleibt von Erlebnissen nur kurz und oberflächlich berührt. Ein Erlebnis wird nicht ohne weiteres „Erfahrung“. Die viel gebrauchte Rede von Erfahrung droht auf diesem Weg inhaltslos zu werden und hat dann lediglich einen persuasiven, beschwörenden, autosuggestiven Zweck.218 Sie will etwas herbeireden, was nicht da ist. Die sprachliche Inflation ist in diesen Fällen Signal für einen realen Mangel.
Die Rede, die von dem Wort „Erfahrung“ Gebrauch macht, lautet: Ich mache Erfahrung von etwas. Diese sprachliche Wendung bezieht das Wort Erfahrung zuerst auf einen vom Erfahrenden unabhängigen Gegenstand, einen Sachverhalt, ein Geschehen. Es nimmt also Bezug auf etwas. Erfahrung ist intentional. Etwas wird erfahren, was vorher so nicht wahrgenommen wurde; oder es wird unter einem neuen Gesichtspunkt erfahren. Bei der Einnahme eines neuen Gesichtspunktes bezieht sich Erfahrung nicht mehr nur auf einen Gegenstand, sondern auch auf den, der den Gesichtspunkt einnimmt und so die Erfahrung macht. Dabei merkt er, dass der „Gegenstand“ ihn nötigt, sich selbst zu verändern. Vom Erfahrungsgegenstand geht auf das Erfahrungssubjekt eine bestimmende Autorität aus. Richard Schaeffler formuliert diesen Anspruch der Erfahrung: „Veritas semper maior“.219 Dies macht die Erfahrung aus: Der Erfahrende ist in die Erfahrung selbst mit einbezogen; er wird selber mit zum Thema von Erfahrung. Seine Weise wahrzunehmen verändert sich. Er verändert sich in der Erfahrung. Er nimmt sich selbst nochmals anders wahr, er wird „klüger“. Das ist freilich nur deshalb möglich, weil er von vornherein in die Erfahrung verwickelt war, also konstitutiv zur Erfahrung beigetragen hat. Er „macht“ Erfahrung. Er „er-fährt“ etwas, indem er sich selber in Bewegung versetzt.
Doch die neuen Perspektiven, die der Erfahrende einnimmt, sind keine leeren, völlig unvoreingenommenen Sichtweisen, weil sie meist von vorausgehenden, früher schon gemachten Erfahrungen vor- und mitgeprägt sind. Das Erfahrene trägt Spuren früherer Erfahrungen anderer an sich. Die dabei verwendete Sprache bringt schon gemachte Erfahrungen mit; sie stellt bereits gemachte Erfahrungen zur Konstitution neuer Erfahrungen zur Verfügung. Darin meldet sich der „Zusammenhang“ an, in dem „Etwas“ erfahren wird, aber in dem auch der Erfahrende sich selber in seiner Identität erfährt.
Der Zusammenhang erzeugt die Erfahrung mit. Dies zeigt sich paradoxerweise auch darin, dass der „Zusammenhang“ durch eine neue „Gegebenheit“ möglicherweise unte...