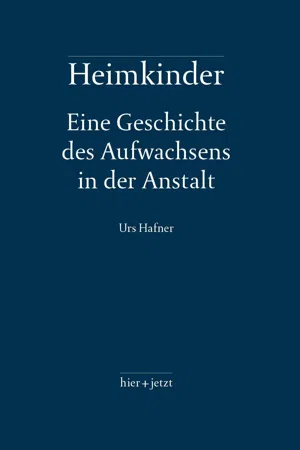![]()
Inhalt
Ohne Eltern
I.
Die Gnade des Spitals
Das Kloster als Urzelle
Die Reformation und ihre Moral
II.
Das Regime des Waisenhauses
Strenge Zucht in Zürich
Pädagogische Pläne in Bern
Waisenhäuser im Umbruch
Eine pietistische Modellwelt
III.
Die Utopie der Rettungsanstalt
Pauperismus und Philanthropie
Der Waisenhausstreit
Pestalozzis positives Menschenbild
Die Reformanstalten
Rettungsanstalt Freienstein
Konfessionelle Differenzen
Das 19. Jahrhundert als Anstaltenjahrhundert
IV.
Eine Anstaltsgeschichte in Bildern
V.
Die Transformation des Heims
Verwahrlosung, gesetzlich verankert
Looslis Anstaltskritik
Die katholische Anstalt
Landerziehungsheim versus Zwangserziehungsanstalt
Verdingte Kinder und Kinder der Landstrasse
Die Zäsur der Heimkampagne
Abgründe in Selbstzeugnissen
Neue Heimtypen und ihr schweres Erbe
Die Wege der Fremdplatzierung
Das partizipative Kind
Einschliessen als Ausschluss
Anhang
![]()
Ohne Eltern
Ein Kind hat einen Vater und eine Mutter. Es wohnt mit ihnen am selben Ort, im selben Haus. Betreut von seinen Eltern, wächst das Kind in seiner Familie auf. Wenn es das Jugendalter erreicht hat – also je nach Ausbildung, familiären und finanziellen Verhältnissen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren –, zieht es aus, lebt mit anderen in einer Wohngemeinschaft oder mit dem Freund oder der Freundin zusammen, um eines Tages einen eigenen Hausstand zu gründen und selber Kinder grosszuziehen.
Ungefähr so stellen wir uns das Aufwachsen und Erwachsenwerden eines Kindes und Jugendlichen vor. Doch damit projizieren wir unsere Normalitätsvorstellungen auf die Gegenwart kindlicher und jugendlicher Lebenswelten. Die Realität ist eine andere: Aufgrund vielfältiger Patchwork-Familienkonstellationen und hoher Scheidungsraten wachsen heute viele Kinder nicht mehr nur zusammen mit den biologischen Eltern, sondern mit sozialen Elternteilen – also den neuen Partnerinnen und Partnern der leiblichen Eltern – sowie an mehreren Orten auf – dort, wo die Betreuungspersonen leben. Kinder aus schwierigen familiären Verhältnissen, welche das Aufwachsen massiv beeinträchtigen können, verbringen zudem längere Phasen der Adoleszenz oft ausserhalb ihrer Herkunftsfamilie, sei es in Pflegefamilien oder stationären Institutionen wie etwa in Jugendheimen.
Die sozial breit akzeptierte Wunschvorstellung, dass das Grosswerden im emotional dichten Rahmen der Herkunftsfamilie der Normalfall sei, wird wahrscheinlich umso stärker, je weniger sie mit der Realität übereinstimmt. Je weniger diese dem entspricht, was wir als gut betrachten, je mehr diese also unsere moralischen Vorstellungen und unser Selbstbild kränkt, desto eher malen wir uns ein geschöntes Bild. Was gut und normal sei, denken wir, sei schon immer so gewesen und sei überall so. Wie Ethnologen berichten, war es auf den westpazifischen Karolinen-Inseln noch im 20. Jahrhundert gang und gäbe, dass Eltern ihre Kinder dauerhaft in fremde Hände gaben – nicht weil sie ihrer überdrüssig geworden oder mit ihnen überfordert gewesen wären, sondern weil diese Sitte dem Gedeihen des Nachwuchses als förderlich galt. Die Gesellschaft versprach sich vom Kindertausch zwischen verschiedenen Familien eine verstärkte soziale Integration, Kohäsion und Reziprozität.1 Noch weniger trifft die Unterstellung, dass alle Kinder ganz natürlicherweise und am besten bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen, auf die Vergangenheit zu. Das 19. Jahrhundert etwa, das – zumindest aus historischer Perspektive – noch nicht lange Geschichte ist, gilt als das «Jahrhundert der Anstalten»: Tausende von Kindern vor allem aus den Unterschichten wuchsen in den von bürgerlichen Kreisen neu gegründeten Rettungshäusern und Erziehungsanstalten auf. Noch früher beherbergten Spitäler, Waisen- und Arbeitshäuser elternlose, verstossene oder von zu Hause ausgerissene Kinder und Jugendliche.
Von ihnen handelt dieses Buch. Es handelt nicht von der Normalität des Aufwachsens im familiären Rahmen, sondern von der – für die betroffenen Fälle – zu akzeptierenden Realität des Aufwachsens ohne Eltern. Das Buch erzählt mit Blick auf die Gegenwart die lange Geschichte jener Kinder und Jugendlichen, die in der Schweiz seit dem Mittelalter in Heimen, Anstalten und anderen stationären Einrichtungen untergebracht wurden, weil sie keine Eltern hatten, weil diese ohne ihre Kinder leben wollten, weil sie den Eltern davongelaufen, von diesen geschlagen oder als Arbeitskräfte oder Lustobjekte missbraucht worden waren, weil die Eltern gemäss den Behörden nicht ausreichend für die Kinder sorgten oder in den Augen der tonangebenden Eliten einen anstössigen Lebenswandel führten. Es gibt viele Gründe, welche Kinder von ihren Eltern trennen.
Und es gibt viele Möglichkeiten, wie Kinder ohne ihre Eltern aufwachsen. Häufig werden und wurden sie von anderen Erwachsenen aufgenommen oder in anderen Familien untergebracht, vorzugsweise bei Verwandten. Davon ist in diesem Buch nur am Rande die Rede; ein Exkurs widmet sich dem in der Schweiz weitverbreiteten Phänomen der «Verdingkinder» im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Aus zwei Gründen werden die in Pflegefamilien untergebrachten Kinder nicht systematisch berücksichtigt: Erstens rekonstruiert dieses Buch die Geschichte der von einer Gesellschaft eigens institutionalisierten Fremdplatzierung von Kindern, nicht die sich quasi von selbst aufdrängende Alternative der Unterbringung bei Verwandten oder Bekannten. Die Geschichte der Institutionen, die elternlose oder verlassene Kinder aufnehmen, soll dem Leser die Vorgeschichte der heutigen Heime nahebringen. Wenn man deren Vergangenheit kennt, versteht man ihre Gegenwart besser. Dabei zeigt sich, dass es keine über die Jahrhunderte gleichbleibende Lösung des «Problems» elternloser Kinder gibt, ja dass sogar die Wahrnehmung der Existenz elternloser Kinder als ein soziales oder gar für die Kinder existenzielles Problem keineswegs selbstverständlich ist.
Zweitens ist die Geschichte der Unterbringung von Kindern bei Verwandten oder fremden Familien, abgesehen von den «Verdingkindern», kaum erforscht. Erstaunlich ist dies nicht: Während Institutionen wie Klöster, Spitäler, Armenhäuser und Heime zumindest offizielle und offiziöse Quellen produzieren, die von ihrer Entstehung, Gründung, Finanzierung, Leitung, den möglichen baulichen Veränderungen und so weiter und am Rande von den Insassinnen und Insassen zeugen, hat der Aufenthalt von Kindern in fremden Familien bis ins 19. Jahrhundert kaum Spuren hinterlassen. Wer etwas darüber wissen wollte, müsste umso intensiver suchen. Da sich dieses Buch vorwiegend auf publizierte Forschungen stützt und diese verdichtet, hat es diese Seite der Fremdplatzierung von Kindern – die Unterbringung bei Verwandten – zwangsläufig wenig berücksichtigt. Genau genommen handelt es sich bei der Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien ebenfalls um eine institutionalisierte Fremdplatzierung, zumindest dann nämlich, wenn politische oder geistliche Behörden diese Massnahme systematisch und mit bestimmten pädagogischen Zielen anordnen. Zumindest in der Gegenwart stehen die beiden Möglichkeiten der Fremdplatzierung, sei es die Pflegefamilie oder das Heim, nahezu gleichwertig nebeneinander oder sind gar in ihren Mischformen nicht mehr deutlich auseinanderzuhalten.
Ein Klima der Kälte und der Angst
Eine Geschichte der Kinderheime und Jugendanstalten in der Schweiz – beziehungsweise der Heime auf dem Gebiet der heutigen Schweiz – muss freilich ein grosses Defizit in Kauf nehmen. Die überlieferten Quellen geben fast ausschliesslich die Sicht der Erwachsenen wieder. Diese Spuren sind indes nicht uninteressant, im Gegenteil: Aus Heimordnungen, Gründungsstatuten, Insassenlisten, Aufzeichnungen des Heimleiters, Speise- und Unterrichtsplänen und anderem kann man sehr wohl annäherungsweise den Alltag in der Anstalt, ja den Geist eines Heims rekonstruieren. Wer gründete, wer leitete, wer finanzierte die Anstalt? Wann mussten die Kinder aufstehen, wie den Tag verbringen, wann zu Bett gehen? Wie oft wurde gebetet, wie und wer wurde bestraft, was bekamen die Zöglinge zu essen? Wurden die Mädchen von den Knaben getrennt? Wie alt waren die Kinder und Jugendlichen beim Ein- und beim Austritt aus der Institution? Warum wurden sie in die Anstalt eingewiesen, was erhofften – und erhoffen – sich die Zuständigen vom Heimaufenthalt, welche Kinder und Jugendlichen wurden interniert?
Diese und andere Fragen versucht dieses Buch zu beantworten. Sein eigentlicher Gegenstand freilich kommt kaum vor: die Kinder und Jugendlichen als Subjekte – das heisst: ihre Sicht der Dinge, ihre Gefühle, Erfahrungen und Handlungen. Die ohnehin seltenen Quellen, in denen die Kinder überhaupt zur Sprache kämen – das könnten Aufzeichnungen, Briefe, Zeichnungen, Gespräche und Erinnerungen sein –, hat nahezu niem...