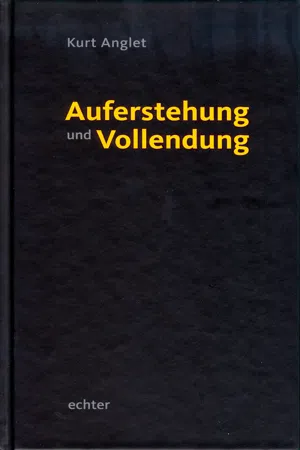![]()
Gott – der ist und der war und der kommt
»Gott bete an!« – ein Imperativ, kleine bloße Ermahnung. Wenn aber »die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung« die absolute Priorität für einen Blutzeugen – keinen bloßen Zeitzeugen – wie Alfred Delp besitzt, noch vor Brot und Freiheit, dann doch, weil er in dieser Zeit, in unserer Zeit Zeugnis von Christus abgelegt hat. Denn es bedarf keines Sprungs aus dem Historischen ins Eschatologische, weil seit Christus, seit seinem Kommen »auf bzw. mit den Wolken des Himmels« (vgl. Mt 26,64; Mk 14,62; Offb 1,7) das Eschatologische auf dem Schauplatz der Geschichte gegenwärtig ist. So furchtbar das Zeitgeschehen auch sein mag – als messianische wie als eschatologische Zeit stellt Zeit im Neuen Testament eine positive Kategorie dar:
»Zur Zeit der Gnade erhöre ich dich,
am Tag der Rettung helfe ich dir.
Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade; jetzt ist er da, der Tag der Rettung« (2 Kor 6,2). – Jetzt – nicht irgendwann. Denn die Jetztzeit ist die messianische Zeit, messianische Gegenwart im Übergang zur eschatologischen Zeit, zur Zeit der Vollendung. Und zwar »Übergang« im buchstäblichen Sinne des Wortes: als Pascha-Mysterium; bedeutet doch Pascha »Übergang«. Übergang vom Tod zum Leben, vom Kreuz zur Auferstehung Christi; ja mehr noch: Übergang vom Kreuz zu seiner Wiederkunft: »Von jetzt an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen« (Mt 26,64; par Mk 14,62).
Denn anders als die historische Zeit ist die messianische, die eschatologische Zeit Kairos – nicht Chronos. Der Zeitbegriff der gesamten modernen Philosophie, zumindest ihrer maßgeblichen säkularen Denker, führt nicht über den Chronos hinaus; der Tod behält das letzte Wort. Bei Hegel so wenig wie bei Heidegger, dem »der Tod das höchste und äußerste Zeugnis des Seyns« bedeutet (vgl. Beiträge zur Philosophie, 284). Nicht bei Nietzsche, der die Wiederkehr des ewigen Gleichen lehrt. Nicht bei Benjamin, dessen »Theologisch-politisches Fragment« nach einem Anakoluth, nach einem Fügungsbruch auch in der Syntax seiner Gedankenführung in der »ewigen und totalen Vergängnis« einer vermeintlich messianischen Natur terminiert und mit den Worten endet: »Diese zu erstreben, auch für diejenigen Stufen des Menschen, welche Natur sind, ist die Aufgabe der Weltpolitik, deren Methode Nihilismus zu heißen hat« (GS II.1,204). Genau das ist in jenen Jahren – ob mit oder ohne philosophische Approbation – geschehen. Aber auch bei zeitkritischen Denkern wie Cioran, in Adornos »Negativer Dialektik«, vom Existentialismus als Zelebration des Absurden (Cioran zufolge ein »Schluckauf im Leeren«) gar nicht zu reden, bei Schopenhauer, Freud oder Marx führt nichts über den Tod hinaus; wahrhaft »eine Bruderschaft des Todes« (Friedrich Nietzsche).
Dass so viel Todespathos bis in die zeitgenössische Theologie hinein zahlreiche große und kleine Nachbeter fand, versteht sich geradezu von selbst. Freilich ist jene »Methode«, »die Nihilismus zu heißen hat«, nun nicht auf Philosophie und Weltpolitik beschränkt geblieben, sie ist zu einem Massenphänomen geworden. »Wir sind dabei, das Band zwischen Lebenden und Toten zu durchschneiden.« Ein Gespräch mit Robert Spaemann über Sterben, Tod und Bestattung [so der Leitartikel von Benjamin Leven in »Gottesdienst« Nr. 14–15 (15. Juli 2013, Jg.47), 113–116]. Das Gedächtnis der Toten, das ja nicht allein im alten Israel, sondern nicht weniger im heidnischen Griechenland als heilig galt, werde durch die modernen Bestattungsrituale zerstört, die gezielt auf das Vergessen der Toten gerichtet seien. »In Athen, der ältesten Demokratie der Welt«, so Spaemann, »konnte niemand ein öffentliches Amt bekleiden, der nicht nachweisen konnte, dass die Gräber seiner Vorfahren in bestem Zustande waren.« Unabhängig von der Hoffnung auf Auferstehung wurde dadurch zum Ausdruck gebracht, dass kein Mensch bloß für sich existiert; dass der Einzelne seine Würde aus der Gemeinschaft der Lebenden und Toten empfängt: »Das Individuum ist erst wirklich ein Träger von Menschenwürde dadurch, dass es eine Person ist und in einer Personengemeinschaft existiert, denn Personen gibt es nur im Plural. Diese Gemeinschaft von Personen ist eine Gemeinschaft, die Lebende und Tote umfasst. Alles, was wir haben, geht zurück auf Tote. Unser Grundgesetz, das wir respektieren, ist verabschiedet worden von Menschen, die längst tot sind, Wenn wir uns auf den Standpunkt stellen: ›Was geht uns das an, was irgendwelche Toten entschieden haben?‹, dann löst sich die Kultur auf und wir versinken in einen vorhumanen Zustand. Die Vorstellung, es müsste jede Generation wieder von neuem anfangen und die Humanität erfinden, ist absurd« (ebd. 114). Damit wird letzthin selbst jenes Band zwischen den Generationen zerschnitten, die selbst Chronos, also der historische Zeitverlauf, theologisch gesprochen: die Schöpfungsordnung, zusammenfügt.
Doch nicht allein um die Zerstörung unserer Kultur geht es bei der »Methode Nihilismus«, sondern um nicht weniger als um die Zerstörung der Schöpfungsordnung, die selbst der heidnische Mensch, der Mensch des Mythos respektierte, wollte er nicht die Grundlage seines Lebens, seiner Kultur zerstören, die über Generationen hinweg gewachsen ist. Und obgleich sich angesichts der Vereinzelung des modernen Menschen – rein pragmatisch gesehen – nur schwer etwas gegen die modernen Bestattungsrituale einwenden lässt, so betrachtet der greise Philosoph die gesteigerte Nachfrage nach einer ›pflegefreien‹ Bestattung mit Bestürzung: »Ich halte das für ein gravierendes Signal dafür, dass die Einheit des Menschengeschlechtes angegriffen wird, dass der Mensch als Zugehöriger zu einer Familie, als ein Wesen mit Vater und Mutter, reduziert wird auf ein ›bloßes Individuum‹, das beziehungslos zu seiner Welt ist« (ebd.). Solche Vereinzelung aber – der heiligen Hildegard von Bingen zufolge ein Zeichen der Endzeit – ist der hohe Preis, den der Mensch für einen überhöhten Individualismus zu zahlen hat, mag er sich auch im digitalen Zeitalter mit der ganzen Welt »vernetzt« wissen: das einzige Fenster von Leibniz’ fensterlosen Monaden.
Mehr noch als in irgendwelchen Horrorszenarien; mehr noch als in Kriegen und Seuchen offenbart sich hier die apokalyptische Dimension der Moderne bzw. einer Postmoderne, weil sie einen Typus hervorbringt, der dem »Menschen der anomía, der Gesetzwidrigkeit« zum Verwechseln ähnlich sieht, dessen Sichtbarwerden nach dem Apostel Paulus dem Tag des Herrn vorausgeht, den die Thessalonicher unmittelbar erwarten: »Lasst euch durch niemand und auf keine Weise täuschen! Denn zuerst muss der Abfall von Gott kommen und der Mensch der Gesetzwidrigkeit erscheinen, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt, dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt« (2 Thess 2,3–4). Solche Selbstvergötterung ist das Wesensmerkmal eines Menschentypus, der nichts über sich erkennt, anerkennt: weder ein heiliges Recht im Sinne der Antike noch das mosaische Gesetz, kein Naturrecht und kein Grundgesetz, kein Prinzip außer – dem Lustprinzip. Als absoluter Bezugspunkt seiner selbst erscheint dann auch die Welt um ihn herum, als ein einziger Reflex seiner Gedanken und Wünsche, seiner Ängste und Träume. Wie in amerikanischen TV-Serien die Worte und Rufe der Akteure durch ein künstliches Lachen untermalt werden, als handelte es sich bei dem Spiel um ein Theater vor einem Kreis imaginärer Zuschauer, so gerät die Welt zur Bühne der Selbstinszenierung. Daher schon die Vorliebe eines Napoleon, der sich zu seiner Selbstinthronisation zum Kaiser in den Tempel des Herrn setzte, für das Theater; daher seitdem die ausgesprochene Begabung aller Imperatoren und Diktatoren, die Geschichte schrieben, zur Selbstinszenierung, ohne die ihnen kaum die Verführung der Massen gelungen wäre.
Die Macht solcher Verführung liegt allerdings weniger im Wort als vielmehr in einem Gestus – im Wink. »Dieser Wink als Ereignis stellt das Seiende in die äußerste Seinsverlassenheit und durchstrahlt zugleich die Wahrheit des Seins als ihr innigstes Leuchten.« Die Aura der Verführung, die Heidegger hier als »Wahrheit des Seins« preist (vgl. Beiträge zur Philosophie, 410; ebd. die folgenden Zitate), erstrahlt im Zustand äußerster Verfinsterung; in Wahrheit ein Zwielicht, dessen Faszination die Menschen umso bereitwilliger erliegen, je dunkler ihnen die Welt um sie herum wie auch ihr eigenes Seelenleben erscheint, das im Wechselbad der Gegensätze förmlich zerrieben wird. »Im Herrschaftsbereich des Winkes treffen sich neu zum einfachsten Streit Erde und Welt: reinste Verschlossenheit und höchste Verklärung, holdeste Berückung und furchtbarste Entrückung. Und dieses je wieder nur geschichtlich in den Stufen und Bereichen und Graden der Bergung der Wahrheit im Seienden, wodurch dieses allein wieder seiender wird in all dem maßlosen, aber verstellten Verlöschen ins Unseiende.« Man könnte meinen, das Protokoll eines Rauschgiftsüchtigen vor Augen zu haben, der zwischen Ekstase und Ernüchterung schwebt, um schließlich in den Ekstasen der Ernüchterung zu sich zu kommen, vor dem »Verlöschen ins Unseiende«. Doch geht es hier nicht um irgendeinen armen fehlgeleiteten Menschen, sondern um den Gestus der Verführung, genauer: des Verführers, dessen Epiphanie der Phänomenologe Heidegger hier verzeichnet: »In solcher Wesung des Winkes kommt das Seyn selbst zu seiner Reife. Reife ist Bereitschaft, eine Frucht zu werden, und eine Verschenkung. Hierin west das Letzte, das wesentliche, aus dem Anfang geforderte, nicht ihm zugetragene Ende. Hier enthüllt sich die innerste Endlichkeit des Seyns: im Wink des letzten Gottes.«
Reife – nicht Vollendung beschreibt seinen Weg, wie sie einer gnostischen Gottheit eigen ist. Dabei bleibt wohlweislich offen, welche Frucht da heranreift; kann es sich doch durchaus um eine Frucht des Todes handeln, wie auch »Verschenkung« die Verschenkung seiner Seele besagen kann. Deshalb bildet das Wesensmerkmal solcher Reife nicht die Fülle, sondern die Versagung, das »Nicht«: »In der Reife, der Mächtigkeit zur Frucht und der Größe der Verschenkung, liegt zugleich das verborgenste Wesen des Nicht, als Noch-nicht und Nicht-mehr.« Alles genommen und nichts dafür bekommen zu haben – das macht die Kunst des Verführers aus, dem Heidegger unter dem Titel »der letzte Gott« das vorletzte Kapitel seiner »Beiträge« widmet. Dabei zeichnet Heidegger auch hier aus, dass er dem Leser nichts vorenthält, wenn er fortfährt: »Von hier aus ist die Innigkeit der Einwesung des Nichthaften im Seyn zu erahnen. Gemäß der Wesung des Seyns aber, im Spiel des Anfalls und Ausbleibs, hat das Nicht selbst verschiedene Gestalten seiner Wahrheit und demgemäß auch das Nichts.« Wer mag nach diesen Sätzen bestreiten, dass es allein »die Aufgabe der Weltpolitik« wäre, »deren Methode Nihilismus zu heißen hat«, das Nichts den Menschen schmackhaft zu machen? Es hat in die Ontologie Eingang gefunden unter der Gestalt des letzten Gottes und ist »Methode« geworden – als Weg und Wink des Verführers, der in den Untergang vorausgeht.
Man mag das herunterspielen, als handelte es sich um ein absonderliches Gedankenspiel, dem niemand zu folgen brauche. Doch nicht das Parteibuch eines Philosophen ist ausschlaggebend; vielmehr ist er beim Wort zu nehmen, zumal dann, wenn ihm noch heute gehuldigt wird wie jüngst durch George Steiner in seinem Buch über Denken und Dichten. Die Zielrichtung von Heideggers Denken ist klar, wie aus dem Epitheton zu dem Kapitel »Der letzte Gott« hervorgeht: »Der ganz Andere gegen / die Gewesenen, zumal gegen / den christlichen« (Beiträge zur Philosophie, 403). Hinter seiner Maske verbirgt sich der Mensch des Abfalls, der sich seinen eigenen Gott wie seine eigene Schöpfung schafft, auch wenn er keine andere Erlösung kennt als den Weg in den Untergang, in den ihm sein Gott frohen Mutes vorangeht. Das Verfängliche seines »Winkens« (vgl. ebd. 411) liegt gerade darin, dass sein Weg so harmlos erscheint; die »Bereitschaft«, ihm zu folgen, ein Kinderspiel, gleich dem Sprung über einen Graben, aus dem man immer wieder herausfindet. Dass dabei viel mehr auf dem Spiel steht als ein unglücklicher Beinbruch, hat Robert Spaemann in dem oben zitierten Gespräch (vgl. ebd. 116) auf den Punkt gebracht, nachdem er zunächst anmahnt, dass in den Kirchen wieder mehr von den »letzten Dingen« gesprochen werden müsse: »Die ganze christliche Lehre ist eine Lehre von der Erlösung und von der Rettung des Menschen. Wenn es aber keine Gefahr gibt, dann brauchen wir auch keine Rettung. Der Mensch ist erlösungsbedürftig und was ihm droht, ist der ewige Tod, die Gefahr, vollständig vergeblich gelebt zu haben.«
Davor die Augen zu verschließen – darin liegt die Heuchelei des modernen Nihilismus, der so tut, als könne er jene Gefahr meistern; als könne er den »Versuch« riskieren, dem ewigen Tod ins Auge zu schauen. »Mögliches, und gar das Mögliche schlechthin«, schreibt Heidegger, »eröffnet sich nur dem Versuch. Der Versuch muß von einem vorgreifenden Willen durchwaltet sein. Der Wille als das Sichübersichhinaussetzen steht in einem Übersichhinaussein. Dieser Stand ist die ursprüngliche Einräumung des Zeit-Spiel-Raumes, in den das Seyn hineinragt: das Dasein. Es west als Wagnis. Und nur im Wagnis reicht der Mensch in den Bereich der Entscheidung. Und nur im Wagnis vermag er zu wägen« (Beiträge, 475). – Man mag sich an Heideggers ontologischer Terminologie stoßen, doch schon wie in »Sein und Zeit« bringt er auch hier luzide die Haltung dessen zum Ausdruck, der im Grunde mit dem Leben abgeschlossen hat (vgl. das Wortungetüm »Übersichhinaussein«) und daher vor dem »Versuch«, letzthin der Versuchung nicht zurückschreckt, den »Zeit-Spiel-Raum« seines Daseins zu nutzen, sich dem – ewigen – Tod preiszugeben. Das ist der Pathos des modernen Nihilisten, der anders als der tragische Mensch der Antike sein eigenes Schicksal in der Hand zu haben meint, ja selbst Schicksal spielt: »Und nur im Wagnis vermag er wägen.« Doch indem er seine Verzweiflung heroisch zu überspielen sucht, als hielte er alle Fäden in der Hand, hat er sich längst in den universalen Schuldzusammenhang verstrickt, den er noch so sehr leugnen mag; ist der Mensch Heideggers der Versuchung erlegen, er könne mit seiner Todesbereitschaft seine Kreatürlichkeit überspringen und gleich seinem »letzten Gott« seinen Untergang durchstehen, ganz nach der Devise: »Mögliches, und gar das Mögliche schlechthin, eröffnet sich nur dem Versuch.« Insofern das anscheinend Unmögliche: die Entscheidung zur Selbstauslöschung als »Mögliches, und gar das Mögliche schlechthin« zum Gesetz des Handelns erhoben wird, ist jedem göttlichen und moralischen Gesetz der Boden entzogen. Ganz bewusst hat Heidegger diesen Schritt vollzogen, nicht aus einer anarchischen Gesinnung – ist doch der Anarchist immer noch so etwas wie ein irregeleiteter Moralist –, sondern um »die Geschichte in ihren eigenwüchsigen Grund zu bringen«. So vermerkt er in den »Beiträgen zur Philosophie« (242 f.): »Um den Vollzug dieses Vorbereitenden unserer Geschichte handelt es sich allein bei der Seinsfrage. Alle ›Inhalte‹ und ›Meinungen‹ und ›Wege‹ im Besonderen des ersten Versuchs von ›Sein und Zeit‹ sind zufällig und können verschwinden.« Unmissverständlich heißt es anschließend: »Aber bleiben muß der Ausgriff in den Zeit-Spiel-Raum des Seyns. Dieser Ausgriff ergreift jeden, der stark genug geworden ist, die ersten Entscheidungen zu durchdenken, in deren Bereich mit dem Zeitalter, dem wir eingeeignet bleiben, ein wissender Ernst [!] zusammentaugt, der sich nicht mehr stößt an gut und schlecht, an Verfall und Rettung der Überlieferung, an Gutmütigkeit und Gewalttat, der nur sieht und faßt, was ist, um aus diesem Seienden, darin das Unwesen waltet als ein Wesentliches, in das Seyn hinauszuhelfen und die Geschichte in ihren eigenwüchsigen Grund zu bringen.« Nichts anderes ist in »dem Zeitalter, dem wir eingeeignet bleiben«, geschehen, dem ein Heidegger seine Stimme leiht, als sei er der Schöpfer einer Geschichte, die längst um sich greift, während er in Wahrheit lediglich ihr Wortschöpfer ist. Gleichwohl ist er nicht zu unterschätzen, weil sich in solcher Anmaßung und Vermessenheit ebenjener Typus der anomía, der Gesetzwidrigkeit, artikuliert, der sich anschickt, »die Geschichte in ihren eigenwüchsigen Grund zu bringen« – ganz im Sinne der prophetischen Einschätzung des Apostels Paulus: »Der Gesetzwidrige aber wird, wenn er kommt, die Kraft des Satans haben. Er wird mit großer Macht auftreten und trügerische Zeichen und Wunder tun. Er wird alle, die verlorengehen, betrügen und zur Ungerechtigkeit verführen; sie gehen verloren, weil sie sich der Liebe zur Wahrheit verschlossen haben, durch die sie gerettet werden sollten« (2 Thess 2,9–10). Nicht nur in den Millionen von Kriegstoten und Ermordeten liegt das Drama unserer Zeit. Nicht weniger in den Millionen der Verführten, die sich – um mit Robert Spaemann zu reden – eines Tages eingestehen müssen, »vollständig vergeblich gelebt zu haben«, weil sie dem Wink ihres Abgottes gefolgt sind. »Darum lässt Gott sie der Macht des Irrtums verfallen«, fährt der Apostel Paulus fort, »so dass sie der Lüge glauben; denn alle müssen gerichtet werden, die nicht der Wahrheit glauben, sondern die Ungerechtigkeit geliebt haben« (2 Thess 2,11–12). Das sind die Früchte der »Götzen-Dämmerung« bzw. der »Bereitschaft, eine Frucht zu werden« – eine Frucht des Todes, den Heidegger als »das höchste und äußerste Zeugnis des Seyns« verherrlicht. Dass solcherlei »Seyn« nicht allein von seiner Orthographie her buchstäblich nichts mit dem Seinsbegriff der abendländischen Metaphysik zu tun hat, sondern vom »Nichts« kontaminiert ist, lässt Heidegger gegen Ende seiner »Beiträge« durchblicken: »Das Seyn erinnert an ›nichts‹, und deshalb gehört das Nichts zum Seyn. Von dieser Zugehörigkeit wissen wir wenig genug [!]. Doch wir kennen eine ihrer Folgen, die vielleicht nur scheinbar so vordergründlich ist, wie sie sich ausgibt: wir scheuen und verabscheuen das ›Nichts‹ und meinen, uns solcher Verurteilung jederzeit befleißigen zu müssen, weil das Nichts doch das Nichtige schlechthin ist« (Beiträge, 480 f.). Diese Sorge dürfte Heidegger heute durchaus genommen sein, weil nichts den Menschen den Zugang zu Erlösung und Vollendung mehr verstellt als »das Nichtige schlechthin«. Nicht Seinsvergessenheit bestimmt unser Zeitalter, sondern Gottesvergessenheit; denn metanoia (»Umkehr«, »Umdenken«), ein Schlüsselbegriff der messianischen Zeit, ist buchstäblich zu einem Fremdwort in einer Welt geworden, die ganz auf die Eigengesetzlichkeit dieser Welt baut, als habe es nie einen Schöpfer, Erlöser oder göttlichen Richter gegeben. Daher stoßen alle wohlmeinenden moralischen Appelle an ihre Grenzen. Dem trägt die christliche Apokalyptik Rechnung, wenn gegen Ende der Offenbarung der Engel dem heiligen Johannes aufträgt: »Und er sagte zu mir: Versiegle dieses Buch nicht! Denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, der Unreine bleibe unrein, der Gerechte handle weiter gerecht, und der Heilige strebe weiter nach Heiligkeit. Siehe, ich komme bald, und mit mir bringe ich den Lohn, und ich werde jedem geben, was seinem Werk entspricht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig, wer sein Gewand wäscht: Er hat Anteil am Baum des Lebens, und er wird durch die Tore in die Stadt eintreten können. Draußen bleiben die ›Hunde‹ und die Zauberer, die Unzüchtigen und die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut« (Offb 22,10–15).
Draußen bleiben indessen auch die Opfer der Verführung und Ablenkung, insofern ihnen nicht zuletzt Gottes Erbarmen zuteil wird; draußen – »Vor dem Gesetz«. So lautet der Titel einer Parabel Franz Kafkas, die zunächst in einem Almanach des Kurt Wolff-Verlags erschienen ist (1916 bzw. 1915), um dann in den »Prozess« einzugehen und in dem Erzählband »Ein Landarzt« (München und Leipzig 1919, 49–56) aufgenommen zu werden. Es handelt sich gewissermaßen um die Urgeschichte der Verführung unseres Zeitalters, genauer: der Verstellung im doppelten Sinne des Wortes. Denn ein Mann vom Lande kommt zu einem Türhüter mit der Bitte, ihm Einlass in das Gesetz zu gewähren. Während ihn der Türhüter anfangs abzuschrecken sucht, weil sich hinter dem Eingang zum Gesetz eine ganze Hierarchie von Türhütern verbärge, die selbst er fürchtete, geht er allmählich zu einer Hinhaltetaktik über, zu verschiedenen Ablenkungsmanövern, bis der Mann alt und kindisch, sein Augenlicht schwach wird: »Wohl aber erkennt er jetzt im Dunkel einen Glanz, der unverlöschlich aus der Türe des Gesetzes bricht. Nun lebt er nicht mehr lange. Vor seinem Tode sammeln sich in seinem Kopfe alle Erfahrungen der ganzen Zeit zu einer Frage, die er bisher an den Türhüter noch nicht gestellt hat. Er winkt ihm zu, da er seinen erstarrenden Körper nicht mehr aufrichten kann. Der Türhüter muß sich tief zu ihm hinunterbeugen, denn der Größenunterschied hat sich sehr zu ungunsten des Mannes verändert. ›Was willst du denn jetzt noch wissen...