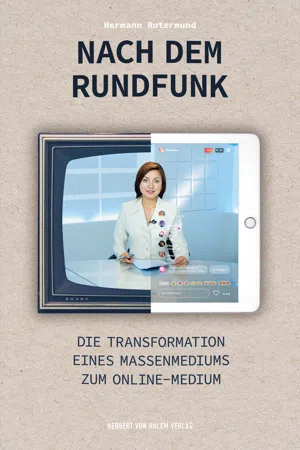![]()
1.MEDIENWANDEL
Gesellschaftlicher Wandel oder gar das Überschreiten einer Epochenschwelle vollzieht sich unmerklich. Dass jemand einen ›Nullpunkt‹ zwischen zwei Epochen bewusst erlebt, ist ausgeschlossen.
»Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen.« Dieser bekannte Ausspruch, den Goethe sich selbst dreißig Jahre nach der Kanonade von Valmy retrospektiv zuschrieb, ist eine künstlerische Fiktion und Teil eines anekdotischen Berichts:
»Noch am Morgen hatte man nicht anders gedacht, als die sämtlichen Franzosen anzuspießen und aufzuspeisen, ja mich selbst hatte das unbedingte Vertrauen auf ein solches Heer, auf den Herzog von Braunschweig zur Teilnahme an dieser gefährlichen Expedition gelockt; nun aber ging jeder vor sich hin, man sah sich nicht an, oder wenn es geschah, so war es um zu fluchen, oder zu verwünschen. Wir hatten, eben als es Nacht werden wollte, zufällig einen Kreis geschlossen, in dessen Mitte nicht einmal wie gewöhnlich ein Feuer konnte angezündet werden, die meisten schwiegen, einige sprachen, und es fehlte doch eigentlich einem jeden Besinnung und Urteil. Endlich rief man mich auf, was ich dazu denke, denn ich hatte die Schar gewöhnlich mit kurzen Sprüchen erheitert und erquickt; diesmal sagte ich …« (GOETHE 1898: 74f.).
In der Geschichtswissenschaft hat die Einschätzung einer sich 1792 vollziehenden Epochenwende wenig Anhänger gefunden. Zudem hat Goethe es versäumt, ein klares Abgrenzungskriterium für seine Epochenvorstellung anzugeben. Dass eine Volksarmee mit einer gewissen Anzahl Kanonen die preußischen Professionals am weiteren Vorrücken in Frankreich hindern konnte, mag militärhistorisch bemerkenswert sein. Vor allem im Zusammenhang mit der Selbstbehauptung des revolutionären Frankreichs gegenüber den absolutistischen Monarchien Europas besitzt dieses Ereignis möglicherweise auch einen Symbolgehalt. Als Beleg für einen Epocheneinschnitt taugt es jedoch keineswegs.
Niklas Luhmann verlangt eine Differenzierung, die für den Nachvollzug einer Epochenbehauptung konstitutiv ist. Epochen benötigen, so stellt er fest, mindestens zwei Abgrenzungsereignisse. »Es reicht nicht aus, alles auf eine Vorher/Nachher-Differenz zusammenzuziehen – etwa Europa vor der Kartoffel und nach der Kartoffel. Denn diese Differenz könnte dann nur das grandiose Ereignis selbst, das die Epochen trennt, beschreiben, nicht aber die Geschichte als Prozeß« (LUHMANN 2008a: 102). Der Prozess der Herausbildung der für eine Epoche charakteristischen inneren Differenzierungen kann sich über eine lange Zeit erstrecken. Luhmann schlägt vor, für die Herausbildung der Differenzierungsstruktur der Gesellschaft, die für die Moderne typisch ist, eine Übergangszeit vom 12. bis zum 18. Jahrhundert anzusetzen (ebd.: 118). Es gibt ferner das Problem, dass Strukturänderungen in der Gesellschaft sich nicht als Abschaltung früherer, jetzt nicht mehr optimaler Anpassungen vollziehen. Die fortlaufende Selbsterneuerung des Systems läuft trotz beginnender struktureller Änderungen weiter, was die Durchsetzung dieser Änderungen erheblich erschwert. Luhmann findet dafür die prägnante Formel: »Selbst mit den Kräften des Herkules könnte man den Stall des Augias nicht ausmisten, wenn die Kühe drin bleiben« (ebd.: 106). Für das Zusammentreffen ›alter‹ und ›neuer‹ Medien gibt es vergleichbare und viel zitierte Beschreibungen von Wolfgang Riepl (1913) und Marshall McLuhan (1964). Beide betonen, was bei ihrer Erwähnung oft unterschlagen wird, dass mit dem Erhalt eines Rests der alten Strukturen dennoch ihre Form- und Funktionsveränderung verbunden ist. Wenn die Kommunikationsverhältnisse einer Epoche durch die Mündlichkeit ihrer Medien bestimmt sind, so bedeutet die Durchsetzung der schriftlichen Kommunikation nicht, dass nunmehr nur noch schriftlich und nicht mehr mündlich kommuniziert wird. Eine Ahnung davon, mit welchen Lasten die Durchsetzung neuer Medien verbunden ist, gibt die ausgedehnte medienkritische Literatur seit Platon. Sie spricht Bände davon, wie sehr das Verstehenkönnen und Verstehenwollen vor den aufziehenden neuen, epochemachenden Errungenschaften kapituliert. Irritation, Unsicherheit und Aggression sind oft Begleiterscheinungen solcher Konfrontationen. Die positive und kritiklose Überzeichnung des Vorhandenen, dessen drohender Verlust nun beklagt wird, macht erst einer reflektierteren Sicht und der Erkundung erlebter Beschädigungen Platz, wenn das Neue schon unwiderruflich etabliert ist.
In diesem Kapitel geht es zunächst um die Selbsterkenntnisprozesse der ›alten‹ Medien. Die Bestimmung des ›Neuen‹, die Identifizierung und Bewertung der epochemachenden Veränderungen durch die digitalen Medien muss demgegenüber größere Ungewissheiten akzeptieren und daher etwas abstrakter bleiben.
Epochenenden
»Es gibt keine Zeugen von Epochenumbrüchen. Die Epochenwende ist […] an kein prägnantes Datum oder Ereignis evident gebunden« (BLUMENBERG 1998: 545). Epochen benötigen Abgrenzungsereignisse und -merkmale. Für Hans Blumenberg ereignet sich der Beginn der Neuzeit irgendwo zwischen den Lebenszeiten und Weltbildern von Nikolaus von Kues und von Giordano Bruno in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Er synchronisiert den Epochenbeginn der Neuzeit bemerkenswerterweise nicht mit der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg. Diese medientechnische Innovation scheint für ihn – im Unterschied zu vielen Medienhistorikern – kein ausreichender Anlass zur Zuschreibung einer Epochenwende zu sein. Sein Abgrenzungsmerkmal ist die Indienstnahme der Welterklärung durch die Dogmen der christlichen Kirche. Nikolaus von Kues war der letzte einflussreiche Denker und Amtsträger (er war Kurienkardinal), der die Welt als »frei tragende spekulative Konstruktion aus den Attributen der Gottheit heraus« erklärte – »aber nicht mehr mit dem Vollgefühl der Scholastik, sondern mit der Sorge um ihren Verfall« (ebd.: 552). Das macht ihn zur Abgrenzungsfigur für die geistesgeschichtliche Epoche des Mittelalters, während Giordano Brunos Werk den Beleg dafür lieferte, dass diese Konstruktion nicht mehr funktionierte.
Es kommt das Problem hinzu, welche Merkmale von Gesellschaften als epochentypisch selektiert werden und in welche Korrelationen sie zueinander gestellt werden. Die Schlagwortfolge Buchdruck – Humanismus – Alphabetisierung – Aufklärung – Demokratie ist allgemein bekannt, Lücken können leicht gefüllt werden, und solche Aufreihungen verführen dazu, sie als Kausalketten zu verstehen oder misszuverstehen. Der Einfluss des Buchdrucks auf die Alphabetisierung in Europa ist zum Beispiel fragwürdig. Vom 16. bis tief ins 18. Jahrhundert brachte vor allem die Verschriftlichung von Verträgen und amtlichen Vorgängen die Alphabetisierung voran (dazu BENNE 2015). Dennoch gab es in Deutschland um 1770 bei großzügiger Berechnung höchstens 10 bis 15 Prozent Lesekundige in der Bevölkerung (SCHENDA 1977: 442ff.). Die Flugschriften und ›populären Lesestoffe‹ der Frühaufklärung, deren Inhalte seit den 1970er-Jahren ein beliebter Forschungsgegenstand sind, erreichten immer nur die bürgerliche Elite und keine lesenden Massen.
Die deliberierende englische Öffentlichkeit, auf die Habermas (1990) sich bei seiner Modellbildung bezog, umfasste ebenfalls nur eine kleine elitäre Schicht. In den Clubs und Kaffeehäusern wurden neben wenigen Zeitungen und Druckschriften vor allem handschriftliche Texte und Briefe ausgetauscht, die immer wieder abgeschrieben wurden. Dass die Artikel in den Proceedings der 1660 gegründeten englischen Royal Society bis ins späte 19. Jahrhundert als ›letters to the editor‹ bezeichnet wurden, geht auf diese handschriftliche Tradition zurück (MULSOW 2012). Je detaillierter die Forschung der Schrift- und Druckgeschichte die soziale Verwendung schriftlicher Materialien aufdeckt, desto unschärfer werden die Konturen und Kausalitäten, die bislang zum Schulwissen der westlichen Welt gehören. Druckmedien, die es seit Gutenberg – seit der frühen Neuzeit – gab, sind zweifellos kennzeichnende Elemente für die Periode von 1500 bis heute. Andererseits war ihre prägende Kraft auf andere Bereiche der sich im Umbruch befindlichen Gesellschaften nicht eindeutig und einflussreich genug, um die folgenden Jahrhunderte schon als ›Gutenberg-Zeitalter‹ kennzeichnen zu können. Neben religiösen Schriften wurden in den ersten 150 Jahren nach den Bibeldrucken Gutenbergs vor allem Lernmedien für Kirche, Universitäten und Verwaltung produziert (GIESECKE 1991: 217ff.). Auch Schulmaterialien wie ABC-Tafeln wurden entwickelt. Eine bedeutende Funktion hatten bildliche Gedächtnisstützen, Landkarten, Schautafeln und andere didaktische Darstellungen. Sie dienten mindestens ebenso sehr als informative wie als normalisierende Unterstützung des Wissenserwerbs. Die Städteansichten der Schedelschen Weltchronik von 1493 trugen einerseits zur Normalisierung der Weltsicht bei, andererseits verbreitet die Chronik jedoch Mythen in großer Zahl (SCHEDEL 1493). Die gedruckten Bibeln, darunter bereits vor Luther einige deutschsprachige, aber beispielsweise auch Ausgaben mit Schriften von Aristoteles, förderten die Standardisierung dieser Texte, für die vor dem Buchdruck wohl keine Notwendigkeit gesehen wurde.
Epoche, Epochenwandel und auch Medienwandel sind abstrakte Konzepte, die sich der unmittelbaren Wahrnehmung entziehen. Veränderungen erzeugen aber Irritationen in Systemen und bei Individuen. Der Prozess der Auflösung von sozialer Kohäsion, ob mit oder ohne Neukombination von Bindungen, wird nicht als solcher erlebt. Die indirekten Wirkungen, die z. B. als Verunsicherung, als Zunahme von Konflikten und allgemein als Kommunikationsprobleme wahrgenommen werden, beschäftigen die Gesellschaft jedoch unentwegt. Das war auch zur Zeit des Buchdrucks und zu Beginn der Neuzeit so. Zwei Reaktionsweisen sind offenbar typisch: Medienverehrung und Medienabwehr. Beiden liegt die bewusst oder unbewusst gestellte Frage zugrunde, welchen Nutzen die jeweiligen Medien für alle oder einzelne soziale Gruppen bzw. für den Einzelnen haben.
Medienverehrung
Seit der Durchsetzung der Schrift wird den Medien zugeschrieben, sie könnten Menschen zumindest teilweise substituieren. Das Schwert tötet den Gegner – und die Drucktechnik speichert Wissen. Giesecke (1991: 134ff.) zählt eine ganze Reihe von Vorzügen auf, die mit der Drucktechnik verbunden wurden. Gutenberg selbst wollte die Skribenten im Hinblick auf kalligrafische Qualität überbieten. Die Vervielfältigung von Texten wird erheblich beschleunigt, Druck ist im Verhältnis zu Abschriften billiger, und die Texte werden mehr und mehr standardisiert, auch wenn die Auflagen nur einige Hundert Exemplare betragen. Die Standardisierung beispielsweise von Liturgien brachte die Kirchen auf die Seite der typografischen Innovateure. Die Drucktechnik ermöglicht die Ausbreitung (göttlicher) Weisheit und entreißt der Finsternis Schätze der Erkenntnis. Der Erfahrungsverlust, der mit den handschriftlichen Textspeichern als Gefahr immer verbunden war, wird durch den Buchdruck zumindest gemildert oder sogar aufgehoben: Fortwährende Vervielfältigung macht das Wissen unsterblich. Dem Buchdruck wird – allerdings erst 150 Jahre nach seiner Einführung – Allmacht zugeschrieben. Obwohl die allmähliche Verbreitung schriftlicher Normen in Wirtschaft und Verwaltung im Wesentlichen durch skriptografische Techniken vorangebracht wurde, erfuhr die Drucktechnik höchste Wertschätzung. »Bald überstiegen die Fähigkeiten, die in die Maschine hineinprojiziert wurden, diejenige jedes einzelnen Menschen: ganze soziale Institutionen wie die ›Unterweisung durch Lehrgespräche‹ oder die ›Verkündigung von Gottes Wort in der Predigt‹ konnten durch die Druckerei substituiert werden« (ebd.: 156). Der Strom verfügbaren Wissens ermöglichte einen virtuellen Erfahrungsgewinn, der nicht mehr durch praktisches Handeln, also Versuch und Irrtum, erworben werden musste. Frühneuzeitliche Medientheoretiker feierten den Zugang zu ›fertigem Wissen‹. Ein wesentlicher, auch von Giesecke hervorgehobener Effekt des Buchdrucksystems ist die Parallelverarbeitung von Informationen: Viele Nutzer der Druckmedien können gleichzeitig Wissen erwerben und es anwenden. Diese Simultaneität wird als Beschleunigung des Informationsumschlags erfahren und vielfach der Technik selbst zugeschrieben. Martin Luther erklärte den Buchdruck zum letzten Geschenk Gottes – es ermöglichte den direkten Zugang zur göttlichen Weisheit, ohne Umweg über die Institution ›Kirche‹. Die sogenannte ›Heilige Schrift‹ wurde nicht mit dem Finger Gottes in Lehm geritzt, sondern entstand in arbeitsteiliger Massenfertigung in weltlichen Werkstätten. ›Schrift‹ ist in dieser abgekürzten Form bis heute ein Synonym für die Bibel. Die Bibellektüre wurde seit dem 16. Jahrhundert zur Freizeitbeschäftigung gottesfürchtiger und schriftgelehrter Bürger. Bibel, Katechismus und Gesangbuch bildeten die Keimzelle der kleinbürgerlichen Privatbibliotheken. Die Überführung klassischer griechischer und lateinischer Handschriften in gedruckte Ausgaben war ein zweiter Tätigkeitsbereich des frühen Typographeums. Beim Zusammentragen, Vergleichen und Edieren handschriftlicher Sammlungen tat sich besonders die Werkstatt des venezianischen Druckers Aldus Manutius hervor. »By 1520, the great work of printing the classics was for the most part complete.« Diese Erkenntnis des britischen Kulturhistorikers R. R. Bolgar (1973: 375) ermöglicht einen neuen Blick auf Hans Blumenbergs Epochenzäsur. Das Ende der christlich-dogmatischen Weltinterpretation und das Ende der Renaissance fallen zusammen. Es beginnt die Zeit der Parallelverarbeitung des gesamten Korpus der in Europa zugänglichen theologischen, philosophischen, naturwissenschaftlichen und juristischen Literatur. Ihre Resultate zeigen sich in einer Fülle von gelehrten Kommentaren und Anwendungen, die ab Mitte des 16. Jahrhunderts den Buchmarkt fluten. Während bei den Humanisten des 15. Jahrhunderts noch das Bestreben um doppelte Imitation überwiegt – Imitation der griechisch-römischen Denkfiguren und der Sprache Ciceros –, beginnt Mitte des 16. Jahrhunderts die Weiterentwicklung naturwissenschaftlicher, medizinischer und juristischer Wissensbestände (ebd.: 369ff.). Das durch Aristoteles dominierte Verständnis der klassischen Philosophie wurde durch Platon erweitert, der mit den scholastischen Traditionen nicht mehr kompatibel war. Die enzyklopädische Bibliotheca Universalis von Conrad Gesner, die 1545-1549 erschien, erfasste alle bekannten Biografien sowie künstlerischen und naturwissenschaftlichen Errungenschaften der Antike. Bolgar merkt an, dass dieses Werk eine Art Wegmarke bildete. Es war unverzichtbar vor allem für Gelehrte und Studenten, die sich speziell für die Antike interessierten, aber nicht mehr so sehr für jene, die den Stand der aktuellen Erkenntnisse auf den verschiedenen Gebieten des Wissens erkunden wollten. Die Aktualität der Klassiker hatte ihr Ende erreicht. Die gebildeten Schichten in religiösen, wissenschaftlichen und administrativen Einrichtungen – und darüber hinaus manche handeltreibenden Bürger und Künstler – waren stärker an den neuen Inhalten interessiert, die an vielen Orten gleichzeitig verfügbar wurden.
Allerdings: Auf der Ebene der Inhalte lebte das Alte im Neuen fort – und auf der Ebene der Medien ersetzte das Neue nicht das Alte, sondern ergänzte es und wies ihm einen neuen Platz und eine veränderte Relevanz zu. Die Menge, Standardisierung und Verfügbarkeit einer großen Fülle von Inhalten ist gewiss ein Vorzug der typografischen Medienwende. Ohne die gleichzeitig organisierte und durchgesetzte Standardisierung der mitgelieferten Metadaten hätte sie indes keine so zügigen Fortschritte machen können. Die Adressierbarkeit jeder Auflage jedes Buchs – mit Autor, Titel, Verlags- und Druckort sowie einer Jahresangabe ermöglichte den Fernhandel mit Büchern und eine neue Organisation von Bibliotheken. Hier mussten Kommunikationsnetze allerdings erst geschaffen und gegenüber dem schon vor dem Buchdruck existierenden Handel mit Büchern (einschließlich der zuerst 1370 stattfindenden Buchmesse in Frankfurt) ausgebaut werden. Das Buch vernetzte die frühneuzeitliche Gesellschaft auf eine besondere Weise, nämlich über den Markt. Dieser bot gegenüber den skriptografischen Verteilungsmechanismen deutliche Vorteile. Die kirchlichen Organisationen, beispielsweise die Orden, organisierten die Auswahl, Vervielfältigung und Verteilung von Literatur. Der typografische Buchmarkt kannte keine solchen Filtermechanismen – außer dem hohen Preis der Bücher und der Lesefähigkeit als Rezeptionsvoraussetzung. Der Markt war allerdings für einige Beteiligte gefährlich. Druckereien mussten die Risiken langer Produktionszeiten und eines ungesicherten Absatzes ihrer Produkte tragen. Es gab viele Bankrotte in diesem neuen Gewerbe, bis systematische Beziehungen zum Vertrieb und auch zum überörtlichen Austausch zwischen Druckereien etabliert waren. Dabei half die sich im 16. Jahrhundert in den deutschen Regionen ausbreitende Vision eines deutschen Vaterlandes. Sie hatte keine politischen Konturen, sondern war eher eine kulturelle Idee, die deutliche antikirchliche Züge hatte (GIESECKE 1991: 385ff.). Ihre Ausbreitung ging Hand in Hand mit der Drucktechnologie. Während in der skriptografischen Ära das Alte, bereits Bekannte die Orientierung vorgab, entwickelte sich mit der Durchsetzung der Drucktechnik die Orientierung am Neuen, am Erkenntnisfortschritt auf allen Gebieten. Kirchliche und behördliche Zensurmaßnahmen versetzten diesem Interesse oftmals einen Dämpfer. Allerdings konnten sie nur in Spanien und einigen anderen Ländern den Markt entscheidend beeinträchtigen. In den deutschen Staaten erwies sich die Zensur als untauglich zur Kontrolle des relativ agilen neuen Mediums. Ihre schwerfällige und hierarchische Organisation war geradezu anachronistisch, als sich die marktwirtschaftliche Vernetzung der Buchproduktion erweiterte. Eine mit der verordneten umfassenden (und ineffektiven) Vorzensur verbundene Auflage für alle Drucker waren Pflichtangaben in jedem Buch – Autor, Titel, Verlagsort, Druckerei –, die eine Verfolgung von ›Schmähreden‹ ermöglichen sollten. Sie waren jedoch auch für die Autoren nützlich, die häufig mit der unrechtmäßigen Aneignung ihres Namens und ohnehin m...