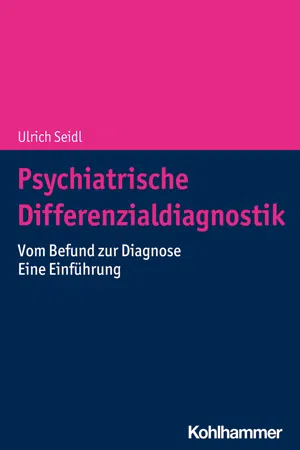
eBook - ePub
Psychiatrische Differenzialdiagnostik
Vom Befund zur Diagnose - Eine Einführung
Ulrich Seidl
This is a test
Share book
- 178 pages
- German
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Psychiatrische Differenzialdiagnostik
Vom Befund zur Diagnose - Eine Einführung
Ulrich Seidl
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
The basis for clinical work in psychiatry consists of collecting findings, recognizing and naming phenomena and diagnostic assessment. For those starting out in the field, however, it is usually difficult at first to develop a clear enough view in order to make distinctions and reach diagnoses. This book provides basic knowledge in an understandable form and provides both beginners and also more experienced clinicians with advice on terminology and diagnostic procedures. It discusses not only common diagnoses in acute psychiatry, but also potential pitfalls, difficult differential diagnoses, and therapeutic implications. Numerous clear examples provide connections with practical clinical work.
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is Psychiatrische Differenzialdiagnostik an online PDF/ePUB?
Yes, you can access Psychiatrische Differenzialdiagnostik by Ulrich Seidl in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Medicine & Forensic Medicine. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
1 Grundlagen
1.1 Vorbemerkung
Psychiatrische Differenzialdiagnostik ist eine Kunst für sich und selbst erfahrene Untersucher können gelegentlich ihre Schwierigkeiten haben, zu einer genauen Einschätzung zu kommen. Da ist die Vielzahl der klinischen Erscheinungen, da sind die oft kryptischen und nicht immer klar zuzuordnenden Angaben der Patienten. Manchmal fehlt schlicht die Zeit, sich ausreichend lange mit ihnen zu beschäftigen, um einen klaren Blick auf die Problematik zu bekommen, manchmal zeigt das Gegenüber sich verschlossen oder lehnt ein Gespräch gänzlich ab, manchmal gelingt es erst im Verlauf, die Facetten einer Erkrankung zu erfassen. Erforderlich für die Entwicklung differenzialdiagnostischer Kompetenz ist neben einer gewissen theoretischen Grundlage mit Kenntnis der wichtigsten Krankheitsbilder und deren Symptomatik auch eine gute Anleitung durch einen erfahrenen Untersucher und natürlich die permanente Übung im klinischen Kontext.


Im Bereich der Psychiatrie lauern einige diagnostische Fallstricke. So besteht die Gefahr, dass Diagnosen vorschnell, sozusagen aus dem Bauch heraus gestellt werden. Oder der diagnostische Blick ist davon beeinflusst, aus welcher der unterschiedlichen Schulen ein Untersucher kommt. Ein biologisch orientierter Psychiater wird einen Patienten möglicherweise ganz anders beurteilen als ein Psychoanalytiker oder ein Verhaltenstherapeut. Selbst wenn eine Diagnose der gängigen Klassifikation gemäß korrekt gestellt wurde, kann die nachfolgende Entscheidung über den therapeutischen Schwerpunkt individuell sehr unterschiedlich getroffen werden. Die einschlägigen Leitlinien geben hier zwar eine Orientierung, aber das Vorgehen wird dennoch davon geprägt sein, welche Hypothese bezüglich der Erkrankung und ihrer Entstehung gebildet wird und was vom Behandler im allgemeinen oder speziellen Falle als wirksam angesehen wird. Natürlich kann auch ganz pragmatisch ein an den Symptomen orientiertes Vorgehen gewählt werden. Hier jedoch besteht die Gefahr, dass zugrunde liegende Prozesse übersehen und folglich nicht behandelt werden, dass die Therapie also an der Oberfläche bleibt und nicht an der Wurzel ansetzt.


Wenn wir uns mit dem menschlichen Seelenleben in Gesundheit und Krankheit auseinandersetzen und versuchen, das, was wir sehen, zu verstehen, so tun wir dies also immer unter bestimmten Grundvoraussetzungen und Annahmen, selbst wenn uns diese nicht explizit bewusst sind. Es ist deshalb interessant, sich mit den unterschiedlichen Sichtweisen und Konzepten zu befassen, die uns zu unseren Erkenntnissen führen – und sei es, dass wir uns kritisch mit unserer eigenen Vorgehensweise auseinandersetzen oder diese bewusst weiterentwickeln.


Vor der Therapie steht die Diagnose. Dieser Umstand leuchtet selbst dem medizinischen Laien ein, denn es ist offensichtlich, dass erst gehandelt werden kann, wenn klar ist, was dem Patienten fehlt, ob er erkrankt ist und, wenn ja, an welcher Erkrankung er leidet. Wenn eine Diagnose noch nicht sofort gestellt werden kann, sollte es zumindest eine Arbeitshypothese geben, die leitend für das weitere Vorgehen ist. In den Fällen, in denen ich überhaupt nicht weiß, woran ich bin, muss ich mir zumindest Rechenschaft über mein Unwissen geben, den Fall bewusst in der Schwebe halten und zunächst einmal an den Symptomen orientiert vorgehen. Dabei darf nicht unterschätzt werden, dass Diagnosen, einmal gestellt, ein Eigenleben entwickeln können. Aus einer leichthin geäußerten Verdachtsdiagnose wird ohne entsprechenden Hinweis rasch eine vermeintlich gesicherte Tatsache, die ohne kritische Überprüfung von Mal zu Mal übernommen und tradiert wird. Umso wichtiger sind ein genauer Blick und eine zuverlässige Diagnostik.


Vielfältige Gründe können zu diagnostischen Fehleinschätzungen führen. Einer davon sind Selbstzuschreibungen von Patienten, die unkritisch übernommen werden. Auf den ersten Blick mag diese Möglichkeit erstaunen, denn wer möchte schon selbst für psychisch krank gelten? Doch psychiatrische Diagnosen können natürlich auch mit einem Krankheitsgewinn verbunden sein, also mit einem (objektiven oder subjektiven) Vorteil, der für einen (vermeintlich) Erkrankten aus seiner Krankheit hervorgeht. Wenn allgemeine Lebensprobleme zu einer Störung des Befindens führen und dies im Folgenden zur Krankheit erklärt und sozusagen psychiatriert wird, dann bedeutet das, dass die Verantwortung für deren Lösung an Ärzte, Therapeuten oder allgemein an das Gesundheitswesen delegiert werden. Der verständliche Wunsch nach einfachen Lösungen von schwierigen Problemen kann so stark sein, dass bereitwillig Medikamente genommen oder sogar biologische Verfahren wie die elektrokonvulsive Therapie (EKT) eingefordert werden, obwohl keine Erkrankung im eigentlichen Sinne vorliegt. Leitend ist möglicherweise der trügerische Gedanke, dass es dem Betroffenen danach schon in irgendeiner Form besser gehen wird und sich die Schwierigkeiten im Folgenden quasi von selbst lösen. Hinzu kommt, wie bei allen Erkrankungen, die Möglichkeit der Entlastung von alltäglichen Aufgaben, etwa durch Krankschreiben oder sogar Berentung. Aus diesem Grunde ist es von großer Wichtigkeit, dass Diagnosen zuverlässig gestellt oder eben auch nicht gestellt werden (auch wenn die zweite Möglichkeit nicht jedem gelegen kommt). In der Psychiatrie ebenso wie in anderen Bereichen der Medizin ist es unmöglich, eine allgemein gültige Krankheitsdefinition zu geben und in jedem Falle klar zwischen »noch gesund« und »schon krank« zu unterscheiden. Ein wesentlicher Kritikpunkt der psychiatrischen Klassifikationssysteme ist von daher die oftmals willkürlich erscheinende Grenzziehung. Auch hier liegen Gründe für Fehleinschätzungen und Irrtümer, denn wo die Grenzen nicht klar sind, kommt es leicht zu fragwürdigen Zuordnungen. Im folgenden Abschnitt soll es deshalb, bevor wir uns näher mit der Differenzialdiagnostik beschäftigen, um den Krankheitsbegriff im Allgemeinen und im Speziellen gehen.
1.2 Gesundheit und Krankheit
Die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) definiert 1946 in ihrer Verfassung Gesundheit als einen »Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.« (Weltgesundheitsorganisation 1946, S. 1). In diesem Sinne wäre wohl niemand über eine längere Zeit vollständig gesund, denn wann befinden wir uns schon im Zustand des völligen Wohlergehens?


Wenn wir Krankheit allein als einen Zustand des Unwohlseins begreifen, so ist diese Auffassung wenig hilfreich. Die Erfahrung von seelischem – mehr noch als körperlichem – Schmerz und Leid ist grundsätzlicher Bestandteil des Lebens und kann eine durchaus angemessene menschliche Reaktion auf widrige Ereignisse und Erfahrungen sein. Eine verbindliche Festlegung, ab wann und unter welchen Umständen welcher Grad von Unwohlsein als pathologisch zu gelten hat, ist schwierig. Umgekehrt geht Krankheit nicht immer mit subjektivem Leiden einher und selbst schwer psychisch Erkrankte, etwa Patienten mit Psychosen, leiden unter ihren Symptomen nicht immer direkt oder in dem zu erwartenden Ausmaß. Dies gilt erst recht dann, wenn die Symptomatik chronifiziert ist und der Betroffene sich gut adaptieren konnte. Leidensdruck alleine reicht also nicht aus, um Gesundheit oder Krankheit zu definieren.


Ein Krankheitsbegriff, der rein auf Normabweichung zielt, ist ebenfalls problematisch. Normen beziehen sich auf den Durchschnitt einer Population. Demgemäß würden selbst auf Dauer schädigend wirkende Faktoren ihren Krankheitswert verlieren, wenn nur ein genügend großer Teil einer Gruppe davon betroffen ist. Hat zum Beispiel der größte Teil der Bevölkerung faule Zähne, so müssten diese dieser Auffassung gemäß al...