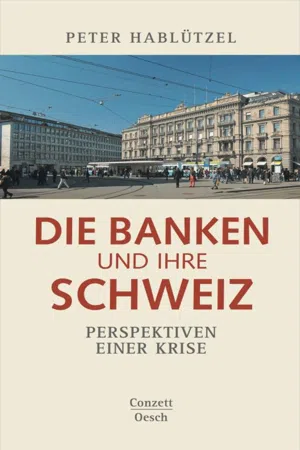![]()
1. Finanzmarktkrise, Sonderfall Schweiz und Zeitgeschichte
Die jüngste Finanzmarktkrise hat uns unsanft aufgeschreckt. Ein zyklisches Auf und Ab mit Bildung finanzieller Blasen, die plötzlich platzen, ist zwar längst nichts Neues mehr. Wer die Entwicklung der letzten zwanzig Jahre nur einigermassen aufmerksam verfolgt hat, wird bei den Turbulenzen 2007 bis 2009 kaum von einem «Schwarzen Schwan» sprechen wollen, der völlig unerwartet aufgetaucht sei (Taleb 2008). Dass der Boom auf dem amerikanischen Liegenschaftsmarkt irgendwann ein Ende haben würde, war für die meisten Beobachter klar. Dass das Platzen der Immobilienblase in den USA die Finanzmärkte global erschüttern und an den Rand des Abgrunds führen würde, war das Überraschende. Eine weltweite Systemkrise von solcher Vehemenz und mit dermassen verheerender Wirkung auf die Realwirtschaft hätte wohl kaum jemand erwartet.
Krise und Krisenwahrnehmung in der Schweiz
Die Schweiz ist von der Finanzmarktkrise besonders hart getroffen worden. Seit Ausbruch der Krise im Sommer 2007 bis Februar 2009 hat der Finanzplatz Schweiz Abschreibungsverluste von 75 Mrd. USD hinnehmen müssen. In Relation zum Bruttoinlandprodukt von 2007 sind das 17,9 Prozent, verglichen mit 5,4 Prozent für die USA oder nur 2,3 Prozent für die Bundesrepublik Deutschland. Sind wir uns dessen voll bewusst, dass die schweizerische Volkswirtschaft also gut dreimal mehr einbüsste als diejenige der USA und fast achtmal mehr als jene Deutschlands? Die Schweizer Banken haben in derselben Zeit 53,8 Prozent ihres Eigenkapitals von 2007 verloren und stehen mit dieser verheerenden Einbusse an der Spitze aller Länder (vgl. Sinn 2009, 190 und 216).
Dabei sind wir noch nicht am Ende des gefährlichen Tunnels angelangt. Im April 2009 rechnete der Internationale Währungsfonds (IWF) mit einem zusätzlichen Abschreibungsbedarf im Bankensystem von weltweit 1000 Mrd. USD; inzwischen hat der IWF seine Warnung zwar etwas abgeschwächt, aber er hat noch keineswegs Entwarnung gegeben (IMF 2009). Im Sommer 2009 schätzte auch die Schweizerische Nationalbank die Möglichkeit von künftigen Bankverlusten als sehr hoch ein. Im Dezember 2009 stellt sie einen fragilen Aufschwung fest, sieht aber immer noch ein Deflationsrisiko und will eine erneute Verschlechterung der Lage nicht ausschliessen (SNB 2009). Die Situation hat sich in der zweiten Jahreshälfte 2009 zwar etwas aufgehellt. Aber ob das Licht, das wir zu erkennen glauben, vom Tunnelausgang oder von einem entgegenkommenden Zug stammt, liess sich auch im Herbst 2009 noch nicht mit Sicherheit bestimmen (Weder di Mauro, in Avenir Suisse 2009). Und fast alle Ökonomen sind sich einig, dass wir gegenwärtig die schwerste Wirtschaftskrise seit den 1930er Jahren durchleben, deren äusserst problematische Auswirkungen auf Beschäftigung und Staatsfinanzen erst noch bevorstehen.
Die Schweiz als kleines Land gehört zu den grössten Finanzzentren der Welt. Sie ist mit sieben Billionen Franken der drittstärkste Vermögensverwalter und in Bezug auf die Verwaltung ausländischer Gelder (Offshore Banking) der weltweit wichtigste Tresor. Die Bedeutung des Bankenplatzes für die Volkswirtschaft ist in der Schweiz wesentlich höher als beispielsweise in den USA oder Grossbritannien; der ganze Finanzsektor (inkl. Versicherungen) generiert hierzulande nach den Berechnungen des Eidg. Finanzdepartements (EFD Kennzahlen 2008, 2009) einen ausnehmend grossen Anteil am Bruttoinlandprodukt (12 %), an der Beschäftigung (6 %) und am Steueraufkommen aller Staatsebenen (13 %).
Noch eine andere Eigenheit des Finanzplatzes Schweiz hat grosse wirtschaftliche und politische Bedeutung: Die Finanzindustrie ist so hoch konzentriert wie nirgendwo sonst. Die beiden Grossbanken hielten 2005 90 % der Bilanzsumme aller hiesigen Banken, was mehr als dem achtfachen Betrag der gesamten Jahreswertschöpfung der schweizerischen Volkswirtschaft entsprach (SNB 2007 429f.). Im Vergleich dazu entspricht die Bilanzsumme aller amerikanischen Banken zusammen nur gerade einem Jahres-BIP (Bruttoinlandsprodukt) der USA. Die Schweiz hat mit den zwei Grossbanken also ein gefährliches Klumpenrisiko am Hals, das sie im Falle eines GAU wohl kaum zu stemmen vermöchte. Aber die beiden sind so gross geworden, dass man sie in einer Krise auch nicht fallen lassen kann; ihre Insolvenz würde den Zahlungsverkehr lahmlegen und die ganze Volkswirtschaft erschüttern. Die UBS allein führt gut 70 000 Kontokorrentkonti von KMUs; wer möchte schon verantworten, dass sie alle die Löhne nicht mehr auszahlen könnten?
Das grosse Gewicht, der hohe Konzentrationsgrad und die Auslandverflechtung unseres Bankensystems erklären zum Teil, weshalb uns die Finanzmarktkrise besonders hart getroffen hat. Doch was ist der Grund, dass wir das Ausmass und die Bedeutung der Krise kaum zur Kenntnis nehmen wollen?
Manche Experten und die meisten Politiker schrecken davor zurück, die spezifischen Probleme unseres Finanzplatzes zu benennen. Viele zeigen erhebliche Mühe, den Stellenwert von Turbulenzen auf dem Finanzmarkt realistisch einzuschätzen. Selbst die Exekutive hat lange nicht wahrhaben wollen, in welch tiefe Krise unser Land geraten ist. Obwohl die Schweizerische Nationalbank die Lage schon 2007 als «sehr ernst» einschätzte, versuchte der Bundesrat noch am 7. März 2008 das Parlament zu beruhigen: «Der Bankensektor ist nicht gefährdet. Die weltweit tätigen Grossbanken (…) können auch schmerzhafte Verluste verkraften (…) Massnahmen zum Schutz der Schweizer Volkswirtschaft sind nicht erforderlich» (Antwort auf eine Interpellation der SP-Fraktion im Nationalrat vom 5. 12. 07). Noch im Sommer 2008 konnten das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) und das Volkswirtschaftsdepartement (EVD) in den Finanzmarktturbulenzen keine Bedrohung für die schweizerische Volkswirtschaft erkennen. Dabei hätte man die speziell hohe Anfälligkeit unseres kleinen Landes auf Krisen im globalisierten Finanzsektor längst thematisieren müssen. Selbst der Wachstumsbericht von 2008 lässt sich durch die Blasen und die scheinbar hohe «Produktivität» der Finanzwirtschaft blenden. Er ortet – gleich wie seine Vorgänger – die zentrale politische Herausforderung für die Schweiz nicht in ihrer Abhängigkeit von internationalen Märkten, sondern darin, den angeblich überbordenden Staat in die Schranken zu weisen. Durch die neoliberale Brille erscheint die Welt manchmal doch in eigenartiger Verzerrung.
Unmittelbar vor Bekanntwerden der massiven Eingriffe seitens der Behörden haben bedeutende Exponenten einflussreicher Wirtschaftsverbände die Schweiz noch als glücklichen Sonderfall gepriesen, der Staatsinterventionen im Finanzbereich nicht nötig habe. «La crise n’existe pas!», titelte die Weltwoche am 16. Oktober 2008. War das schlichte Ignoranz oder eine schlechte PR-Übung für überholte ideologische Positionen? Immerhin, die Öffentlichkeit war durch die Medien über die gefährliche Situation der Grossbanken so weit informiert, dass der Paukenschlag des staatlichen Eingriffs zwar mit einer gewissen Konsternation des Publikums, aber doch eher mit Erleichterung als mit grundsätzlicher Ablehnung aufgenommen wurde.
Mit den Beschlüssen vom 15. Oktober 2008 haben Bundesrat, Eidgenössische Bankenkommission und Schweizerische Nationalbank SNB dann doch erkennen lassen, dass sie die Probleme auf dem Finanzmarkt für gravierend und volkswirtschaftlich gefährlich halten. Dass sie deshalb ausserordentliche Massnahmen ergriffen und Notrecht in Anspruch genommen haben, will ich überhaupt nicht kritisieren. Diese Überraschungsaktion zeugt immerhin von Professionalität und einem politischen Mut, den man den Behörden nicht immer zutraut. Aber ich vermisse eine (selbst-)kritische Analyse, weshalb es zu einer solch «schweren Störung der Sicherheit» nach Art. 185 Abs. 3 der Bundesverfassung gekommen ist. Auch die gesetzliche Grundlage für das elegante Handeln der Notenbank scheint mir etwas schmalbrüstig zu sein. Nach Nationalbankgesetz Art. 5 soll die SNB zwar zur Systemstabilisierung beitragen; erlaubt sind ihr aber nur abgesicherte Hilfen bei Liquiditätsproblemen, nicht Ein griffe bei Insolvenzproblemen einer einzelnen Bank. Worum es sich im Herbst 2008 beim Fall der UBS konkret gehandelt hat, scheint zumindest fraglich.
In seiner Botschaft vom 5. November 2008 zeigt der Bundesrat wenig Bereitschaft, die tieferen Ursachen der Bankenkrise und ihre für die Schweiz ganz besonders gefährlichen Auswirkungen auszuleuchten. Noch viel weniger ist er geneigt, das Versagen der staatlichen Aufsicht offen zu diskutieren und Vorkehren in Aussicht zu stellen, die derart gravierende Fehleinschätzungen in Zukunft verhindern. Er begnügt sich mit der Absicht, das Vertrauen in das heutige Finanzsystem möglichst rasch wiederherzustellen. Verzichtet er deshalb auf die Behandlung von tiefer greifenden Fragen, die das Publikum eventuell verunsichern könnten? Oder will er nur davon ablenken, wie tief die Behörden in die Finanzmarktkrise verstrickt sind? Die Botschaft soll die Öffentlichkeit beruhigen, gut. Aber wenn man verlorenes Vertrauen wieder aufbauen will, darf man dem Publikum nicht Sand in die Augen streuen. Zwischen den Zeilen lesen wir, dass bei einer für die Zukunft gar nicht auszuschliessenden erneuten Krise eines der beiden Bankgiganten wohl wiederum Vater Staat in die Bresche springen müsste. Nicht einmal der etwas verbesserte Einlegerschutz ist so ausgelegt, dass er das Insolvenzrisiko einer Grossbank abdecken könnte.
Auch ein Jahr später zeigt man sich von Seiten der Behörden immer noch resistent gegenüber jeder Krisenperzeption, die eigene Fehler aufdecken könnte. Die FINMA, Nachfolgerin der Eidg. Bankenkommission, geht mit ihrem ausführlichen Bericht vom 14. September 2009 zu «Finanzmarktkrise und Finanzmarktaufsicht» stracks in die Vorwärtsverteidigung: Es könne «kein spezifisches Fehlverhalten schweizerischer Aufsichtsbehörden» festgestellt werden, schreibt sie (S. 14), obwohl doch gerade die Absegnung aggressiven Risikoverhaltens von überdimensionierten Grossbanken ein kleines Land wie die Schweiz in eine besonders heikle Situation bringen musste; die Eidgenössische Bankenkommission habe im Juli 2004 bloss eine risikoadäquatere Modellierung des Value at Risk, eine verbesserte Risikomessung und damit ein besseres Risikomanagement für die UBS erzielen wollen. «Diese Bewilligung ist auch rückblickend vertretbar», behauptet die FINMA unverfroren (S. 31). Aber genau diese Bewilligung hat dazu geführt, dass die UBS ihre Schulden massiv erhöhen durfte und trotz Warnungen der Nationalbank mit der weltweit tiefsten Eigenkapitalquote von 1,8% in die Finanzmarktkrise rasselte. Den Absturz hat die UBS deshalb nicht mehr aus eigener Kraft überstehen können, was sicher nicht die Absicht, aber doch eine Folge problematischer Entscheidungen auch der EBK war. Den Gipfel der Verharmlosung erklimmt das Eidgenössische Finanzdepartement mit dem Bericht vom 11. September 2009 an die WAK (Wirtschafts- und Abgaben-Kommission) des Nationalrats zu «Situation und Perspektiven des Finanzplatzes Schweiz»; es schwafelt sogar von einer «guten Kapitalisierung [der UBS] zu Beginn der Krise» (S. 22), ohne sich aber um eine einleuchtende Erklärung zu bemühen, warum die UBS von der Krise doch dermassen stark betroffen wurde. Eine ausreichend kapitalisierte Bank hätte wohl keine Staatshilfe beanspruchen müssen. Hier wird eindeutig Mitverantwortung von der Bankenaufsicht abgeschoben. Dürfen wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Behörden vertrauen, die eine Beschönigung offensichtlicher Fehlurteile für nötig halten?
Ausmass, Bedeutung und Gefahren der Finanzmarktkrise werden hierzulande nicht wirklich zur Kenntnis genommen. Man versucht hauptsächlich, die systemischen Aspekte und Zusammenhänge herunterzuspielen, und blendet die Tatsache aus, dass sich die Schweizer (Gross-)Banken mit ihren globalen Finanzgeschäften in einem ganz besonderen Masse übernommen haben. Sie sind – im Wissen und mit dem Segen der Aufsichtsbehörde – mit extrem wenig Eigenkapital versehen in die Finanzmarktkrise geschlittert und stellen damit ein Paradebeispiel für den «Casino-Kapitalismus» dar, der dank hoher Fremdfinanzierung mit riskanten, spekulativen Geschäften höchste Gewinne erzielt, massive Verluste aber weitgehend sozialisiert respektive verstaatlicht (Sinn 2009).
Das will nicht heissen, die Schweizer Behörden hätten die UBS im Herbst 2008 in den Konkurs schicken sollen. Grösse und besondere Struktur des Finanzplatzes, seine volkswirtschaftliche Funktion, aber auch seine ökonomische, juristische und politische Einbindung in globale Zusammenhänge machten eine Rettung der UBS durch den Staat wohl unausweichlich. Damit ist aber das systemische Problem noch lange nicht gelöst. Es hat sich eher noch verschärft, weil nun alle wissen, dass der Staat systemrelevante Banken nicht fallen lassen kann. Daraus resultiert nicht nur ein wettbewerbsverzerrender Konkurrenzvorteil für die Grossbanken, sondern ein geradezu perverser Anreiz, die Hochrisikospiele wieder aufzunehmen, sobald die Krise überwunden scheint. Noch wissen wir nicht, wer aus der Krise was gelernt hat. Ohne Änderungen des Finanzsystems könnten wir deshalb schon bald wieder vor derselben Problematik stehen wie im Oktober 2008.
Aber wer die Systemkrise nicht wahrhaben will, ist zu Systemänderungen kaum bereit. Oder umgekehrt: Wer das System nicht ändern möchte, muss versuchen, die systemischen Probleme möglichst auszublenden. Und genau das erleben wir heute in der politischen Debatte unseres Landes. Gegen Vorschläge, durch markante, für die Grossbanken spürbare Erhöhungen des Eigenkapitals oder durch Deckelung von Löhnen und Boni genau jene Anreize etwas abzubauen, die zum verheerenden Casino-Kapitalismus führten, tritt sofort der Finanzminister auf den Plan. Und stellt die Nationalbank für unsere Geldinstitute eine Grössenbeschränkung zur Diskussion, wehrt sich gegen derlei Ansinnen umgehend die Volkswirtschaftsministerin. Und alle Forderungen, mit einer Banklizenz für die Postfinance tragfähige Parallelstrukturen im schweizerischen Finanzierungsund Zahlungssystem aufzubauen, werden schon im Parlament beerdigt. Das schwächt den Wettbewerb und die Krisenresilienz in unserem Finanzsystem und zwingt die Post, das viele Geld der kleinen Kunden, das ihr gerade auch in kritischen Zeiten zufliesst, teilweise im Ausland anzulegen.
Sonderfall, nationale Identität und Mythenbildung
Wie kann man erklären, dass die offizielle Schweiz die tiefe Krise gar nicht richtig wahrhaben will? Warum werden die Grossbanken so geschont und gehätschelt? Lassen sich die Schweizer Behörden korrumpieren oder steht der Bankenplatz als nationales Kulturgut unter Denkmal- und Heimatschutz? Labt sich die kleine Schweiz an der schieren Grösse und an der Macht ihrer Bankgiganten? Möchten die Eliten ihr «Unbehagen im Kleinstaat» (Karl Schmid, 1963) mit weltweit geachteter (oder besser: gefürchteter) Bankenmacht kompensieren? Neben rein wirtschaftlichen Interessen scheinen jedenfalls auch psychologisch und kulturell interessante Elemente mit im Spiel zu sein. Vielleicht handelt es sich beim Finanzplatz um eine ähnlich tabuisierte Geschichte wie bei der überdimensionierten Schweizer Armee. Beide, Finanzplatz und Armee, haben eine Grössenordnung und eine Bedeutung erreicht, die sich rein aus ihrer wirtschaftspolitischen respektive sicherheitspolitischen Funktion kaum mehr rechtfertigen lassen. Beide sind zu einem nationalen Mythos verklärt worden und prägen unser Bild von der Schweiz als einem Sonderfall.
Welchen Stellenwert hat der Finanzplatz für unsere nationale Identität? Wie wichtig ist uns ein rigoroses, auch die Steuerhinterziehung begünstigendes Bankgeheimnis? Selbst wenn es die Schweiz auf dem internationalen Parkett zu einer «Hehlernation» stempelt und sie in immer grössere Schwierigkeiten bringt? Oder ist es gerade die Kritik aus dem Ausland, die uns als Nation zusammenschweisst? Was verbindet Genf und Lugano mit Zürich, Basel und St. Gallen, zum Teil sogar über Partei- und Sprachgrenzen hinweg? Was wollen der Finanzminister mit verbalen Drohgebärden und die Aussenministerin mit ihrem theatralischen Einsatz für ein wohl eher überholtes Geschäftsmodell im Schweizer Banking demonstrieren? Das Bankgeheimnis hat auf symbolischer und politischer Ebene zuweilen fast noch grössere Bedeutung erlangt, als ihm im wirtschaftlichen Kalkül der Finanzindustrie zukommt. Zwar gehört das Bankgeheimnis seit jeher zum Geschäftsmodell der Privatbanken, dem sich nun auch die Grossbanken wieder stärker anzunähern scheinen, seit ihnen das Private Banking die grössten Gewinne verspricht. Noch in den 1990er Jahren, als das lukrative Geschäft mit den institutionellen Anlegern im Vordergrund stand, konnte man den Eindruck gewinnen, dass das Bankgeheimnis für die Grossbanken nicht mehr ganz so wichtig sei.
Doch das Bankgeheimnis ist für die Schweiz längst zu einem nationalen Mythos geworden. An ihm soll nicht nur unser Land (finanziell) genesen; manche möchten damit auch das Ausland neoliberale Mores lehren, wie der Staat seine Steuerzahler zu behandeln habe. Gewisse Kreise verlangen gar, das Bankgeheimnis als Symbol der schweizerischen Unabhängigkeit auf Verfassungsstufe zu verankern. Für sie ist dieses historische Relikt aus den Dreissigerjahren zum Inbegriff für die «Swissness» geworden. Aber man kriegt den Eindruck, dieses Ansinnen sei selbst den Banken etwas peinlich. Zumal den beiden Grossbanken, die mit Patriotismus nicht mehr viel am Hut haben, seit sie sich von nationalen Institutionen zu globalisierten Finanzkonzernen gewandelt haben. Doch der nationale Mythos Bankgeheimnis hat sich auf der symbolischen Ebene gleichsam verselbständigt und erweist sich oft als stärker als nüchterne Interessenabwägung. Mythen erzeugen, wenn sie erfolgreich sind, ihre eigene Wirklichkeit.
Etwas fällt auf: Je mehr sich unsere Finanzindustrie von den Bedürfnissen der Realwirtschaft ablöst und die Schweiz in ihre riskanten Spiele auf globalisierten Märkten verwickelt, desto dreister wird die Abhängigkeit unseres Landes vom Ausland geleugnet, ja, gewissermassen politisch tabuisiert. Je mehr uns Wirtschaft, Konsumverhalten und Wissen mit Europa und der übrigen Welt eng verbinden, umso penetranter wird nicht unser Finanzplatz, sondern die Schweiz als ein «Sonderfall» zelebriert, der nur im Unterschied und als Gegensatz zum politischen und kulturellen Mainstream Europas zu verstehen sei. Damit lassen sich die Besonderheiten des schweizerischen Bankensystems, die auch aus volkswirtschaftlicher Sicht als fragwürdig erscheinen, gegen jede Kritik immunisieren. Wer unsere (Gross-)Banken in Frage stellt, stellt unser Land, stellt uns in Frage.
Spannend ist, aus welchem Geschichtsbild unsere nationalen Mythen aufzusteigen scheinen. Es ist die Abwehr gegen äussere Feinde, gegen die Arglist der Zeit, die uns zusammenschweisst. Die Schweiz ist keine Nation. Sie ist ein Konglomerat aus verschiedenen Kulturen und kleinräumigen Entitäten. Ihre Widersprüche kann sie dann am besten überwinden und zu einer Einheit wachsen, wenn sie sich von aussen bedroht fühlt. Deshalb spielt der Zweite Weltkrieg in unserem historischen und politischen Bewusstsein eine besonders grosse Rolle. Denn es gab weder vorher noch nachher eine Phase der Schweizer Geschichte, in der die Gegensätze und Konflikte zwischen deutsch und welsch, katholisch und protestantisch, ländlich und städtisch, arm und reich, oben und unten, links und rechts so gut überbrückt (und unterdrückt) werden konnten wie in dieser Bedrohungslage. Es war die grosse, die hehre Zeit für die Schweiz mit einem gemeinsamen existenziellen Ziel und mit einem Militär- und Arbeitsdienst, der sinnstiftend und identitätsbildend wirkte. Eine Zeit, in der man schon fast von einer Nation hätte sprechen können. In der Abwehr gegen das Böse und Fremde empfand man sich jedenfalls als eine Schicksalsgemeinschaft und echte «Willensnation» (vgl. Villiger 2009). Deshalb ist hierzulande noch 1989 der Beginn des Aktivdienstes 50 Jahre zuvor weit stärker gefeiert worden als 1995 das Kriegsende. Und deshalb muss auch heute noch damit rechnen, des Verrats an der Schweiz bezichtigt zu werden, wer aufzeigt, dass die Abwehr des Bösen immer auch mit Elementen der Kollaboration durchsetzt war.
Hinter dieser verklärenden Sicht der Schweiz im Zweiten Weltkrieg tauchen Bilder auf, die schon in den Dreissigerund Vierzigerjahren den Widerstandswillen festigen sollten: die Gründungssaga der Eidgenossenschaft. Es ist geradezu unheimlich, wie reflexartig im Streit um das Bankgeheimnis das Bild der fremden Vögte aufscheint. Hitler – Moskau –
Brüssel symbolisieren eine Kontinuität der Bedrohungslage. Aber dahinter stehen immer gleich 1291 und die Schlachten von Morgarten bis Sempach: Schon damals haben wir uns erfolgreich gegen fremde Ritter und Richter gewehrt, und wir werden uns auch gegen EU, G 8 und G 20 behaupten. Was uns bei diesem Gebrauch von Geschichte vielleicht doch zu denken geben sollte: In Europa benutzt neben der Schweiz einzig noch Serbien mythisch verklärte Bilder aus dem Mittelalter, um die nationale Identität zu beschwören (vgl. Marchal 2009).
Geschichte als Konstruktion der Wirklichkeit
Dieser sonderbare Regress auf Geschichten über das Mittelalter und den Zweiten Weltkrieg blendet vieles aus, was für das Verständnis und die Interpretation unserer gegenwärtigen Probleme weit wichtiger wäre. Namentlich die Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte nehmen wir kaum differenziert zur Kenntnis, wenn wir die historische Dimension unserer politischen Identität ausloten. Was hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg, seit den 1970er, den 1990er Jahren wesentlich verändert? Welche Kontinuitäten und welche Brüche beeinflussen unser Denken und Handeln? Wie hat sich die Schweiz gewandelt und wohin steuert sie heute in einem rasch sich ändernden Kontext, der die globale Interdependenz zur zentralen Herausforderung werden lässt? Da stehen doch bedeutend relevantere Fragen an als Mutmassungen darüber, ob wohl die Kriegsgurgeln der Innerschweiz vor 700 Jahren in nur scheinbar ähnlichen Situationen zur Hellebarde gegriffen hätten.
Zur Begründung des Sonderfalls Schweiz wird meist die Geschichte unseres Landes als Argument ins Feld geführt. Aber man vergisst dabei gerne, dass Geschichtsbilder die Ergebnisse von Interpretationen und damit unsere Konstruktionen sind. Wohl das gescheiteste Buch, das ich während meines Studiums in den späteren 60er Jahren gelesen habe, hiess «Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen»; der Philosoph Theodor Lessing hatte es schon 1919 publiziert. Seine Thesen nahmen Erkenntnisse des modernen Konstruktivismus vorweg und schienen mir damals revolutionär: Die Geschichte als solche hat keinen Sinn, sagt Lessing; wir müssen den Sinn in die Geschichte ...