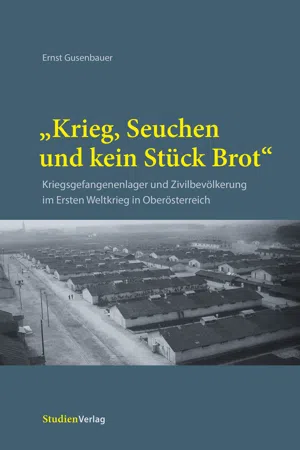![]()
Das Seuchenjahr 1915 am Beispiel des Kriegsgefangenenlagers Mauthausen
Dass Hunger, Not und Seuchen ständige Begleiter kriegerischer Auseinandersetzungen waren, davon wusste schon der griechische Schriftsteller Herodot zu berichten.136 In Gestalt apokalyptischer Reiter symbolisierten sie seit jeher die dunklen Seiten des Krieges. Vor allem Infektionskrankheiten forderten nicht nur unter den Soldaten im Feld, sondern ebenso in den Kriegsgefangenenlagern des Hinterlandes unzählige Todesopfer.137 Die Furcht vor Seuchen war auch bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs nichts Außergewöhnliches und erfasste insbesondere jene oberösterreichischen Gemeinden, die vom K. u. K. Kriegsministerium als Standorte für ein Kriegsgefangenenlager ausersehen waren.138
Als die Stadt Braunau im Mai 1915 von der Heeresverwaltung als Lagerstandort ausgewählt wurde, sprachen sich die Gemeindevertreter zunächst einstimmig dagegen aus.139 Angeführt wurden vordergründig ökonomische Bedenken wie eine weitere Verschärfung der kriegsbedingt ohnedies knappen Milchversorgung. Die Bauern glaubten, dass die guten und ertragreichen landwirtschaftlichen Gründe auf Jahrzehnte hinaus unwiderruflich verloren wären. Als das entscheidende Argument schlechthin galt jedoch die massive Bedrohung der Zivilbevölkerung durch Krankheiten und Seuchen.
Dass diese Befürchtung einen absolut realen Hintergrund besaß, wurde spätestens seit Jahresbeginn 1915 drastisch bestätigt. Infektionskrankheiten wie das gefürchtete Fleckfieber hatten in einer Reihe von oberösterreichischen Kriegsgefangenenlagern epidemische Ausmaße angenommen und strebten in Mauthausen ihrem dramatischen Höhepunkt zu.
Das Fleckfieber gehörte schon im Altertum zu den bedeutenden Kriegs- und Hungerseuchen.140 Während des Dreißigjährigen Krieges forderte es unter Soldaten und der Zivilbevölkerung gleichermaßen viele Opfer. Das alles wiederholte sich während der napoleonischen Kriege.141 Dass das Fleckfieber vorwiegend unter den ärmsten Bevölkerungsschichten grassierte, wusste man um die Mitte des 19. Jahrhunderts nur zu gut. Hunger, Schmutz und das Zusammenleben auf engstem Raum steigerten die Infektionsgefahr ins Unermessliche.142 Wenige Jahrzehnte später erhielt dann die Kenntnis der Infektionskrankheiten neue und entscheidende Impulse. 1868 wurde der Verursacher des Rückfallfiebers entdeckt, und 1880 konnten Bakterien als Erreger des Bauchtyphus identifiziert werden.143
Die moderne Bakteriologie ermöglichte den Medizinern einen klaren Einblick in das Wesen der Seuchen. Seit dieser Zeit entwickelte sich die Epidemiologie mit Riesenschritten zu einer eigenständigen Wissenschaft.144 Man konnte sich nun ernsthaft mit wirksamen Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten befassen. Die unmittelbare Ursache der Ausbreitung von Fleckfieber blieb aber noch immer ein ungelöstes Rätsel.145
Es war Charles Nicolle, der Leiter des Pasteur-Instituts in Tunis, dem die bahnbrechende Entdeckung gelang, dass die Kopfbedeckung der fleckfieberkranken Einheimischen ein wahres Reservoir für Wanzen, Läuse und Flöhe darstellte. Als auf seine Anweisung hin die Kranken bei der Aufnahme ins Spital nicht nur gebadet, sondern zugleich mit sauberer Wäsche versorgt wurden, traten schlagartig und zur Überraschung aller keine weiteren Fleckfieberfälle mehr auf.
Die Entdeckung der Rolle der Kleiderlaus als Übertragungsfaktor wurde zur entscheidenden Voraussetzung für die wirksame Bekämpfung der Krankheit.
Abb. 10: Die Kleiderlaus (pedicula vestimenti) in 40-facher Vergrößerung
Über den Verursacher selbst war im ersten Jahrzehnt vor Kriegsbeginn nach wie vor wenig bekannt. Das schien sich 1910 grundlegend zu ändern. Der amerikanische Mikrobiologe Howard W. Ricketts fand bei an hohem Fieber und Ausschlag Erkrankten kleine Mikro-Organismen, die durch Bluteinspritzung übertragen wurden. Er hielt sie für die Erreger des Fleckfiebers. Zehn Tage nach der Veröffentlichung seiner Untersuchungsberichte erfolgte jedoch der jähe Rückschlag: Der Forscher starb im Alter von nur 39 Jahren im amerikanischen Hospital von Mexiko City.
Schon vor 1914 hatte man freilich auch in Europa eine größere Anzahl von bakteriologischen Befunden zur Fleckfieberkrankheit veröffentlicht. Der am Hamburger Tropeninstitut forschende Stanislaus von Prowazek entdeckte merkwürdige Körperchen in den weißen Blutzellen von Fleckfieberkranken – und damit den wahren Verursacher.146
Viel später bürgerte sich für den Erreger die Bezeichnung Rickettsia prowazeki ein. Dies geschah einerseits zu Ehren des österreichischen Bakteriologen und würdigte andererseits den unter mysteriösen Umständen verstorbenen amerikanischen Fleckfieberforscher Ricketts.
Dennoch nahm die Krankheit während des Krieges ungeahnte Dimensionen an. Zunächst trat die Seuche in Serbien auf; die Zivilbevölkerung flüchtete aus den zerstörten oder besetzten Ortschaften, mit dem Fleckfieber als ständigem Begleiter. In sechs Monaten verloren die Serben dadurch nicht weniger als 150.000 Soldaten. Den etwa 60.000 österreichischen Gefangenen erging es kaum besser, mehr als die Hälfte fiel der Seuche zum Opfer. Auch die unter den österreichischen Truppen in Galizien ausgebrochene massive Flecktyphusepidemie verlangte hohen Tribut, zumal alle noch zu Kriegszeiten angestellten Versuche zur Herstellung eines Impfstoffes erfolglos bleiben sollten.147
In den westlichen Gebieten der Donaumonarchie war das Fleckfieber bei Kriegsausbruch praktisch unbekannt.
Hingegen trat die Erkrankung schwerpunktartig immer wieder in den östlichen Teilen Österreichs auf. Nicht nur in Galizien und in der benachbarten Bukowina kannten und fürchteten die Ärzte die Seuche umso mehr, als sie sich ihre Opfer regelmäßig auch unter den Medizinern holte.148
Da sich der Infektionsherd als äußerst widerstandsfähig erwies und Kleider, Wäsche, Bettzeug, Lagerstroh sowie andere Gegenstände oft noch Monate hindurch als verseucht galten, wurde Hygiene zum obersten Gebot erklärt. Die Inkubationszeit für Flecktyphus (ein Überstehen der Krankheit führt normalerweise zu lebenslanger Immunität) beträgt in der Regel 4 bis 14 Tage. Im Durchschnitt kommt die Krankheit aber bereits am 9. Tag nach der Ansteckung zum Ausbruch, mit jäh und unvermittelt einsetzendem Fieber, begleitet von heftigem Schüttelfrost. Die ungewöhnlich schnell ansteigende Temperatur erreichte häufig schon am ersten Abend die 41-Grad-Marke. Auf diesem Niveau blieb es dann für mehrere Tage. Der Kranke lag apathisch im Bett und ließ sich nur widerwillig ansprechen. Manchmal kamen auch Durchfälle hinzu, die wiederum in Richtung einer Ruhrerkrankung (Dysenterie) wiesen. Erschwert wurde eine genaue Diagnose vor allem dadurch, dass die ersten Symptome, Husten und Heiserkeit, einer Influenza nicht unähnlich sind. Um den 4. bis 6. Tag aber trat die entscheidende Verände-rung ein. Es wurde ein rötlicher Ausschlag aus zunächst linsengroßen, bei Fingerdruck sofort wieder verschwindenden Flecken sichtbar.
Zwischen dem 7. und 9. Tag erfolgte eine neuerliche Steigerung. Kleine Blutaustritte in den Flecken bewirkten eine markante blaurote Färbung. In dieser Phase verschlimmerten sich die allgemeinen Symptome. Halluzinationen und Delirien gehörten zum täglichen Krankheitsbild. So mancher Schwerkranke versuchte nun aus dem Bett zu steigen oder gar aus dem Fenster zu springen. In ganz dramatischen Fällen fiel der Patient ins Koma. Von entscheidender Bedeutung für einen glücklichen Ausgang waren körperliche Robustheit und ein leistungsfähiges Herz. Zwischen dem 12. und 14. Tag erreichte die Krankheit schließlich ihren Höhepunkt. Kurz vor dem Abklingen kam es noch einmal zu einem letzten und dramatischen Fieberanstieg auf bis zu 42 Grad. Der Patient fiel in einen unruhigen Schlaf, aus dem er zwar erschöpft, jedoch mit völlig ungetrübtem Bewusstsein erwachte.
Einig waren sich die Experten über die extreme Schwierigkeit eines raschen und vor allem korrekten Befunds. Bei Bauchtyphus etwa geschah der Übergang zur Fieberperiode erst mit Verzögerung. Am häufigsten kam es zur Verwechslung mit Bauchtyphus, wenn in späteren Stadien des Fleckfiebers die Delirien und Halluzinationen im Vordergrund standen. Bei Bauchtyphus trat innerhalb weniger Tage ein Ausschlag auf, der sich jedoch im Gegensatz zum Flecktyphus an anderen Stellen immer wieder neu bildete.
Auch eine Verwechslung mit Masern kam nicht selten vor, obwohl der Fleckfieberausschlag hier häufig weit blasser ist.
So war es nicht verwunderlich, dass mit Flecktyphus kaum vertraute Militärund Zivilärzte bei manchen Patienten verhängnisvolle Diagnosen stellten.
Auch das Rückfallfieber war selbst für den erfahrenen Arzt schwer vom Fleck-typhus zu unterscheiden, vor allem wegen teils nahezu identischer Symptome. Die Krankheit wurde ähnlich wie beim Fleckfieber durch einen heftigen Schüttelfrost eingeleitet, und binnen ein, zwei Stunden stieg das Thermometer bis auf 40 Grad. Delirien waren ebenso keine Seltenheit, doch in einem Punkt unterschied sich der Rückfalltyphus klar vom Fleckfieber. Die erste Fieberattacke währte wesentlich kürzer, etwa fünf bis sieben Tage. Dann erfolgte, unter heftigen Schweißausbrüchen, ein kritischer Umschwung. Das Fieber sank in wenigen Stunden wieder bis auf normale Werte. Der Kranke fühlte sich nun wieder gesund und wohlauf – allerdings nur scheinbar, denn begleitet wurde die endgültige Genesung meist von einem letzten, jähen Rückfall.149
Insgesamt musste sich die Fachwelt am Vorabend des Ersten Weltkrieges damit begnügen, den Übertragungsweg für das Fleckfieber identifiziert und mehr oder weniger brauchbare Mittel dagegen entwickelt zu haben. Eine wirksame Behandlung aber war trotz der schon weit gediehenen Forschungsergebnisse noch immer so gut wie unmöglich. Man konzentrierte sich vorerst speziell auf die Läusebe-kämpfung, doch ein dauerhaft vor Befall schützendes Allheilmittel fehlte.150 Empfohlen war z. B. seidene Unterwäsche, doch wie sollten diese teuren Produkte bei den Soldaten im Feld oder bei der größtenteils wenig kaufkräftigen Bevölkerung massenhaft Verbreitung finden? Dann wiederum empfahl man zur Läuse-Abwehr stark riechende Essenzen: äthe...