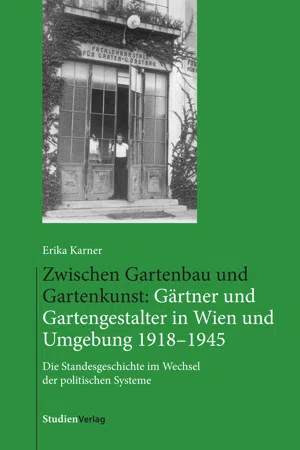![]()
1 Einleitung: Zielsetzung und Abgrenzung
Ziel dieser quellenbasierten Grundlagenarbeit ist es, den bisher nur spärlich untersuchten Zeitabschnitt von 1918 bis 1945 der Geschichte des österreichischen Gartenbaus – speziell in der Berufsgruppe der Gartenarchitekten, Landschaftsgärtner, Gartengestalter und Gartentechniker – näher zu beleuchten und im Kontext der österreichischen Zeitgeschichte darzustellen.
Am Beispiel von Verbänden, Schulen, Betrieben und Personen soll der Frage des Einflusses der politischen bzw. ideologischen Machtapparate auf die Berufsgruppe nachgegangen werden.
Ein weiteres Anliegen dieser Arbeit ist es, Datenmaterial, Archivbestände und Informationen aufzubereiten und die daraus gezogenen Erkenntnisse einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
1.1 Die Forschungsfrage
Die Zeit von 1918 bis 1945 war geprägt von massiven politischen, sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen. Diese Umwälzungen hatten direkte Auswirkungen auf den Gartenbau und die Berufsgruppe der Gartenarchitekten, Gartengestalter und Landschaftsgärtner.
Die Spannungen zwischen den etablierten politischen Lagern der Christlich-Sozialen und Sozialdemokraten und das ungleiche Kräfteverhältnis zwischen „schwarz“ regierten Bundesländern und „rotem Wien“ traten auch innerhalb der Berufsvertretung der Gärtner zutage. Die Hinwendung Österreichs zum Faschismus hinterließ ihre Spuren und der „Anschluss“ an das Deutsche Reich 1938 hatte ebenfalls deutliche Auswirkungen auf den Berufsstand.
Die daraus abzuleitende Frage lautete: Welche Auswirkungen hatten die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Veränderungen auf den Gartenbau und die Berufsgruppe der Gartenarchitekten?
Um die These zu verifizieren, war es nötig, einzelne Themenbereiche zu definieren und genauer zu beleuchten. Die Fragen in diesem Zusammenhang lauteten:
• Wie war der Berufsstand der Gärtner organisiert?
• Wie war die gärtnerische Ausbildung geregelt?
• Gab es im Untersuchungszeitraum dominierende berufspolitische Themen?
Einzelne Fragen, die sich in diesem Zusammenhang mit der Berufsgruppe der Gartenarchitekten, Gartengestalter und Landschaftsgärtner stellten und halfen, die These zu verifizieren, lauteten:
• Wer durfte sich Gartenarchitekt nennen, und wie waren diese Personen ausgebildet?
• Welche Gartenarchitekten waren zu dieser Zeit aktiv tätig?
• Wie sehr änderte sich das Aufgabengebiet der Gartengestalter und Gartenarchitekten durch die Republikgründung 1918?
• Wie war die Berufsgruppe der Gartenarchitekten, Gartengestalter und Landschaftsgärtner organisiert?
• Waren Frauen in der Berufsgruppe der Gartenarchitekten, Gartengestalter und Landschaftsgärtner vertreten und falls ja, wie sah ihre Ausbildung und berufliche Organisation aus bzw. welche Auswirkungen hatten die politischen Wechsel auf ihre Präsenz im Berufsstand?
1.2 Abgrenzung zu anderen Forschungsbereichen
Die Arbeit beschränkt sich räumlich auf Wien und Umgebung und zeitlich auf die Periode von 1918 bis 1945, auch wenn es hin und wieder Bezüge zu den anderen Bundesländern bzw. dem gesamten Bundesgebiet und auf Zeiträume davor oder danach gibt.
Auch inhaltlich gibt es Grenzen. Es wurden nur jene Personen näher untersucht, die im Raum Wien bzw. in Österreich, also innerhalb der heutigen Staatsgrenzen, geboren wurden oder hier arbeiteten. Personen, die aus dem Gebiet der k. u. k. Monarchie außerhalb der heutigen Staatsgrenzen stammten, wurden nur dann einbezogen, wenn sie in Wien tätig waren.
Eine Kontextualisierung mit gartenbaulichen Entwicklungen in Deutschland und den neu errichteten Staaten auf dem ehemaligen Gebiet der Habsburger-Monarchie innerhalb des Untersuchungszeitraums findet in dieser Arbeit nur am Rande und in Ansätzen statt, da der Fokus ganz auf der Entwicklung in Österreich/Wien liegt.
Forschungsfragen, die einzelne Gärten oder Parks, den künstlerischen Wert einzelner Planungen, die Verbindung zu neuen architektonischen Richtungen oder den Einfluss von künstlerischen Strömungen des Untersuchungszeitraums auf die Gartengestaltung betreffen, werden hier nicht behandelt.
Eine Analyse und umfassende Interpretation des Stoffes nach einzelnen Aspekten ist aufgrund beschränkter zeitlicher und finanzieller Ressourcen nicht möglich und schafft daher Raum für zukünftige Forschungsprojekte.
1.3 Forschungsstand im Überblick
Der Forschungsstand4 in Österreich zum Thema ist leicht überschaubar. Ein umfassendes Werk, das diese Zeit beschreibt, liegt bis dato nicht vor.
Österreichische Gartenbauvereine und -institutionen befassten sich bislang wenig bis gar nicht mit ihrer Geschichte. Die „Österreichische Gesellschaft für Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur“, eine „Nachfahrin“ der „Vereinigung österreichischer Gartenarchitekten“, verfasste 2012 eine Festschrift anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens mit einem kurzen Beitrag über die historische Entwicklung, eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte fehlte jedoch.
Die theoretische Auseinandersetzung mit Gartenbau und Gartenarchitektur in Österreich zwischen 1918 und 1950 setzte an den Universitäten relativ spät, um 1990, ein und beschränkt sich auf einige wenige Arbeiten. Es gibt einige Diplomarbeiten, die sich durchwegs mit Einzelpersonen und deren Werk befassen, diese gehen aber über biografische Angaben und Werkbeschreibungen nicht hinaus. Eine Einordnung der Personen und Werke in soziale und politische Kontexte fehlt.
Lieselotte Strohmayr schrieb 1990 an der Universität für Bodenkultur eine Diplomarbeit über Albert Esch und seine privaten Gartenanlagen. Ebenfalls 1990 wurden von Edgar Kohlbacher und Karl Gottfried Rudischer Diplomarbeiten über Josef Oskar Wladar und sein Werk bis 1950 vorgelegt. Diese wurden zusammengefasst und erschienen in der Schriftenreihe des Institutes für Landschaftsplanung und Gartenkunst an der TU Wien. Auch ihre Beiträge beschäftigen sich ausschließlich mit Planungen von Josef Oskar Wladar.
1991 erarbeiteten Maria Auböck, János Kárász und Stefan Schmidt eine, leider nie veröffentlichte, umfangreiche Studie zu den Wiener Wohnhausanlagen der Zwischenkriegszeit „Die Freiräume der Wiener Wohnhausanlagen 1919–34. Gestern und Heute“. Sie beschäftigt sich mit dem kommunalen Wohnbau in Wien, entwickelt eine Freiraumtypologie und beschreibt anhand von fünf Fallbeispielen die Planungsgeschichte, Entwurfsbausteine, den damals aktuellen Pflegestand und das Nutzungsbild der Wohnhausanlagen. Ein Exemplar der verschollen geglaubten Studie konnte von Eva Berger aufgespürt werden und befindet sich seit 2014 in der Bibliothek des Institutes für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen an der TU Wien.
Barbara Bacher legte 1994 am Institut für Landschaftsgestaltung der Universität für Bodenkultur ihre Diplomarbeit über Gartengestaltung in Deutschland und Österreich zwischen 1919 und 1933/38 vor.
Judith Formann verfasste 2002 an der Universität für Bodenkultur eine Diplomarbeit, die die Geschichte der Landschaftsplanung in Österreich vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart zum Gegenstand hatte, und 2004 schrieb Gudrun Schneider an der Uni Wien ihre Diplomarbeit über „Freiraumgestaltung, Siedlungsgrün und Gartenbaukunst in Deutschland und Wien 1938–1955“.
Es gibt architekturhistorische Arbeiten, die am Rande auch Gartenarchitektur und Gartengestalter erwähnen. Eine dieser Arbeiten ist die von Iris Meder im Jahr 2004 vorgelegte Dissertation „Offene Welten. Die Wiener Schule im Einfamilienhausbau 1919–1938“.
Am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien lief von Jänner 2007 bis Ende 2010 ein Forschungsprojekt, das von Corinna Oesch bearbeitet wurde und sich mit dem Leben von Yella Hertzka beschäftigte. Yella Hertzka war auch Untersuchungsgegenstand bei Elisabeth Malleier, die 2001 in einer unveröffentlichten Forschungsarbeit für das österreichische Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr, Arbeitsbereich Gender Studies, zum Thema „Jüdische Frauen in der Wiener bürgerlichen Frauenbewegung“ arbeitete.
Eva Berger publizierte mehrere Artikel über Albert Esch, Hartwich & Vietsch und Josef Oskar Wladar, und Brigitte Mang veröffentlichte im Jahr 2000 einen Beitrag über Viktor Mödlhammer in der Fachzeitschrift „Historische Gärten“.
1994 veranstaltete die Österreichische Gesellschaft für historische Gärten eine Tagung zum Thema „Gartenkunst des Jugendstils und der Zwischenkriegszeit“. Die Tagungsbeiträge wurden 1995 in der Zeitschrift „Die Gartenkunst“ veröffentlicht. Danach beschäftigte sich längere Zeit niemand mit diesem Zeitraum.
Am Institut für Landschaftsarchitektur der Universität für Bodenkultur gab es laut Forschungsdatenbank, im Zeitraum vom 2. Jänner bis 23. März 2007 ein Projekt zum Thema Austrofaschismus: „Entwicklung der Profession in Österreich zwischen 1934 und 1938“. Die Ergebnisse wurden, soweit bekannt, nicht veröffentlicht.
Am selben Institut wurde von Juni 2008 bis Ende Mai 2010 ein Forschungsprojekt zum Thema „Landschaftsarchitektur in Österreich zwischen 1912 und 1945“ abgewickelt. Die Projektmitarbeiterinnen Iris Meder und Ulrike Krippner hielten dazu einige Vorträge und im Juni 2010 erschien ein Artikel in der Zeitschrift „Zoll+“ sowie ein weiterer im November 2010 in der Zeitschrift „Die Gartenkunst“; Barbara Bacher publizierte im Rahmen dieses Projektes einen Artikel in der Zeitschrift „Historische Gärten“. Im Dezember 2010 gab es eine Veranstaltung mit Vorträgen der drei Projektmitarbeiterinnen. Sie präsentierten Ergebnisse ihrer Arbeit. Die Inhalte ihrer Vorträge waren nahezu ident mit denen der bereits veröffentlichten Artikel. Barbara Bacher publizierte 2011 einen weiteren Artikel zum Thema „Beruf: Gartenarchitekt, Gartenarchitektin“ in der „Zeitschrift für historische Gärten“. Eine umfassende Veröffentlichung der Forschungsergebnisse lag bis zum Ende der Abfassung dieser Arbeit nicht vor.
Anja Seliger, bis 2014 beschäftigt am Institut für Landschaftsarchitektur der Universität für Bodenkultur, arbeitete an einer Dissertation über Josef Oskar Wladar die neben der Einordnung seiner Werke in das historische Umfeld auch ein Werkverzeichnis mit einer dazugehörigen digitalen Datenbank enthalten sollte.5 Die Arbeit wurde bis dato noch nicht vorgelegt.
Ein weiteres diesem Themenfeld zugeordnetes Forschungsprojekt dieses Instituts mit dem Titel „Frauen in der Landschaftsarchitektur in Österreich und Zentraleuropa“ startete im Dezember 2011 und endete im Februar 2014. Eine umfassende Veröffentlichung dieser Forschungsergebnisse lag bis zum Ende der Abfassung dieser Arbeit ebenfalls nicht vor. Ulrike Krippner und Iris Meder veröffentlichten weitere Artikel in in- und ausländischen Medien in Anlehnung an die bereits erschienen. Sie beschränkten sich in ihren neuen Publikationen auf die mittlerweile bekannten jüdischen Frauen und deren Milieu. Sie verabsäumen es jedoch deren Tätigkeiten oder beispielsweise den von ihnen verwendeten Begriff „Gartenarchitektin“ – (es wird darauf verwiesen, dass von 1900 bis 1930 dieser Begriff, der vorrangig verwendete war, wie sie zu dieser Annahme kommen wird nicht näher ausgefü...