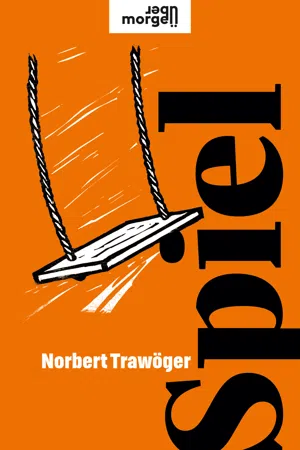![]()
Mein Großvater und der Elch
In den späten 1990er Jahren begegnete ich in einem schwedischen Wald meinem ersten Elch. Er erinnerte mich überraschend an meinen längst verstorbenen Großvater, der mit Sicherheit nie ein Hirschtier dieser Art gesehen hatte, da es in seinem Hausruckviertler Wald nicht vorkommt. Seinen Vierkanthof, in dessen Schatten ich aufgewachsen bin, hat der Kleinbauer in seinen mehr als acht Jahrzehnten Lebenszeit selten verlassen. Sonntags war er in der Messe, im Herbst auf der Landwirtschaftsmesse im nahen Wels, und als aufrechter Katholik reiste er einmal nach Rom. Opa akzeptierte das Ausmaß seines Territoriums und bewirtschaftete die überschaubaren Felder rund um seinen Bauernhof, die er von seinen Eltern als Erbe anvertraut bekommen hatte. Sein Spielraum strebte nicht nach Grenzerweiterung. Das Gegebene wurde angenommen und die Möglichkeiten wurden darin gefunden. Am Tag wurde gearbeitet, in der Nacht gelesen. Nur vier Jahre Schulausbildung hinderten ihn nicht, sich lebenslang umfassend zu bilden. Er bewahrte sich viel von der kindlichen Unschuld, mit der wir ins Spiel kommen. Das, was da ist, was einem anvertraut wurde, reicht. Vertrauen ist kein Recht, sondern ein Privileg, das es zu achten gilt. Um nicht zu verklären, muss ich aufklären, dass er als mit Abstand jüngstes von vielen Geschwistern gar keine andere Wahl hatte, als die kranke Mutter zu pflegen und den Hof zu übernehmen. Es bewahrte ihn vor einem Soldatendasein, während die meisten seiner Brüder auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs ihr Leben ließen und seine Schwestern die Höfe für ihre eingezogenen Ehemänner führten.
Als ich den Elch in seinen markant rhythmisch-geschmeidigen Bewegungen an mir vorbeilaufen sah, weckte das in mir ein Bild meiner Kindheit, über das ich nie zuvor nachgedacht hatte: mein Großvater beim Mähen mit der Sense. Ein Motormäher war seit den 1970er Jahren vorhanden, aber dessen Verwendung überließ er seinem Sohn, dem Hoferben, und legte stattdessen Hand an. Er, der selbst bei der Arbeit immer ein weißes Hemd trug, brachte sich mit seiner Sense in Schwingung und schwang das Sensenblatt im größtmöglichen Radius vor sich hin und her. Das Messer schwebte so knapp wie möglich über dem Boden und kürzte die Grashalme. Der Bewegungsablauf zeugte von selbstverständlicher Beiläufigkeit, von hochkonzentrierter Eleganz, das erhobene Haupt, das Drehen um die eigene Körperachse, die leicht angewinkelten Knie verbunden mit den Schrittfolgen von Stand- und Spielbein. Die Sense war sein Instrument, das er beherrschte wie ein Geiger seine Geige. Der albanisch-amerikanische Fotograf Gjon Mili (1904–1984) experimentierte mit Mehrfach- oder Langzeitbelichtungen und machte damit Bewegungsabläufe sichtbar. Berühmt geworden ist eine Fotoserie, die 1952 im Magazin LIFE erschien und die runden Spielbewegungen des Geigenbogens von Jascha Heifetz im Dunkeln sichtbar machte. Mili ließ auch Pablo Picasso mit Licht malen. Dabei werden Pinselstriche zu einem Oszillografen einer wunderbaren Augenmusik, in der jede Bewegung harmonisch ist.
Und zum Zusammenhang zwischen Körper und Bewegung kommt mir Andreas Vesalius12 in den Sinn. Der flämische Anatom und Chirurg der Renaissance gilt als Begründer der neuzeitlichen Anatomie und des morphologischen Denkens in der Medizin. Der Leibarzt Kaiser Karls V. und König Philipps II. von Spanien verfasste das erste Anatomiebuch der Menschheitsgeschichte. Darin sind kunstvolle Skelettabbildungen in allen möglichen Haltungen zu sehen, die in ihrer stimmigen Ganzheitlichkeit faszinieren.
In diesem körperlichen Zusammenspiel aller Knochen gab es keinen überflüssigen Schlenker. Es stimmt alles, wie bei meinem mähenden Großvater, der offenkundig ein Virtuose der Sense war. Die Ästhetik und Stimmigkeit dieses Vorgangs machte mir mein erster Elch schlagartig klar. Mein Großvater hatte die Leichtigkeit und Virtuosität eines Könners. Trotz stundenlanger Arbeit bei hochsommerlichen Temperaturen war er ein Schwimmer, der Zug um Zug das Grün seiner Wiesen durchzog.
Der Gipfelpunkt allen Bemühens ist die scheinbare Mühelosigkeit. Es liegt keine Hast darin. Das Hin und Her war wie ein Ein- und Ausatmen, das ein sanftes, in seiner stetigen Wiederkehr beruhigendes Schneidegeräusch erzeugte. Diese großväterliche Könnerschaft in Haltung, Bewegung und Tun kam mir in einem schwedischen Wald ins Bewusstsein und wirkt seitdem auf mich und mein Flötenspiel. Ein- und Ausatmen, Spiel- und Standbein, die Flöte umarmend, aus der Körpermitte spielend.
Seitdem und durch langjährige Körperschulung bei der legendären Burga Schwarzbach (1921–2003) hat sich meine Wahrnehmung von Bewegungsabläufen und Haltungen geschärft. Ich beobachte, wie Musiker*innen die Bühne betreten, bevor sie zu spielen beginnen. Wie werden sie und ihre Instrumente klingen? Keine große Geigerin schleppt sich mit hängenden Schultern oder schiefem Kopf auf die Bühne. Haltung und Körperbewusstsein sind für Klang und Virtuosität notwendig. Haben Sie schon beobachtet, warum manche Menschen selbst auf übervollen Straßen nicht angerempelt werden? Sie wirken ohne Blinklicht oder sonstige Warnzeichen wie Moses, teilen nicht Wasser-, sondern Menschenmassen und bahnen sich, ohne sprechen zu müssen, einen störungsfreien Weg. Man spricht von Charisma. Mein Großvater ist vielen Menschen als sehr großer, aufrechter Mann in Erinnerung. Was bemerkenswert ist, da er – mehr als zehn Zentimeter kleiner als ich heute – von nur durchschnittlicher Körpergröße war.
Wenn Handgriffe mehr als nur gelernt sind, Abläufe geläufig sind, sie in ein ganzheitliches, körperliches Bewusstsein eingehen, kann sich die Beiläufigkeit des Spielerischen einstellen. Die Beiläufigkeit einer Geläufigkeit ist die Grundvoraussetzung, um ins Virtuose zu gelangen. Was interessieren mich die handwerklichen Herausforderungen einer Geigerin, eines Tischlers, wenn ich Musik hören oder einen stabilen Tisch haben will? Nicht jede*r Handwerker*in ist eine Kunstschaffende. (Auch nicht jeder Geiger, aber das ist ein anderes Thema.) Der Sensenmähende gibt auf der grünen Wiese keine Ballettaufführung. Die spielerischen Vorgänge treffen sich im Verschmelzen und Verschwinden der Grenzen zwischen Körper, Geist, Instrument oder Werkzeug und Austragungsort. Der Unterschied liegt in der Absicht. Ein Konzert ist kein unmittelbarer Vorgang zur Futterbeschaffung, hingegen kann beides zur Pflege einer Kulturlandschaft gezählt werden.
Ich denke an den Straßenkehrer einer nahen Bezirksstadt meines Heimatortes, den ich erst spät in seinem sanft poetischen Fegen der Gehsteige registrierte. Ein zarter Mensch, der eine große Güte ausstrahlte und vermutlich nicht zufällig zu besonderen Anlässen Mundartgedichte verfasste und vortrug. Er begriff die Räume, in denen er tätig war, unabhängig von der Art des Tuns, als die Austragungsorte seiner Poetik.
Toni Sailer (1935–2009), der mit seinen drei olympischen Goldmedaillen und sieben Weltmeistertiteln zu den erfolgreichsten Skirennläufern Österreichs zählt, wurde in einem Interview gefragt, was der Grund für seine Schnelligkeit sei. Er antwortete mindestens so verwundert wie meine Tochter auf meine Eingangsfrage in breitem Tiroler Dialekt: „Da muast en Schi afoch laffn låssn!“ Nicht einmal über seine Antwort musste er nachdenken. Sie lief heraus. Sailer benannte das Laufenlassen, das Zulassen, das Hingeben als sein Erfolgsrezept.
Er erwähnte nicht, dass zum Erreichen eines Weltklasseniveaus Talent und, laut Studien13, ein kritisches Minimum an Zeit von mindestens 10.000 Trainingsstunden notwendig sind. Was erforderlich macht, im frühesten Kindesalter anzufangen, um so viel wie möglich üben und trainieren zu können. Dies gilt für Sportler, Musikerinnen, Maler, Artistinnen, Tanzende oder Akrobaten gleichermaßen. Der Schwerkraft entkommt man so wenig wie dem Talent, das erst recht geübt werden will. Es gibt viel zu tun, bis es läuft, um es laufen lassen zu können. Ausdauer, Frustration, Druck, Verletzungen physischer oder psychischer Art sind dabei Schlagworte im wahrsten Wortsinn. Es geschehen zu lassen bedingt nicht nur Loslassen. Lassen braucht Übung: Stille, Fokussierung, Hingabe, Fließen, Wachheit, Versenkung, Sammeln, Einatmen, Ausatmen, Ausbruch, Ausdruck und wieder Stille, wobei letztere in Sailers Fall durch die Jubelstürme im Ziel überdeckt wurde.
Dort und nicht nur da unterscheidet sich der Sport von der Kunst, die Resultate sind andere. Sailer beschreibt das Paradoxon von beabsichtigter Absichtslosigkeit: zweckgerichtete Zweckfreiheit nennt sie der amerikanische Musikerfinder John Cage. Alles richtet sich auf den einen Moment, wie der Bogenschütze auf das Loslassen des Pfeils. Zielgerichtete, indeterminierte Freiheit. Ein Akt größter Selbstvergessenheit, ein Aufgehen im Abgehen, höchstes Dasein im Wegsein. Das Handwerk, das man sich dafür unabdingbar anzueignen hat, muss man im Moment des Laufenlassens liegen lassen. Oft und ewig geübt, um letztlich aus der Übung zu sein. Cage schreibt in seiner „Unbestimmtheit“: „Künstler sprechen viel über die Freiheit. Den Spruch ‚frei wie ein Vogel‘ im Sinn, ging Morton Feldman eines Tages in den Park und verbrachte einige Zeit damit, unsere gefiederten Freunde zu beobachten. Als er zurückkam, sagte er: ‚Wusstest du, dass sie nicht frei sind? Sie kämpfen um jeden Brocken Brot.‘“14
Mein Großvater verstand sein Handwerk. Wie hat er dieses erlernt, das weit mehr als nur das Mähen mit der Sense umfasste? Haben es ihm sein Vater, seine älteren Brüder gezeigt? Hat er es vom Zuschauen gelernt? Vielleicht war er einfach ein Bewegungstalent und hat es sich selbst beigebracht? Körperliche Arbeit ist heute nur mehr dort nötig, wo keine Maschinen zum Einsatz kommen können: auf schwer erreichbaren Baustellen, Bergbauernhöfen oder in Orchestern. Wer körperlich arbeitet, muss danach trachten, sich die Kräfte einzuteilen. Ökonomischer Einsatz von Mitteln verspricht aber per se noch keine Eleganz. Sein Handwerk zu verstehen heißt zu wissen, wie man sich bewegt. Wir brauchen vielen Bewegungsabläufen nicht mehr auf der Spur zu sein: einen Schalter umzulegen, einen Knopf zu drücken erfordert weder sonderliche physische Könnerschaft noch Krafteinsatz. Wir verlernen damit Bewegungsarten und Körperbewusstsein. Stattdessen fahren wir mit dem Auto zum Fitnesscenter und lassen uns in Geräte einspannen, um fit zu bleiben.
Ich hatte das pure Kindheitsglück, im Umfeld des großelterlichen Bauernhofs aufzuwachsen. Abgesehen davon, dass das Gelände zum Freilaufen und für Spiele aller Art vorhanden war, wurden wir auch freigelassen und kehrten erst abends hungrig wieder ins Elternhaus zurück. Meinen Kindern würde ich dies gar nicht mehr zutrauen. Die Gefahren lauern überall und sind definitiv mehr geworden. Wir streiften durch die Wälder, bauten uns unter Anleitung des Großvaters Bogen und Pfeile, führten Bandenkriege oder machten in den Ferien tagelang Radtouren auf den noch nicht asphaltieren Schotterstraßen. Ein Knie war immer wund. Wir bewegten uns in unserem Raum.
Mein Großvater wäre sicher verwundert über meine Gedankenspiele. Am Sonntagnachmittag lief bei meinen Großeltern meistens der Fernsehapparat. Wenn das Programm nichts anderes hergab, wurden Formel-1-Rennen geschaut. Eines Tages fragte der Großvater hörbar, ohne eine Antwort zu erwarten: „Mich wundert, dass der Niki Lauda bei dem ewigen Im-Kreis-Fahren nicht kopfdamisch wird.“ Motorisierung hielt er ja schon beim Gras...