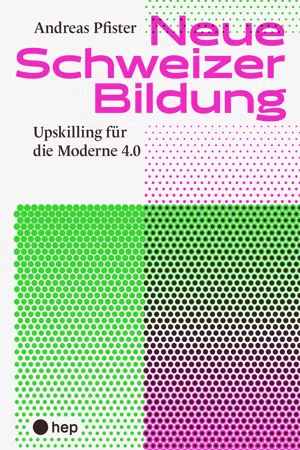
- 280 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
About this book
Dieses E-Book enthält komplexe Grafiken und Tabellen, welche nur auf E-Readern gut lesbar sind, auf denen sich Bilder vergrössern lassen.Strukturwandel, Digitalisierung, Industrie 4.0 – die Arbeit und die Gesellschaft sind im Wandel. Um hier mithalten zu können, gilt es, das Schweizer Bildungssystem auszubauen und voranzubringen. Dieses Buch präsentiert Vorschläge, wie das Potenzial der Jugendlichen besser gefördert werden kann: Berufs- und Fachmaturität als neuer Standard, mehr Jugendliche an die Gymnasien, tertiäre Bildung ausbauenNur gemeinsam können der duale und der akademische Bildungsweg die Schweizer Bildung auf ein neues Niveau heben, mehr Fachkräfte bereitstellen und Jugendliche befähigen, den Wandel aktiv mitzugestalten.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Neue Schweizer Bildung (E-Book) by Andreas Pfister in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Education & Education General. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
1 Skizze
Neue Schweizer Bildung
Die Schweizer Bildung wird auf ein neues Niveau gehoben.
- Wir schreiben das Jahr 2030. Die Berufsmaturität wurde flächendeckend eingeführt. Ihre Quote beträgt 50 Prozent, die der gymnasialen Maturität 30 Prozent, jene der Fachmaturität 10 Prozent. Der Anteil Abschlüsse für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, z.B. Berufsatteste, beträgt ebenfalls 10 Prozent.
- Im Jahr 2050 liegen die gymnasiale Maturität einerseits und die Berufs- und Fachmaturität andererseits gleichauf. Ihre Quoten betragen je knapp 50 Prozent. Die Tertiärquote beträgt 75 Prozent.
- Die Schweizer Bildung hat eine Governance, die sowohl den dualen als auch den akademischen Weg umfasst.
Die Berufsmaturität wird fester Bestandteil der neuen Lehre.
- Das Zentrum der Bildungsreform stellt die Berufsmaturität dar.
- Es wird eine Maturitätspflicht eingeführt. Die Sekundarstufe II gehört neu zur obligatorischen Bildung.
Es gibt eine Binnendifferenzierung in die Niveaustufen A und B.
- Innerhalb der Berufsmaturität gibt es eine Binnendifferenzierung in ein Niveau A und ein Niveau B. Niveau A fokussiert auf die Vorbereitung für die Fachhochschule, Niveau B auf die erweiterte Allgemeinbildung und das lebenslange Lernen.
- Ziel der Berufsmaturität Niveau B ist die Stärkung der schulischen Kompetenzen innerhalb der Berufslehre. Tertiäre Bildung kann, muss aber nicht daran anschliessen.
- BM-Lernende mit Niveau B erlangen ebenfalls die Berechtigung zum Fachhochschulstudium. Ein Vorbereitungskurs verbessert den Studienerfolg.
Duales Lernen wird weiterentwickelt.
- Denkbar ist ein BM-Schuljahr vor Lehrbeginn.
- Dieses Modell einer BM3 hat weitreichendes Potenzial zur Neugestaltung der Sekundarstufen I und II.
Das Modell BMX bringt mehr Flexibilität.
- Das Zusammenspiel von berufspraktischer und schulischer Bildung wird weiter flexibilisiert. Idealerweise findet die schulische Bildung in Blöcken während der gesamten Dauer der Lehre statt.
- Um die Doppelbelastung durch die Berufsmaturität zu mindern, braucht es eine Reduktion der Arbeit im Betrieb und/oder eine Verlängerung der Lehre wie in der BM2. Die Ausbildungsdauer wird verbundspartnerschaftlich mit den Organisationen der Arbeit neu geregelt.
- Die Reform der Sekundarstufe II ist offen für eine stärkere Vereinheitlichung der Sekundarstufe I. Sie setzt diese aber nicht voraus, sondern kann auf den bisherigen Strukturen aufbauen.
Ausbilden ist ein Dienst an der Gesellschaft.
- Viele Betriebe verstehen das Ausbilden als Pflege ihrer Zunft und als Dienst an der Gesellschaft.
- Gleichzeitig lohnt sich für sie das Ausbilden von EFZ-Lernenden.
An der Berufsmaturität verdienen die Betriebe nicht.
- Da die BM1-Lernenden mehr fehlen im Betrieb, ist ihre Rentabilität geringer.
- Die Betriebe stehen beim Ausbilden im Zielkonflikt von kurzfristiger Rendite und langfristigen Interessen.
Betriebe erhalten ein Lehrgeld.
- Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bremsen viele Betriebe die Entwicklung der Berufsmaturität, denn an BM-Lernenden verdienen sie kurzfristig nicht.
- Bis 2030 wird ein staatliches Lehrgeld für Betriebe, die BM-Lernende ausbilden, eingeführt. Dieses Lehrgeld wird über die Steuern erhoben.
Die gymnasiale Maturitätsquote soll bis 2030 auf 30 Prozent steigen.
- Nach einem Vierteljahrhundert der Stagnation soll der akademische Weg zum Wachstum zurückkehren.
- Die Gymnasialquote soll jährlich um einen Prozentpunkt steigen, bis sie 2050 die Hälfte aller Abschlüsse ausmacht.
- Die Öffnung des akademischen Wegs eröffnet neue Chancen für sozial benachteiligte Jugendliche.
Die Schweizer Bildung wird auf ein neues Niveau gehoben.
Der erste Schritt auf dem Weg zu mehr tertiärer Bildung ist eine Erhöhung aller drei Maturitätsquoten. Das Buch «Matura für alle»[1] hat diesen Vorschlag 2018 erstmals formuliert. Die gymnasiale Maturitätsquote soll erhöht und die Berufsmaturität flächendeckend eingeführt werden. Auch die Fachmaturität soll ausgebaut werden. Im Jahr 2030 soll die gymnasiale Maturitätsquote 30 Prozent betragen, Tendenz steigend. Die Berufsmaturität soll bis zum Jahr 2030 fester Bestandteil der neuen Lehre werden und ihre Quote soll 50 Prozent betragen. Die Fachmaturitätsquote beträgt dann 10 Prozent. Auch knapp 10 Prozent beträgt der Anteil Abschlüsse für Personen, die besondere Förderung brauchen, etwa Berufsatteste. Bis ins Jahr 2050 soll das Verhältnis der gymnasialen Maturitätsquote einerseits und der Berufs- und Fachmaturitätsquote andererseits etwa im Gleichgewicht sein. Es soll je knapp 50 Prozent betragen.
Die Skizze eines neuen Schweizer Bildungssystems, die hier gezeichnet wird, berücksichtigt die Schweizer Besonderheiten und entwirft eine massgeschneiderte Lösung für unser Land. Sie ist, wie wir das hierzulande schätzen, pragmatisch. Der erste Schritt auf dem Weg zu einer neuen Bildungsinitiative kann ganz unauffällig aussehen, typisch schweizerisch. Es braucht keine Pauken und Trompeten. Es braucht keine Kehrtwende, kein plötzliches Herumwerfen eines Steuers. Es geht darum, auf bestehende Strukturen aufzubauen. Der Ausbau des dualen Wegs seit den Neunzigerjahren ist bereits der eigentliche Anfang. Es gilt, künftig wieder beide Bildungswege, den akademischen und den dualen, gemeinsam zu fördern.
Was derzeit fehlt, ist eine übergeordnete Perspektive auf die Bildung auf struktureller Ebene. Die meisten Protagonist*innen, welche die Schweizer Bildungspolitik gestalten, gehören ins eine oder andere Lager, entweder ins duale oder ins akademische. Sie ermahnen die Exponenten des jeweils anderen Lagers, sie möchten doch bitte das eine nicht gegen das andere ausspielen. Wirklich ändern wird sich erst etwas, wenn die beiden Lager, die sich derzeit fremd sind, in eine übergeordnete Struktur zusammengeführt werden. Erst ein solches übergeordnetes Gremium kann die verschiedenen Partikularinteressen vertreten, gleichzeitig relativieren und ausgleichen. Es hält die Konkurrenzsituation zwischen den Bildungswegen aus und hebt sie in sich auf. Es gewährt keinem Weg einen Vorrang vor dem anderen und überlässt keiner Seite die Definitionsmacht. Erst diese neue Governance definiert, was Schweizer Bildung wirklich ist.
Eine neue Bildungsgovernance hatte schon 2009 ein Weissbuch der Akademien der Wissenschaften gefordert.[2] Die Bildung sollte gemäss diesem Weissbuch auf Bundesebene zusammengeführt werden, eventuell sogar in einem eigenen Departement. Dem Vorschlag konnte man damals nicht viel abgewinnen. Die Kantone wollten und wollen ihre Hoheit über die Bildung nicht an den Bund abgeben. Ein neues Staatssekretariat für Bildung ist ihnen ein Graus. Eine solche Zentralisierung passt auch nicht zur Geschichte der schulischen Bildung in der Schweiz: Volksschulen, Mittelschulen und Universitäten sind seit der Gründung des Bundesstaats kantonal organisiert. Angesichts dieser Verhältnisse ist es nicht zielführend, auf einem neuen Departement oder Staatssekretariat für Bildung zu beharren. Es ist auch nicht nötig. Gegenwärtig entsteht im Zuge der Revision des Gymnasiums eine Neustrukturierung der Governance.[3] Es soll ein neues Gremium innerhalb der Schweizerischen Konferenz der Erziehungsdirektor*innen EDK entstehen, also innerhalb der kantonalen Hoheit. Dieses neue Gremium führt die schulische Bildung nicht über-, sondern interkantonal zusammen – und es beteiligt den Bund an der neuen Struktur. Die Schweizer Bildung wird damit stärker zusammengeführt – ohne zentralisiert zu werden. Das ist ein gutschweizerischer Kompromiss: Auf der einen Seite gibt es das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, das die Berufsbildung organisiert. Auf der anderen Seite, auf der Seite der Kantone, entsteht derzeit ein gleichwertiges Gegenüber. Das zeigt: Die Bildungsoffensive, die hier skizziert wird, ist ein konkreter Vorschlag, der bereits am Entstehen ist. Die Zeichen der Zeit sind erkannt, auch auf Ebene der Bildungsgovernance.
Warum braucht es eine neue Governance? Nun, seitens der Berufslehre befürchtet man, bei einer Erhöhung der gymnasialen Maturitätsquote die besten Berufslernenden ans Gymnasium zu verlieren. Diese Bedenken sind besonders ausgeprägt in anspruchsvollen Berufen, die von der Digitalisierung stark betroffen sind und viele Berufsmaturand*innen ausbilden. Aus diesem Grund hat man ein weiteres Wachstum des Gymnasiums in den letzten beiden Jahrzehnten verhindert. Die Bedenken der Akteur*innen der Berufslehre sind verständlich. Es gibt keine einfachen Lösungen. Genau deshalb darf die Scheinlösung nicht darin bestehen, einfach die Gymnasialquote einzufrieren. Man kann in einem sich dynamisch entwickelnden System nicht jahrzehntelang mit einem Status quo weitermachen, der mittlerweile ein Vierteljahrhundert alt ist. Es braucht eine...
Table of contents
- [Cover]
- [Impressum]
- [Inhaltsverzeichnis]
- Abstract
- 1 Skizze
- 2 Upskilling
- 3 Positionen
- 4 Bildungsmythen und Statistik
- 5 Was lernen?
- Nachwort
- Referenzen
- Anhang
- Der Autor