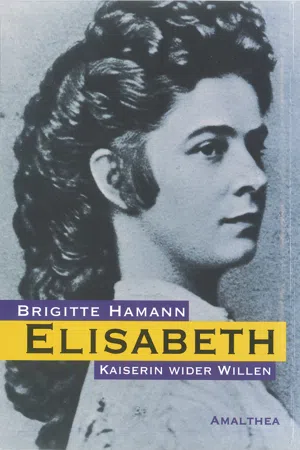
- 640 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
About this book
Elisabeth, die "schönste Monarchin der Welt": Naiv in die Ehe gestolpert, machtlos gegen Schwiegermutter und Rivalin, eine Fremde am Wiener Hof. Flucht aus den Zwängen ihrer Rolle, immer wieder Reisen - und am Ende die verzweifelte Suche nach Sinn. Brigitte Hamann gelingt mit ihrem noblen Porträt einer Kaiserin wider Willen eine glänzende biographische Studie. Ihr Buch ist längst zum Standardwerk und Welterfolg geworden, mit Übersetzungen in englisch, französisch, italienisch, spanisch, ungarisch, tschechisch und japanisch sowie Taschenbuchauflagen.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Elisabeth by Brigitte Hamann in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in History & European History. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
1. Kapitel
Verlobung in Ischl
An Kaisers Geburtstag, Sonntag, dem 18. August 1853, trat ein 15jähriges Landmädchen aus Possenhofen in Bayern in die österreichische Geschichte ein: Kaiser Franz Joseph I. hielt um die Hand seiner Cousine, Herzogin Elisabeth in Bayern, an und, wie nicht anders zu erwarten, erhielt er sie auch.
Die Braut war bisher niemandem sonderlich aufgefallen. Sie war ein kaum entwickeltes, noch längst nicht ausgewachsenes schüchternes Kind mit dunkelblonden langen Zöpfen, überschlanker Gestalt und hellbraunen, etwas melancholisch dreinblickenden Augen. Wie ein Naturkind war sie aufgewachsen inmitten von sieben temperamentvollen Geschwistern, abseits jeden höfischen Zwanges. Sie konnte gut reiten, schwimmen, angeln, bergsteigen. Sie liebte ihre Heimat, vor allem die bayrischen Berge und den Starnberger See, an dessen Ufer das Sommerschlößchen der Familie, Possenhofen, lag. Sie sprach bayrischen Dialekt und hatte unter den Bauernkindern der Nachbarschaft gute Freunde. Ihre Bildung und ihre Umgangsformen waren dürftig. Wie ihr Vater und ihre Geschwister hielt sie nichts von Zeremoniell und Protokoll – was am Münchener Königshof aber nicht viel ausmachte. Denn der herzogliche Zweig der Wittelsbacher Familie hatte dort ohnehin keine offizielle Funktion, konnte sich also ein reiches Privatleben leisten.
Die Mutter Herzogin Ludovika war schon geraume Zeit auf der Suche nach einer passenden Partie für ihre zweite Tochter Elisabeth. Sie hatte schon vorsichtig und wenig zuversichtlich in Sachsen angefragt – »Sisi bei Euch zu wissen, würde ich freilich als ein grosses Glück ansehen … aber leider ist es nicht wahrscheinlich – denn der einzige, der zu hoffen wäre [wohl Prinz Georg, der zweite Sohn des sächsischen Königs Johann], wird schwerlich an sie denken; erstens ist sehr die Frage, ob sie ihm gefiele und dann wird er wohl auf Vermögen sehen … hübsch ist sie, weil sie sehr frisch ist, sie hat aber keinen einzigen hübschen Zug.«1 Aus Dresden kam Sisi im Frühjahr 1853 ohne Bräutigam zurück. Sie stand ganz im Schatten ihrer viel schöneren, viel gebildeteren, viel ernsthafteren älteren Schwester Helene, die zu Höherem ausersehen war: einer Ehe mit dem Kaiser von Österreich. Im Vergleich mit Helene war Sisi das häßliche Entlein der Familie.
Der Bräutigam, Kaiser Franz Joseph, war damals 23 Jahre alt. Er war ein hübscher junger Mann mit blonden Haaren, einem weichen Gesicht und einer sehr zarten, schmalen Gestalt, die durch die enge Generalsuniform, die er stets trug, vorteilhaft betont wurde. Kein Wunder, daß er der Schwarm der Wiener Komtessen war, zumal er sich bei den Bällen des Hochadels als leidenschaftlicher und guter Tänzer erwies.
Dieser hübsche junge Mann mit den außergewöhnlich guten Manieren war einer der mächtigsten Männer seiner Zeit. Sein »großer« Titel lautete: Franz Joseph I. von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich; König von Ungarn und Böhmen; König der Lombardei und Venedigs, von Dalmatien, Croatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; König von Jerusalem etc.; Erzherzog von Österreich; Großherzog von Toskana und Krakau; Herzog von Lothringen, von Salzburg, Steyer, Kärnten, Krain und Bukowina; Großfürst von Siebenbürgen, Markgraf von Mähren; Herzog von Ober- und Niederschlesien, von Modena, Parma, Piacenza und Guastalla, von Auschwitz und Zator, von Teschen, Friaul, Ragusa und Zara; gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol, von Kyburg, Görz und Gradiska; Fürst von Trient und Brixen; Markgraf von Ober- und Niederlausitz und in Istrien; Graf von Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg etc; Herr von Triest, von Cattaro und auf der windischen Mark; Großwoiwod der Wojwodschaft Serbien etc. etc.
Im Revolutionsjahr 1848 war er als Achtzehnjähriger auf den Thron gelangt, nachdem sein geistig wie körperlich kranker Onkel, Kaiser Ferdinand I., abgedankt und sein Vater, der willensschwache Erzherzog Franz Carl, der Thronfolge entsagt hatte. Nach dem jämmerlichen Bild, das sein Vorgänger geboten hatte, gewann der junge Kaiser sehr rasch Sympathien, selbst bei Bismarck, der ihn 1852 kennenlernte und von ihm schrieb: »Der junge Herrscher dieses Landes hat mir einen sehr angenehmen Eindruck gemacht: zwanzigjähriges Feuer gepaart mit der Würde und Bestimmtheit reifen Alters, ein schönes Auge, besonders wenn er lebhaft wird, und ein gewinnender Ausdruck von Offenheit, namentlich beim Lächeln. Wenn er nicht Kaiser wäre, würde ich ihn für seine Jahre etwas zu ernst finden.«2
Franz Joseph herrschte absolut: Er war oberster Kriegsherr, er regierte ohne Parlament und ohne Verfassung, ja selbst ohne Ministerpräsident. Seine Minister waren nicht mehr als Ratgeber ihres hohen Herrn, der die Politik allein verantwortete. Mit starker Militär- und Polizeigewalt hielt er seine Länder zusammen, unterdrückte die demokratischen und nationalen Kräfte. Der alte Witz der Metternichzeit traf auch auf die frühe Franz-Joseph-Zeit zu: die Herrschaft beruhe auf einem stehenden Heer von Soldaten, einem sitzenden Heer von Beamten, einem knienden Heer von Priestern und einem schleichenden Heer von Denunzianten.
Österreich war 1853 der nach Rußland größte europäische Staat mit rund 40 Millionen Einwohnern, nicht mitgerechnet die 600 000 Soldaten. Im Vielvölkerstaat lebten 8,5 Millionen Deutsche, 16 Millionen Slawen, sechs Millionen Italiener, fünf Millionen Magyaren, 2,7 Millionen Rumänen, etwa eine Million Juden und etwa 100 000 Zigeuner. Der nördlichste Punkt des Reiches war Hilgersdorf in Nordböhmen (heute Tschechische Republik), der südlichste der Ostrawizza-Berg in Dalmatien (heute Kroatien), der westlichste bei Rocca d’Angera am Lago Maggiore in der Lombardei (heute Italien), der östlichste bei Chilischeny in der Bukowina (heute Ukraine).3
Die meisten Einwohner des Reiches (29 Millionen) lebten von der Landwirtschaft. Im Anbau von Flachs und Hanf war Österreich auf der ganzen Welt führend, im Weinanbau stand es nach Frankreich an zweiter Stelle. Ackerbau und Viehzucht wurden noch nach jahrhundertealtem Muster betrieben. Die technische Entwicklung stand weit hinter der der westlichen Staaten zurück.
Dank tüchtiger Generäle hatte Österreich die Revolution von 1848 ohne territoriale Einbußen überstanden. Die verfassunggebende Versammlung in Kremsier, eine intellektuelle Elite der »Achtundvierziger«, war mit Waffengewalt auseinandergetrieben worden. Viele Abgeordnete konnten ins Ausland fliehen, viele saßen in den Gefängnissen. Der junge Kaiser brach seine feierlichen Versprechungen, dem Land endlich eine Verfassung zu geben.
Aber trotz des anhaltenden Belagerungszustandes und der starken Militärgewalt zeigten sich auch 1853 noch immer Feuerzeichen am politischen Horizont, vornehmlich in Ungarn und in Oberitalien. Anfang Februar versuchte der italienische Revolutionsführer Giuseppe Mazzini, in Mailand einen Volksaufstand anzuzetteln, der in wenigen Stunden niedergeschlagen wurde. 16 Italiener wurden hingerichtet, weitere 48 zu schweren Kerkerstrafen »in Eisen« verurteilt.
Auch die Ruhe in Wien täuschte: zur Zeit der Mailänder Wirren wurde in Wien ein gefährliches Attentat auf den jungen Kaiser ausgeübt. Der ungarische Schneidergeselle Johann Libenyi stach ihn während eines Spazierganges auf der Bastei mit einem dolchartigen Messer in den Hals und verletzte ihn schwer. Libenyi fühlte sich als politischer Überzeugungstäter und schrie bei seiner Festnahme laut. »Eljen Kossuth« Er ließ also den Habsburgischen Erzfeind hochleben, den ungarischen Revolutionär, der 1849 die ungarische Republik ausgerufen hatte und nun vom Exil aus die Loslösung Ungarns von Österreich propagierte.
Libenyi wurde hingerichtet. Seine Tat aber mußte den jungen Kaiser warnen, daß der Thron nicht so fest gegründet war, wie es schien.
So sehr die kaiserliche Majestät auch über alle anderen Menschen erhaben war, so innig war Franz Josephs Beziehung zu dem einzigen Menschen, der für ihn eine Autorität darstellte: zu seiner Mutter, Erzherzogin Sophie.
Sie war 1824 als 19jährige bayrische Prinzessin an den Wiener Hof gekommen. Metternich regierte damals. Kaiser Franz war alt, sein ältester Sohn und Nachfolger Ferdinand krank und geistesschwach. Die junge, ehrgeizige und politisch interessierte Prinzessin stieß am Wiener Hof in ein Vakuum, das sie bald ganz mit ihrer starken Persönlichkeit ausfüllte. Bald ging ihr der Ruf voraus, an diesem an Schwächlingen reichen Hof »der einzige Mann« zu sein. Sie war es, die 1848 energisch dazu beitrug, Metternich zu stürzen. Sie warf ihm vor, »daß er eine unmögliche Sache wollte: Die Monarchie ohne Kaiser führen und mit einem Trottel als Repräsentanten der Krone«4, womit ihr geistesschwacher Schwager, Kaiser Ferdinand »der Gütige«, gemeint war. Sophie hielt ihren Mann davon ab, die Thronfolge anzunehmen, verzichtete also darauf, Kaiserin zu werden und durch ihren ihr ganz ergebenen Mann zu regieren.
Sie stellte damit die Weichen für die Thronbesteigung ihres »Franzi« im Dezember 1848 in Olmütz. Ihr mütterlicher Stolz war grenzenlos. Immer wieder sagte sie, daß es »eine große Wohltat war, das gute, aber arme kleine Wesen – das wir während beinahe 14 Jahren als unseren Kaiser anerkennen mußten – nicht mehr ungestört herumbandeln zu sehen und statt ihm die einnehmende Erscheinung unseres lieben jungen Kaisers, die jeden beglückte«.5
Franz Joseph war seiner Mutter sein Leben lang dankbar. Von ihrer sicheren Hand ließ er sich führen, wenn Sophie auch eifrig versicherte, daß »ich mir bei der Thronbesteigung meines Sohnes fest vorgenommen [habe], mich in keine Staatsangelegenheiten zu mischen; ich fühle mir kein Recht dazu und weiß sie auch in so guten Händen nach 13jähriger herrenloser Zeit – daß ich innig froh bin, nach dem schwerdurchkämpften Jahre 48 ruhig und mit Vertrauen das jetzige Gebahren mitanzusehen zu können!«6
Sophie hielt ihre guten Vorsätze nicht. Die gnadenlosen Blutgerichte für die Revolutionäre, die widerrechtliche Aufhebung der versprochenen – und kurze Zeit verwirklichten – Verfassung, die enge Verbindung Österreichs an die Kirche – das alles wurde in der Öffentlichkeit nicht als Werk des unsicheren jungen Kaisers angesehen, sondern als das der Erzherzogin Sophie, die in den fünfziger Jahren Österreichs heimliche Kaiserin war.
Die Politik bestimmte auch Sophies sorgfältige Suche nach der künftigen Gattin ihres Sohnes. Österreich machte nach der Revolution von 1848 eine betont deutsche Politik und versuchte, die führende Kraft im Deutschen Bund zu bleiben, beziehungsweise die immer mehr schwindende Macht gegenüber Preußen zurückzugewinnen. Diesem großen Ziel wollte Sophie auch mit Hilfe der Heiratspolitik näher kommen.
Ihre erste Wahl war eine Verbindung mit dem Haus Hohenzollern, wofür sie sogar eine protestantische Schwiegertochter in Kauf genommen hätte, die vor der Heirat hätte konvertieren müssen.
Im Winter 1852 fuhr also der junge Kaiser unter einem politischen und familiären Vorwand nach Berlin und verliebte sich prompt in eine Nichte des preußischen Königs, die gleichaltrige Prinzessin Anna. Da das Mädchen schon verlobt war, fragte Sophie ihre Schwester, Königin Elise von Preußen, »ob es keine Hoffnung gibt, daß diese traurige Heirat, die man dieser reizenden Anna auferlegt und die keinerlei Aussicht auf Glück für sie übrigläßt, vermieden werden könnte«. Sie schrieb offen, wie sehr der junge Kaiser bereits engagiert war und erwähnte das »Glück, das sich ihm wie ein flüchtiger Traum gezeigt hat und sein junges Herz – hélas – viel stärker und viel tiefer beeindruckt hat, als ich es zunächst glaubte … Du kennst ihn genug, daß man seinem Geschmack nicht so leicht entsprechen kann und ihm nicht die nächste beste genügt, daß er das Wesen lieben können muß, die seine Gefährtin werden soll, daß sie ihm gefalle, ihm sympathisch sei. Allen diesen Bedingungen scheint Eure liebe Kleine zu entsprechen, beurteile selbst, wie ich sie also für einen Sohn ersehne, der sosehr des Glückes bedarf, nachdem er so schnell auf die Sorglosigkeit und die Illusionen der Jugend hat verzichten müssen.«7
Königin Elise konnte sich gegenüber den preußischen Politikern nicht durchsetzen. Eine Heiratsverbindung mit Österreich paßte ganz und gar nicht in das preußische Konzept. Der junge Kaiser mußte eine persönliche Niederlage einstecken, außerdem wurde sein Berlinbesuch wenig schmeichelhaft kommentiert, so zum Beispiel von Prinz Wilhelm, dem späteren Wilhelm I.: »Wir in Preußen beglückwünschen uns, daß Österreich seine Unterwerfung in unserer Hauptstadt bezeugt hat, ohne daß wir nur einen Fußbreit politischen Bodens preisgegeben haben.«8
Auch nach Dresden erstreckten sich die Vorarbeiten Sophies für eine kaiserliche Eheschließung und eine gleichzeitige Verstärkung des österreichischen Einflusses in Deutschland. Diesmal ging es um die sächsische Prinzessin Sidonie, die allerdings kränklich war und dem Kaiser nicht gefiel.
Wie hartnäckig Sophie an ihrem Plan festhielt, eine deutsche Prinzessin an den Wiener Hof zu bekommen, zeigt ihr dritter Plan, diesmal mit ihrer Schwester, der Herzogin Ludovika in Bayern: Ludovikas älteste Tochter Helene paßte im Alter zum Kaiser, wenn sie auch eine weit weniger vornehme Partie als die beiden ersten Mädchen war. Sie stammte ja nur aus einer bayrischen Nebenlinie, nicht wie Sophie aus dem bayrischen Königshaus. Aber immerhin war Bayern neben Sachsen der treueste Partner Österreichs im Deutschen Bund, eine neuerliche Verbindung zwischen Österreich und Bayern politisch durchaus nützlich.
Bisher hatte es nicht weniger als 21 Verbindungen zwischen dem bayrischen und dem ö...
Table of contents
- Cover
- Titel
- Impressum
- Inhalt
- Vorwort
- Vorwort zur Neuausgabe
- 1. Kapitel: Verlobung in Ischl
- 2. Kapitel: Hochzeit in Wien
- 3. Kapitel: Die junge Ehe
- 4. Kapitel: Die Flucht
- 5. Kapitel: Schönheitskult
- 6. Kapitel: Ungarn
- 7. Kapitel: Die Last der Repräsentation
- 8. Kapitel: Die Königin hinter der Meute
- 9. Kapitel: Die Fee Titania und die Esel
- 10. Kapitel: Adler und Möve
- 11. Kapitel: Die Jüngerin Heines
- 12. Kapitel: »Die Freundin« Katharina Schratt
- 13. Kapitel: Rudolf und Valerie
- 14. Kapitel: Die Odyssee
- Zeittafel
- Stammtafeln
- Quellenverzeichnis
- Abkürzungen
- Anmerkungen
- Register