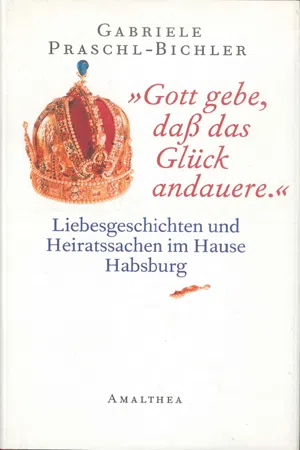
eBook - ePub
"Gott gebe, daß das Glück andauere."
Liebesgeschichten und Heiratssachen im Hause Habsburg
- 287 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
"Gott gebe, daß das Glück andauere."
Liebesgeschichten und Heiratssachen im Hause Habsburg
About this book
Der "Rechtmäßige" Seitensprung oder wie die Habsburger Heiratsgesetze mit List umgingenGabriele Praschl-Bichler, Habsburghistorikerin mit Blick für Tragikomisches, erzählt von den ganz privaten Sorgen und Freuden der Familie Habsburg. Bisher unveröffentlichte Briefe und Tagebuchaufzeichnungen aus habsburgischem Familienarchiv geben dem Buch dokumentarischen Wert!
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access "Gott gebe, daß das Glück andauere." by Gabriele Praschl-Bichler in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in History & European History. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
1
Kaiser Franz II./I. und seine Kinder
»Ich werde versuchen, Dir zuliebe
sehr dick zu werden, um die Reize der Spintin
zu verdunkeln.«
sehr dick zu werden, um die Reize der Spintin
zu verdunkeln.«
Sicherlich gibt es sie zumindest genauso lang wie die standesgemäßen, einwandfreien und ›guten‹ Verbindungen: die morganatischen und illegitimen Beziehungen, die den verschieden Betroffenen viel Lebensfreude, aber auch Leid und Ärger bescherten. Wenn man sich das Habsburger Hausgesetz vor Augen führt – demzufolge man künftige Ehepartner nur aus bestimmten regierenden Dynastien erwählen durfte –, kann man sich leicht vorstellen, daß nicht jedes Mitglied den Partner erhielt, der eine gute Beziehung gewährleistete.
Der Grund, warum man sich nach diesem Heiratsgesetz richtete, ist einfach: Man wollte Macht und Frieden zwischen den Familien und Staaten erhalten; im besten Fall sogar mehren. Dieser Grundsatz war für die meisten Geschlechter der Grundstein ihrer Politik. Um Verallgemeinerungen über diese aus Staatsräson geschlossenen, mehr oder minder erfolgreichen Ehen vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, daß zumindest ebensoviele gute und schlechte zustande kamen wie bei den auf Liebe gegründeten.
Aus welchen Gründen auch immer solche Verbindungen geschlossen wurden, sie sind meist ebenso verlaufen wie bürgerliche oder bäuerliche Vergleichsbeispiele, die übrigens nach denselben Grundsätzen zustande kamen: denn kein vermögender Bürger oder Bauer hätte geduldet, daß eines seiner Kinder unstandesgemäß heiratete. Machtmehrung und soziale Verbesserung galten in allen Gesellschaftsschichten und Jahrhunderten als das überzeugendste Argument, eine Verbindung einzugehen. Nach diesem Rezept arrangierten die Bourbonen, die Hohenzollern, die Fugger, die Rothschilds und auch die Habsburger die Heiraten ihres Nachwuchses. Unter letzteren stach jener Kaiser hervor, der in die österreichische Geschichte mit zwei Numerierungen einging: Als Franz II. markiert er den Schlußpunkt einer langen, beinahe lückenlosen Reihe von Habsburgern als römisch-deutsche Kaiser. Als Franz I. steht er am Anfang einer kurzen und tragischen Episode von österreichischen Kaisern, die nur noch drei Amtsnachfolger hervorbringen sollte: seinen Sohn Ferdinand, seinen Enkel Franz Joseph und seinen Ururenkel Karl. Besonders ›vorbildlich‹ verhielt er sich als Dynastieerhalter, als welcher er es auf insgesamt vier standesgemäße Ehen und dreizehn ebensolche Kinder brachte. Seine ersten drei Frauen starben jung, und erst die vierte, die um 24 Jahre jüngere Caroline Auguste, überlebte den Ehemann.
Die erste Frau Kaiser Franz II./I., Elisabeth Wilhelmine, war die Tochter Herzog Friedrich Eugens von Württemberg. Sie war bei der Eheschließung 21 Jahre alt. Nach zwei Jahren gebar sie das erste Kind und gab – wie viele ihrer Zeitgenossinnen – mit der Geburt der Tochter auch ihr Leben hin. Das Mädchen, das man Ludovika nannte, folgte seiner Mutter nur ein Jahr später ins Grab. Die zweite Ehefrau, Marie Therese, die Tochter König Ferdinands I. beider Sizilien, gebar dem Kaiser nach Habsburger Art zwölf Kinder, von denen allerdings nur sieben erwachsen und fünf älter als 31 Jahre alt wurden. Das Leben dieser Gemahlin verlosch ebenfalls kurz nach der Geburt des letzten Kindes, das noch vor der Mutter sein Leben ließ. Um der großen Kinderschar eine neue Mutter zu geben, heiratete Kaiser Franz II./I. sieben Monate nach dem Tod seiner zweiten Frau Maria Ludovika, die Tochter Erzherzog Ferdinands von Österreich aus der Linie der Herzoge von Modena. Unter allen Gemahlinnen des Kaisers sprach man ihr die höchste Intelligenz zu. Sie wurde seinen zahlreichen Kindern eine liebevolle Mutter, nahm sich interessiert ihrer Erziehung an und sorgte vor allem dafür, daß der kränkliche und seiner Entwicklung nachhinkende Thronfolger Ferdinand in die Hände der richtigen Lehrer kam. Ihrem Einfluß ist es zu verdanken, daß aus dem beinahe aufgegebenen Kind ein normaler Erwachsener wurde. Denn abgesehen von seinen körperlichen Leiden (Epilepsie und Wasserkopf) war er psychisch gesund. In der Zeit der folgenden Studien, die von seiner Stiefmutter geleitet wurden, holte er alles Versäumte nach und entwickelte sich von einem apathischen Kind zu einem immer fröhlicher heranwachsenden Menschen.
Wie viele geistige Gaben Kaiserin Maria Ludovika auch besaß, so konnten sie allesamt ihre angegriffene Gesundheit nicht aufwiegen. Sie litt seit ihrer Jugend an Tuberkulose, mußte sich körperlich ständig schonen und durfte ihrem Mann vor allem keine Kinder gebären. Wenn man sich vor Augen hält, daß Kaiser Franz von den beiden ersten Frauen schon dreizehn Kinder geboren worden waren und daß beide dafür ihr Leben gegeben hatten, würde man annehmen, daß der Mann genug Verständnis für das Leiden seiner dritten Frau aufgebracht hätte. Weit gefehlt. Nicht nur, daß er ihre schwere Krankheit als weibliche Überempfindlichkeit abtat, schien er nichts dringender im Sinn gehabt zu haben, als seine Männlichkeit – wenn nicht im Ehebett, dann auf anderen Lagern – unter Beweis zu stellen. Maria Ludovika litt unsäglich darunter. Wenn sie in Briefen an den Ehemann darauf zu sprechen kam, klangen die Anspielungen allerdings so leise und zart und im besten Fall selbstironisch, daß der Kaiser gar nicht auf die Idee kam, sie durch sein Verhalten zu kränken. »Ich (Maria Ludovika) würde Dich doppelt und dreifach voll Zärtlichkeit küssen, wenn ich es könnte, doch ich darf den Trost, Dich zu sehen, nicht so bald erhoffen; einerseits ist es ganz gut so, denn wenn Du sehen könntest, wie ich jetzt aussehe, würdest Du Dich vielleicht dazu entschließen, mich auf dem Tandelmarkt zu verkaufen, und statt meiner die Spintin (eine der Nebenbuhlerinnen) in Deine Gunst aufzunehmen (…) Ich werde versuchen, Dir zuliebe sehr dick zu werden, um die Reize der Spintin zu verdunkeln. Hast Du sie wieder aufsuchen müssen, Du Lump?« (undatierter Brief, zitiert in: Holler, Ferdinand, S. 82)
Das rücksichtslose Verhalten Kaiser Franz’ seiner dritten Frau gegenüber war damit aber nicht abgetan. Denn sogar der sich ständig verschlechternde Gesundheitszustand Maria Ludovikas veranlaßte ihn nur zu spöttischen Bemerkungen. Die ›sogenannte‹ Krankheit, die er nicht als solche anerkannte, schrieb er der weiblichen Hysterie zu. Anläßlich einer gemeinsamen Reise nach Italien kam sie endgültig zum Durchbruch. Maria Ludovika kollabierte, ihre Kräfte ließen nach. Die mitgereiste Hofgesellschaft ahnte, daß es mit der Kaiserin zu Ende ging. Nicht so der Kaiser, der von Verona aus, wo seine Ehefrau sterbend im Bett lag, Inspektionsreisen durch die Region machte. Marie Louise, die älteste Tochter des Kaisers, die zu dieser Zeit schon als Herzogin in Parma regierte, eilte ans Krankenbett der geliebten Stiefmutter. Dem Vater berichtete sie in täglichen Briefen vom Zustand seiner Frau. »… Heute ist unsere geliebte Kranke um etwas beßer, obwohl sie mir aufträgt, Ihnen zu sagen, daß sie heute gar nicht gut ist. Obwohl sie die ganze Nacht ohne Schlaf war, so konnte sie immer fort liegen, der Auswurf und der Husten sowie das Fieber sind geblieben, auch finde ich ihre Laune heiterer. Sie hat noch nichts zu sich genommen als die Hälfte von einem gekochten Apfel, welchen sie schien mit Appetit zu eßen. Sie trägt mir auf Ihnen zu sagen daß sie kaum den morgigen Tag erwarten kann, um Sie zu sehen …« (Brief Marie Louises an ihren Vater, 5. April 1816) Ob Marie Louise den Vater nicht beunruhigen wollte oder ob sie den Zustand der Stiefmutter tatsächlich nicht richtig einschätzen konnte, bleibe dahingestellt. Denn zwei Tage nach diesem Brief starb Maria Ludovika. Die Kranke hatte um den Fortschritt ihrer Krankheit besser Bescheid gewußt und den Ehemann zum letzten Abschied ans Sterbebett herbeigesehnt.
Nach einer kurzen Trauerzeit um die verstorbene dritte Gemahlin heiratete Kaiser Franz II./I. im November 1816, sieben Monate nach dem Tod Maria Ludovikas, Prinzessin Charlotte von Bayern. Sie war zum Zeitpunkt der Heirat mit dem Kaiser von Österreich 24 Jahre alt – für damalige Verhältnisse als Braut sehr alt –, aber sie hatte auch schon eine äußerst unglückliche Ehe mit dem Kronprinzen von Württemberg, dem späteren König Wilhelm I., hinter sich. Der damalige Thronfolger betrog und demütigte seine junge Frau vor den Augen der Hofgesellschaft, die traurig und einsam vor sich hinlebte. Die nachfolgende Ehescheidung bedeutete für Charlotte die Befreiung von einem Mann, der sie nie geliebt hatte. All diese Voraussetzungen und der Umstand, daß Kaiser Franz mittlerweile ein Alter von 48 Jahren erreicht hatte, begünstigten die neue Verbindung, die für beide Partner zu einer glücklichen Ehe werden sollte. Die neue Kaiserin, die man in Österreich Caroline Auguste nannte, übernahm wie ihre Vorgängerin die zahlreichen Kinder des Kaisers – soweit sie noch im Hause lebten – in liebevolle Pflege. Von den dreizehn Töchtern und Söhnen waren zum Zeitpunkt der vierten Eheschließung Kaiser Franz’ sechs verstorben. Das älteste erwachsen gewordene Kind, die Tochter Marie Louise, war rechtlich noch mit dem in Verbannung lebenden Kaiser der Franzosen, Napoleon I., verheiratet. Sie lebte aber – von ihm getrennt – als selbständige Regentin im Herzogtum Parma. Unter allen ihren Geschwistern, die ausnahmslos gute und biedere Ehen führten, sollte sie die einzige sein, die unzählige Affären und Skandale produzierte, weshalb ihrem Leben – dem Thema des Buches entsprechend – ein eigenes, das nächste Kapitel gewidmet wird.
Der älteste Sohn Kaiser Franz II./I., Ferdinand, sein Amtsnachfolger, galt lange Zeit als zu krank, als daß man daran dachte, ihn zu verheiraten. Durch den günstigen Einfluß seiner ersten Stiefmutter, Maria Ludovika, erfuhren seine geistigen und körperlichen Schwächen eine derart positive Entwicklung, daß aus ihm nicht nur ein normal lebender Mensch, sondern auch eine zufriedene Persönlichkeit wurde, die man mit ruhigem Gewissen verheiraten konnte. An Krankheiten, unter denen er tatsächlich litt, waren nur der Wasserkopf und eine in der Familie stark verbreitete Epilepsie verblieben. Ersteres wirkte sich auf die Physiognomie unvorteilhaft aus, weshalb der Volksmund den großen Schädel mit einer Geisteskrankheit in Zusammenhang brachte.
Doch Ferdinand war alles andere als geistesschwach. Er war ein sprachlich, musisch und wirtschaftlich hochbegabter Mann, der außerdem über eine große Seele verfügte. Als er 1831 gegen die Erwartungen vieler Menschen Prinzessin Maria Anna von Sardinien heiratete, wurde er seiner Frau ein liebevoller Ehemann, der zunächst gar nicht wagte, sie körperlich zu begehren. Erzherzogin Sophie, die Schwägerin Ferdinands und Mutter des späteren Kaisers Franz Joseph, meinte dazu in einem Brief an ihre Mutter. »Ich glaube, wenn man Ferdinand nicht sagte, er solle von seinem Gattenrecht Gebrauch machen, er niemals daran denken würde, es zu tun.« (Schreiben vom 8. März 1831) Daß er die Ehe eines Tages doch vollzog, verdankte er nicht zuletzt dem einfühlsamen Wesen seiner Frau, die ihm sein Leben in jeder Beziehung erleichterte und verschönte. Die Achtung und der Respekt der beiden Eheleute voreinander führten zu einer der glücklichsten Verbindungen im Hause Habsburg. Maria Anna stand dem Ehemann in seinen Leiden bei und blieb ihm bis ins hohe Alter eine liebevolle Pflegerin.
Als Ferdinand 1848 zugunsten seines Neffen Franz Joseph die Regentschaft zurücklegte, zog sich das Paar nach Prag zurück, wo es bis an sein Lebensende den Hradschin bewohnte. Hier verbrachten beide die ruhigste und glücklichste Zeit ihres Lebens. Für Ferdinand begann eine fruchtbare Epoche, die er mit Studien der Botanik, mit wissenschaftlichen Zirkeln und vor allem mit der Aufwirtschaftung der heruntergekommenen Besitzung Reichstadt in Böhmen verbrachte. Sie war nach der Verbannung Napoleons seinem nach Österreich verbrachten Sohn aus der Ehe mit Marie Louise zugesprochen worden. Obwohl er den Titel eines Herzogs von Reichstadt trug, kam er nie in den Genuß der Wirtschaftserträge, da er als junger Mann in Wien starb. Das Herzogtum fiel nach seinem Tod seiner Mutter zu, die inzwischen als Herzogin in Parma regierte. Sie vermachte es ihrem Bruder, Kaiser Ferdinand, der nach seiner Abdankung die Verwaltung der Güter selbst übernahm. Und der von der Geschichte so verkannte Mann erreichte in kürzester Zeit eine Ertragssteigerung von einem kaum nennenswerten Gewinn auf zwei Millionen Gulden.
1856 feierten Kaiser Ferdinand und seine Ehefrau in Prag Silberne Hochzeit. Sie hatten zu dem Zeitpunkt ein Alter von 63 bzw. 53 Jahren erreicht, und die Liebe und Achtung hatte sich mit jedem Jahr ihrer Ehe gesteigert. Erst 1875 fand diese reiche Beziehung, die insgesamt 44 Jahre gewährt hatte, mit dem Tod Ferdinands ihr Ende.
Mit Ausnahme von Marie Louise zählte die Gattenliebe zu den hervorstechendsten Eigenschaften aller Kinder Kaiser Franz II./I. Die mit zwanzig Jahren nach Brasilien an den dortigen Thronprätendenten Pedro verheiratete Erzherzogin Leopoldine verliebte sich schon in Wien in das Porträt, das man ihr von ihrem künftigen Ehemann geschickt hatte, und sie konnte sich nichts sehnlicher vorstellen, als so schnell wie möglich mit ihm zu leben und gemeinsam mit ihm einer eigenen Familie vorzustehen.
Wenn dieser Ehe auch nur geringe Zeit gemeinsamen Glücks beschieden war, da Pedro sich nur an der Seite mehrerer Frauen gleichzeitig entfalten konnte, so blieb Leopoldine in der Zeit ihres kurzen Lebens dem Ehemann nicht nur eine treue Geliebte, sondern wurde ihm auch eine mutige Mitstreiterin im von politischen Wirrnissen geplagten Brasilien. Als Ehefrau mußte sie die schlimmsten Demütigungen hinnehmen, die von der steten Launenhaftigkeit des Ehemanns geprägt waren. Zunächst wurden alle ihr lieben und vertrauten Personen vom Hof verbannt. Das hinderte Dom Pedro aber nicht, den gemeinsamen Haushalt immer häufiger zu verlassen und seinen zahlreichen Liebesabenteuern nachzugehen. Er gab sich nicht nur keine Mühe, seine Romanzen zu verheimlichen, sondern fand es auch ganz natürlich, eine seiner Langzeitgeliebten, Domitila de Castro Canto e Melo, zur »Ersten Hofdame der Kaiserin« zu machen, die daraufhin im Familienpalast ständig mit seiner Frau und seinen Kindern verkehrte. Leopoldine ertrug die Gegenwart der Rivalin mit aller erdenklichen Würde, sodaß die Höflinge glauben mochten, sie wüßte nichts von der Affäre. Im stillen hoffte sie, Dom Pedro würde sich nach einer gewissen Zeit wieder der eigenen Familie zuwenden. Doch stattdessen verschlimmerte sich die Lage sogar. Den tiefsten Einriß in ihrem Gefühlsleben hinterließ die Erhebung einer illegitimen Tochter Dom Pedros aus der Beziehung zu Donna Domitila in den Adelsstand, was zur Folge hatte, daß das Mädchen gemeinsam mit Leopoldines Kindern erzogen wurde.
Wenn Leopoldine die unwürdige Behandlung durch den Ehemann auch schmerzlich empfand, so hörte sie niemals auf, ihn zu lieben. Jahrelang hoffte sie, daß alle Abenteuer ein Ende haben würden und daß letztendlich sie als die Siegerin im Kampf um Dom Pedro dastehen würde. Doch er geriet in immer stärkere Abhängigkeit von seiner Mätresse und verließ eines Tages den ehelichen Haushalt, um nur noch mit Donna Domitila zu leben. Darüber geriet Leopoldine, die bis dahin alle Demütigungen schweigend ertragen hatte, erstmals derart in Zorn, daß es in der Folge zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen ihr und Dom Pedro kam. Dabei scheint die schwangere Leopoldine von ihrem Mann – offensichtlich sogar in Anwesenheit seiner Geliebten – geschlagen und getreten worden zu sein. Die geschundene Ehefrau konnte die körperlichen und psychischen Angriffe, die der Streit bei ihr hinterlassen hatte, nicht mehr verwinden, und sie starb wenige Wochen danach. Als ihr Vermächtnis ist ein Brief an ihre Schwester Marie Louise erhalten, in dem sie – den nahen Tod ahnend – auf den Vorfall und die Begleitumstände Bezug nahm: »Höre den Schrei eines Opfers, das nicht Rache, sondern Mitleid und den Beistand schwesterlicher Liebe für unschuldige Kinder verlangt, die als Waisen in den Händen … jener Personen (Dom Pedros und seiner Geliebten) bleiben werden, die die Urheber meines Unglücks gewesen sind und (die) mich in diesen Zustand versetzt haben, in dem ich mich befinde … Kürzlich ging er (Dom Pedro) so weit, daß er mir den letzten Beweis seines totalen Vergessens meiner Person gab, indem er mich in der Gegenwart derjenigen selbst mißhandelte, die die Ursache meines ganzen Unglücks ist … aber es fehlen mir die Kräfte, mich an ein so schreckliches Attentat zu erinnern, das zweifelsohne die Ursache meines Todes sein wird.« (undatierter Brief, zitiert in: Oberacker, S. 524) Leopoldine starb und wurde ihren Untertanen, für die sie viel gewagt und erkämpft hatte, eine Nationalheilige. Als Witwer hatte Dom Pedro vor den kritischen Augen des Volks viel stärker denn als Ehemann auf sein Benehmen zu achten. Vor allem gab er den Plan des gemeinsamen Haushalts mit der Geliebten auf. Als Familienvorstand wurde er den halbverwaisten Kindern ein aufmerksamerer Vater, der in den Monaten nach dem Tod Leopoldines um sie trauerte und zumindest nach außen hin das Andenken an sie hochhielt.
In der Reihenfolge der Töchter und Söhne Kaiser Franz II./I. steht Erzherzogin Klementine an vierter Stelle der erwachsen gewordenen und verheirateten Kinder. Sie wurde im Alter von 18 Jahren mit dem um acht Jahre älteren Fürsten Leopold von Salerno vermählt, der der Familie der Bourbon-Sizilien entstammte. Die Beziehung zählt zu den zahlreichen Vernunftehen zwischen diesen beiden Familien, die aus einem für die Gesellschaft und Epoche typischen Grund als klassisch bezeichnet werden dürfen. Der Fürst, der seinen dynastischen Beitrag durch eine standesgemäße Heirat geleistet hatte, war als Privatmann »ein übler Schürzenjäger und Schuldenmacher, über dessen anstößiges Benehmen in der Öffentlichkeit sich die Polizei gezwungen sah … (dem Kaiser und Schwiegervater) zu berichten«. (Bourgoing II, S. 32)
Der Ehe mit Erzherzogin Klementine entsprangen vier Kinder, von denen nur eine Tochter, Karoline, das Erwachsenenalter erreichte. Sie heiratete – nach dem Vorbild unendlich vieler Vorfahren – innerhalb der eigenen Familie. Im Jahr 1844 wurde sie die Frau Herzog Heinrichs von Aumâle aus dem Haus Bourbon-Orléans, bekam sechs Kinder, von denen nur zwei Söhne, Ludwig Philipp und Franz, das Kindesalter überlebten. Aber auch ihnen war kein langes Leben vergönnt. Sie starben unverheiratet im Alter von 21 und 18 Jahren, wodurch die Linie Herzog Heinrichs von Aumâle ausstarb.
Sehr ähnlich gestaltete sich die Biographie der nächstälteren Schwester Klementines, Erzherzogin Karoline. Auch sie ehelichte ein Mitglied einer der wenigen Familien, mit denen die Habsburger seit Generationen Verbindungen eingingen. Da sich Österreichs Kaiser und Erzherzoge nur mit Abkömmlingen regierender und katholischer Familien verheiraten durften, war der Kreis der Auserwählten ziemlich klein. Der Großteil der deutschen Fürsten war protestantisch, weshalb man sich vorwiegend mit den Familien des katholischen – deutschen, italienischen oder französischen – Südens verband. Bevorzugt wurden Abkömmlinge der bayrischen oder sächsischen Königshäuser, mit denen man in jeder Generation zumindest eine Verbindung einging. So geschehen auch unter den Kindern Kaiser Franz II./I.: Erzherzogin Karoline wur...
Table of contents
- Cover
- Titel
- Impressum
- Inhalt
- Vorwort
- 1 Kaiser Franz II./I. und seine Kinder
- 2 Marie Louise, Kaiserin der Franzosen
- 3 Kaiser Franz Joseph und seine Brüder
- 4 Kronprinz Rudolf
- 5 Erzherzogin Elisabeth, die Tochter Kronprinz Rudolfs
- 6 Erzherzog Carl Ludwig und seine Söhne Franz Ferdinand, Otto und Ferdinand
- 7 Kaiser Leopold II., der Stammvater der Großherzoge von Toskana
- 8 Die Brüder Erzherzoge Ludwig Salvator und Johann Salvator (alias Johann Orth)
- 9 Die Kinder Großherzog Ferdinands IV. von Toskana
- 10 Die Brüder Kaiser Franz’ II./I.: Erzherzog Karl, Erzherzog Josef, Erzherzog Johann, Erzherzog Rainer und ihre Nachkommen
- 11 Erzherzog Johann
- Anhang
- Kurzbiographien
- Quellen und Literatur
- Personenregister