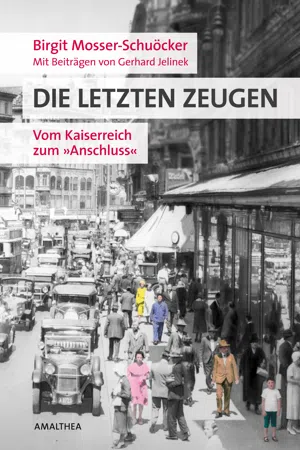![]()
1. KAPITEL
»Wir haben schon verstanden, was Krieg ist.«
Frieda Jeszenkowitsch, Berta Stimpfl, Felizitas Wester und Marko Feingold
über den Ausbruch und das Leid des Ersten Weltkrieges
1914
Frieda Jeszenkowitsch,
geboren 1909,
Burgenland
»Mama«, ruft die Fünfjährige, »Mama!« Keine Reaktion. Das Mädchen lauscht angestrengt. Es ist still in der großen Wohnung. Wo ist die Mutter? Frieda nimmt ihre Lieblingspuppe, die sie gerade angezogen hat, und betritt den Korridor. Sie fürchtet sich ein wenig vor dem langen, düsteren Gang, aber sie muss die Mutter suchen. Aus dem Wohnzimmer dringt ein seltsames Geräusch, ein Schluchzen. Die hohe, weiße Türe ist geschlossen. Weint die Mutter? Ist etwas Schlimmes passiert? Frieda hat Angst. Das Schluchzen wird lauter, verzweifelter. Das kleine Mädchen muss sich auf die Zehenspitzen stellen, um die Klinke zu erreichen. Dann stößt sie die Türe auf. Die Mutter sitzt beim Speisezimmertisch, vor sich die aufgeschlagene Zeitung.
»Meine Mama hat geweint und wir Kinder haben nicht verstanden, warum.« Die alte Dame kann sich noch gut an das beklemmende Gefühl von damals erinnern. Heute weiß die Rusterin, warum ihre Mutter verzweifelt war: »Sie hat geweint, weil sie die Mobilmachung in der Zeitung gelesen hat und Angst hatte vor dem, was kommt.«
»Da kommt man nach Sarajevo, um einen Besuch zu machen, und man wirft auf einen mit Bomben. Das ist empörend!«, fährt der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand den Bürgermeister von Sarajevo an. Kurz zuvor war eine Bombe in Richtung des Autos der Besucher geschleudert worden, Franz Ferdinand und seine Gattin blieben unverletzt. Doch das Ehepaar kann seinem Schicksal nicht entrinnen. Der Fahrer ihrer Limousine wählt die falsche Route und fährt den Thronfolger und die Herzogin von Hohenberg direkt zu ihrem Mörder. Es ist 11 Uhr vormittags, als der Schüler Gavrilo Princip auf den Mann schießt, den er für einen Tyrannen hält. Die erste Kugel trifft dessen neben ihm sitzende Frau in den Unterleib. »Sopherl, Sopherl […] stirb mir nicht! Bleibe für meine Kinder!« Dann wird auch Franz Ferdinand getroffen. Trotz hilflosen Rettungsversuchen verbluten die dreifachen Eltern.
Der 19-jährige Gavrilo Princip glaubt, für seine Heimat zu töten. »Ich bin ein jugoslawischer Nationalist mit der Vereinigung aller Jugoslawen als Ziel, mir ist es egal, in welcher Staatsform, jedoch muss er [der jugoslawische Staat; Anm.] von Österreich befreit werden«1, bekennt er bei seinem Prozess. Den Serben ereilt nicht das zu erwartende Schicksal. Aufgrund seiner Jugend wird er nicht hingerichtet. Da er zur Tatzeit noch nicht 20 Jahre alt war, kann er nach österreichischem Recht nicht zum Tod verurteilt werden. 20 Jahre Kerker sind sein Los. Angekettet vegetiert er in einer winzigen, feuchten, dunklen Zelle dahin. Am 28. April 1918 stirbt er in Theresienstadt an Knochentuberkulose. Mit einem Löffel hat er folgende Worte in die Wand seiner Gefängniszelle gekratzt: »Unsere Geister schleichen durch Wien und raunen durch die Paläste und lassen die Herren erzittern.«2
Im heutigen Bosnien sind sieben Straßen nach dem Attentäter von Sarajevo benannt. Zum 100. Jahrestag des Attentats war geplant, in Belgrad zu seinen Ehren ein Denkmal, eine Statue auf der Festung Kalemegdan, zu errichten. Die Terroristen der einen sind die Helden der anderen.
Die Schüsse am 28. Juni 1914 lösen die »Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts« aus. 15 Millionen Menschen werden dem Thronfolgerpaar in den Tod folgen. Unmittelbar nach dem Attentat deutet nichts auf die bevorstehende Apokalypse hin. In Baden bei Wien wird ein Konzert unterbrochen, der Kapellmeister berichtet vom Tod des Thronfolgers und seiner Gattin. Die Gäste sind keineswegs anhaltend irritiert, wie Stefan Zweig, der der Szene beiwohnt, in Die Welt von Gestern beschreibt: »Zwei Stunden später konnte man kein Zeichen wirklicher Trauer mehr bemerken. Die Leute plauderten und lachten, und abends spielte in den Lokalen wieder die Musik. Der Thronfolger war keineswegs beliebt gewesen.«3 Auch nicht bei seinem Onkel. »Eine höhere Macht hat jene Ordnung wieder hergestellt, die ich nicht zu erhalten vermochte«, soll der greise Kaiser das Attentat kommentiert und damit die Ehe seines Neffen mit der den Habsburgern nicht »ebenbürtigen« Gräfin Chotek gemeint haben. In jenen Sommertagen, die zwischen Krieg und Frieden entscheiden, geht es nicht um Beliebtheit oder verwandtschaftliche Zuneigung. Es geht um die Ehre, das Ansehen des Reiches.
Am 23. Juli überreicht der k. u. k. Gesandte in Belgrad das Ultimatum der Monarchie an Serbien. Es enthält Forderungen, die die serbische Regierung nicht ohne Gesichtsverlust annehmen kann. Der österreichische Außenminister hat seinen Gesandten bereits am 7. Juli wissen lassen: »Wie immer die Serben reagieren – Sie müssen die Beziehungen abbrechen und abreisen; es muss zum Krieg kommen.«4 Die Österreicher können auf die Unterstützung des Deutschen Reiches zählen. »Kaiser Franz Joseph könne sich aber darauf verlassen, dass S[eine] M[ajestät] im Einklang […] und seiner alten Freundschaft treu an der Seite Österreich-Ungarns stehen werde«5, hat der deutsche Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg nach Wien telegrafiert.
Die europäischen Großmächte sind einander durch Beistandspakte verpflichtet, die Heere hochgerüstet und die Monarchen kriegswillig. Am 28. Juli 1914, dem Tag der Kriegserklärung an Serbien, verfasst der Kaiser ein Manifest, in dem er seine Entscheidung rechtfertigt. Es wird am 29. Juli in der Wiener Zeitung veröffentlicht. »An meine Völker! […] Die Umtriebe eines hasserfüllten Gegners zwingen Mich, zur Wahrung der Ehre Meiner Monarchie, zum Schutze ihres Ansehens und ihrer Machtstellung, zur Sicherung ihres Besitzstandes nach langen Jahren des Friedens zum Schwerte zu greifen […] Diesem unerträglichen Treiben muss Einhalt geboten, den unaufhörlichen Herausforderungen Serbiens ein Ende bereitet werden, soll die Ehre und Würde Meiner Monarchie unverletzt erhalten und ihre staatliche, wirtschaftliche und militärische Entwicklung vor beständigen Erschütterungen bewahrt bleiben […]. In dieser ernsten Stunde bin Ich Mir der ganzen Tragweite Meines Entschlusses und Meiner Verantwortung vor dem Allmächtigen voll bewusst. Ich habe alles geprüft und erwogen. Mit ruhigem Gewissen betrete Ich den Weg, den die Pflicht Mir weist.«
Mit anderen Worten: Der Krieg wurde Österreich von seinen Feinden aufgezwungen. Die meisten Österreicher glauben ihrem Kaiser, der die Geschicke der Monarchie seit über 65 Jahren mit sicherer Hand leitet. Der greise Monarch ist längst zu einer Integrationsfigur Österreich-Ungarns geworden. »Gott erhalte, Gott beschütze, unsern Kaiser, unser Land«, wie es in der Hymne heißt, singen viele Menschen mit aufrichtiger Zuneigung. Für viele ist es undenkbar, dass der 84-jährige Franz Joseph eine falsche Entscheidung trifft.
Trotz des Wissens um die bestehenden Kriegsbündnisse zwischen Österreich, Deutschland und Italien auf der einen Seite und England, Frankreich und Russland auf der anderen Seite sehen an jenem Sommertag auch Intellektuelle den Flächenbrand noch nicht am Horizont.
So schreibt die Neue Freie Presse am Tag der Kriegserklärung an Serbien: »Der Weltkrieg könnte nur durch eine frevelhafte Sünde an der Menschheit entstehen. Der Krieg mit Serbien, dieses Strafurteil, das in einem fernen Winkel von Europa für eine beispiellose Herausforderung […] vollzogen werden soll, ist nichts, was die anderen Großmächte näher berühren, den Wohlstand der Völker zerstören und Jammer über die Erde verbreiten müsste.«
Doch innerhalb weniger Wochen wird aus einer lokalen Auseinandersetzung zwischen Serbien und Österreich ein Krieg, der ganz Europa überzieht. Schon am 14. August titelt die Neue Freie Presse: »Die elfte Kriegserklärung: Kriegszustand zwischen der Monarchie und England und Frankreich.« Die Reichspost weiß von einem »beispiellosen, unbeschreiblichen, dröhnenden Jubelsturm« zu berichten.
Gerade Dichter und Journalisten werden vom nationalen Taumel angesteckt und fördern durch ihre Artikel, Gedichte und Bücher die anfängliche Kriegseuphorie. Der Meraner Lokalpoet Karl Zangerle reimt unter dem Titel »28. Juli 1914!«:
Sie gossen das Maß bis zum Rande voll
Und waren auf Unfried erpicht,
Bis endlich über die Save scholl:
»Bis hierher und weiter nicht!
Stellt ihr die tückische Hetze nicht ein,
Und könnt ihr nicht redliche Nachbarn sein,
Und wenn Euch der Friede nicht frommt,
So zieht vom Leder und kommt!«6
Der Krieg bricht auch in das beschauliche Leben der Familie Jeszenkowitsch ein. Friedas Vater ist Lehrer, die Familie lebt in Rust am Neusiedlersee. Noch liegt die Weinstadt nicht im Burgenland, sondern in Ungarn. »Die Kirchengemeinde hat dem Vater eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Das war ein sehr nobles katholisches Haus, ein Gutshaus.« Der Krieg macht auch vor der Kinderwelt der fünfjährigen Frieda nicht halt: »Von den anderen Kindern hat man gewusst, dass der Vater fort ist. Der Vater ist Soldat oder der große Bruder ist Soldat. Viele sind nicht mehr nach Hause gekommen.«
In der Heimat muss das Leben weitergehen. »Der Krieg war für viele Familien sehr tragisch und hat die Familienverhältnisse verändert, weil der Ernährer nicht vorhanden war oder derjenige, der die Wirtschaft geführt hat. In jedem bürgerlichen Haus waren Angestellte. Jeder hat seinen Knecht gehabt, jeder hat sein Dienstmädel gehabt. Auch die Knechte wurden eingezogen.«
Als Ersatz werden Kriegsgefangene auf die Höfe verteilt, auch daran erinnert sich die 101-Jährige noch lebhaft. »Eine Zeit lang waren in Rust russische Gefangene bei den Leuten beschäftigt, als Knechte. Sie haben in der Wirtschaft gearbeitet. Mein Großvater hat auch einen ›Iwan‹ gehabt. Die Wirtschaft ist halt behelfsmäßig geführt worden. Man hat weitergelebt, in bescheidenem Maße. Der Großteil der Menschen auf dem Land war Selbstversorger. Die Bauern haben Mehl und andere Produkte abliefern müssen. Man hat sich schon zu helfen gewusst, hat ein bisschen was zur Seite gelegt. Man hat es so eingerichtet, dass man sich etwas als Vorrat behalten hat.«
1914
Berta Stimpfl,
geboren 1911,
Südtirol
Zwölf Kinder drängen sich in der Stube, aber es ist ungewöhnlich ruhig. Nur Berta und die beiden Jüngsten weinen. Auch sie verstehen schon, dass heute ein besonders trauriger Tag ist. Der Vater muss fort, fort in den Krieg. Die älteren Kinder versuchen, nicht zu zeigen, wie ihnen zumute ist. Sie wollen es dem »Tata« nicht noch schwerer machen, als es ohnehin schon ist. Wie die Mutter, die immer stark und gefasst ist. Bald schon werden sie allein sein mit ihr und der vielen Arbeit auf dem Hof. Die Geschwister wissen, dass sie jetzt noch stärker werden mitanpacken müssen. Sie werden hart arbeiten. Alles werden sie tun, was getan werden muss. Wenn nur der Vater wieder heimkommt.
Den Abschied von ihrem Vater an einem kalten Herbstmorgen 1914 hat Berta Stimpfl ihr Leben lang nicht vergessen: »Wir waren alle traurig. Sie können sich das vorstellen, der Vater fort von uns und so viele Kinder. Er muss in den Krieg. Wir haben schon verstanden, was Krieg ist. Wir wussten nicht, ob er noch einmal kommt. Diese Sorgen hat man schon als Kind, als Kleinkind. Das wichtigste Ereignis war, dass der Vater fort war und wir alleine mit der Mutter. Die Mama ist traurig gewesen, alleine mit den vielen Kindern. Zwölf Kinder sind wir gewesen und sie musste arbeiten.«
Die Mutter versucht, den Kindern ihre Sorgen nicht zu zeigen. »Geweint hat sie nur im Stillen, nicht vor uns Kindern. Sie wollte es uns ersparen, diesen Verdruss. Aber Sie können sich vorstellen, mit so vielen Kindern, daheim, alleine. Zum Arbeiten hat man niemanden bekommen. Die Männer mussten alle in den Krieg gehen, alle waren weg von daheim.«
Innerhalb weniger Tage wird Ende Juli 1914 die Generalmobilmachung der k. u. k. Armee bis in die entlegensten Weiler spürbar. Die bürokratische Maschinerie ist gut geölt. Schon in den ersten Kriegstagen werden alle wehrfähigen Männer einberufen und in des »Kaisers Rock« gezwungen. Der Wiener Feuilletonist Raoul Auernheimer erlebt den Wandel von der Idylle zur Kriegsgesellschaft im scheinbar unendlich friedlichen Ort Altaussee im Salzkammergut. Er schreibt darüber in der Wiener Neuen Freien Presse. Sein Bericht erscheint am 1. August. Es ist der Tag der Kriegserklärung Deutschlands an das russische Zarenreich. »Viele von uns hat ja die Kriegserklärung in der Sommerfrische überrascht, in irgendeinem stillen, weltabgeschiedenen Tal, wohin sie sich zurückgezogen hatten, zurückgezogen haben glauben. Denn die Ereignisse wussten sie zu finden und machten sie zu Zeugen derselben Szenen, wenn auch in anderer Form. Die Einber...