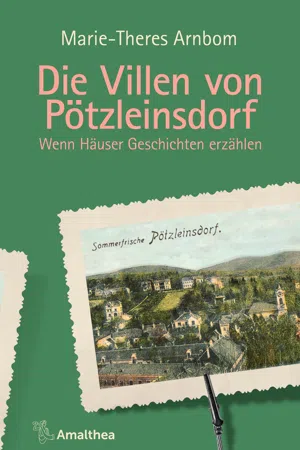![]()
Weg 1
1 Die türkische Freundin meiner Großmutter
Pötzleinsdorfer Straße 42
Meine Großmutter hat mir immer von ihrer türkischen Freundin erzählt, die auf der Pötzleinsdorfer Allee in einer wunderschönen Villa wohnte. Mehr Informationen habe ich nicht, als ich mit der Recherche beginne – aber ich weiß immerhin, welches Haus gemeint ist. Und so tauche ich in verschiedene Quellen ein, befrage das Grundbuch, das Adressbuch, verschiedene Tageszeitungen und Bibliotheken. Was ich herausfinde, erstaunt mich sehr. Meszureh ist der Name besagter Freundin, wenige Jahre älter als meine Großmutter. Ab 1923 wohnt sie in der Villa, die ihre Eltern 1925 erwerben. Ihre Mutter heißt Ikbal Akif Akev, geborene Hikmet, ihr Vater Nuri Akif Akev – man kann sich vorstellen, dass die österreichischen Behörden diese Nachnamen immer unterschiedlich schreiben. Auch einen Bruder namens Hasan hat Meszureh. Seine Dissertation finde ich in der Nationalbibliothek, 1937 veröffentlicht unter dem Titel Die monetäre Krisen- und Konjunkturtheorie.
Die repräsentative Villa der Familie Akif
Hasan promoviert am 14. Dezember 1937, scheint aber während seiner Studienzeit viel Zeit auf dem Tennisplatz zu verbringen, meist mit anderen jungen Herren aus den Pötzleinsdorfer Villen, darunter Erich Winterstein, über den meine Großmutter wohl die Familie Akif kennengelernt hat. Kein Wunder also, dass das Wiener Sportblatt in der Rubrik Tennis am 24. Dezember 1937 berichtet: »Zwei neue Doktoren verzeichnet der Wiener Tennissport, wenn auch die Promotionen zwei Ausländer betreffen. Unser sympathischer türkischer Kamerad und Erich Maria Hirth, der jugoslawischer Staatsbürger ist, haben ihre Studien beendigt und wurden vor kurzem zu Doktoren der Handelswissenschaften promoviert. Den beiden jungen Doktoren, die wieder einmal gezeigt haben, daß man ein tüchtiger Sportler und ebenso tüchtiger Arbeiter sein kann, unsere herzlichsten Glückwünsche. Dr. Akif wird übrigens in der nächsten Zeit Wien verlassen, weil er in seiner Heimat seiner Militärdienstpflicht Genüge leisten muß.«
Doch woher kommt die Familie Akif? Die Recherche erweist sich zunächst als etwas unergiebig, doch dann eröffnet sich eine unerwartete Welt: Saloniki. Eine faszinierende Stadt an der Schwelle zwischen französischem Esprit und ottomanischer Tradition. Ein moderner Hafen ermöglicht den Handel mit Wolle, Tabak und vielem mehr und lässt die Wirtschaft der Stadt wachsen und gedeihen. Die Bevölkerung ist international und bringt das Flair der weiten Welt an Kaffeehaustische, in geräumige Villen und Unternehmenszentralen. Islamische Architektur verbindet sich mit westlichen Stilelementen, traditionelle Kleidung mit aktueller Mode.
Eine weitere Spur führt mich mitten hinein in die spannende und etwas geheimnisvolle Geschichte einer Bevölkerungsgruppe, der sogenannten Dönmes. Drei große Familienclans prägen diese Gruppe, deren Entstehungsgeschichte kurios anmutet: Schabbtai Zvi, ein jüdischer Gelehrter, ernennt sich selbst im 17. Jahrhundert zum Messias und kann einige Gefolgsleute für diesen Gedanken gewinnen. Von Smyrna zieht er nach Jerusalem und letztendlich nach Konstantinopel, wo ihn der Sultan jedoch verhaften lässt und ihn mit Druck dazu zwingt, zum Islam zu konvertieren. Das passiert im Jahr 1666 – und mit Zvi konvertieren auch seine Anhänger. Sie gelten nun als Muslime, bleiben aber ausschließlich unter sich, haben eigene Moscheen und einen speziellen Ritus. Kein Wunder, dass diese sehr abgeschlossene Lebensweise den besten Nährboden für Verschwörungstheorien bietet.
Die Dönmes zieht es nach Saloniki, eine Stadt mit mehrheitlich jüdischer Bevölkerung, die zumeist aus Spanien hierher geflüchtet ist. Jede Bevölkerungsgruppe bewohnt einen abgegrenzten Stadtteil, doch geschäftlich treffen einander alle – Juden, Muslime, Christen und eben Dönmes.
Ihre Werte spiegeln sehr stark die liberalen, weltoffenen Strömungen der westlichen Welt wider, aber auch der jungtürkischen Bewegung des Atatürk. Um diese Ansichten weiterzugeben, begründen die Dönmes Anfang des 20. Jahrhunderts eigene Schulen. Deren Erziehungsmethoden ähneln den modernen, aufgeklärten Konzepten in Europa um diese Zeit: Spiritus Rector ist Şemsi Efendi, der großen Anfeindungen ausgesetzt ist – denn die Kinder dürfen spielen und werden zum Turnen angehalten. Seine Schule wird überfallen und verwüstet – vor allem die Schultafel wird zum Hassobjekt, denn sie gilt den Fanatikern als Inbegriff der Liberalität.1
Trotzdem gilt Efendis Schule als Vorbild für andere, zum Beispiel für die Terraki-Schule der Familie Kapanci, gegründet 1879 von drei Brüdern Kapanci und Hasan Akif. Die wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt betreiben dieses Bildungsinstitut, darunter Händler, Bankiers, Freiberufler und Beamte. Erstmals wird es auch Mädchen ermöglicht, eine Schule zu besuchen. Hasan Akif setzt sich sehr für die Schule ein – seine sechs Töchter zählen zu den Schülerinnen, ebenso seine Enkelin. Die Mädchen bekommen die bestmögliche Erziehung ihrer Zeit. Hasans Tochter Emine und Sohn Hüsnü wirken auch als Lehrer.2
Die Schule wächst, 1907 besteht sie bereits aus drei Gebäuden, einem Internat sowie je einer Schule für Buben und Mädchen. Unterrichtet wird neben den klassischen Fächern und Religion vor allem Französisch, um wirtschaftliche Kontakte nach Mitteleuropa zu erleichtern. In Kombination mit Buchhaltung, Wirtschaft und Rechnungswesen, aber auch Wirtschaftsrecht und korrekter Geschäftskorrespondenz wird eine neue Generation bestens ausgebildeter junger Menschen in die Welt geschickt. 1908 wird eine eigene Mädchen-Wirtschaftsschule gegründet – sie bietet dieselbe Ausbildung wie für die Buben.
Eine neue Schule für aufgeklärte und moderne türkische Bürger – so lautet das Konzept, das auch in Wien ein Pendant hat: Die Schule der Eugenie Schwarzwald. Der Lehrplan zeigt viele ähnliche Facetten, appelliert an das eigenständige Denken von Lehrern und Schülern, legt Wert auf Bewegung – die damals so moderne »schwedische Gymnastik« wird in Wien genauso wie in Saloniki unterrichtet. Hinter diesem Begriff verbirgt sich eine Mischung aus Geräteturnen und Heilgymnastik mit dem Ziel, den Körper zu stärken und gegen Krankheiten widerstandsfähig zu machen. Heute etwas ganz Selbstverständliches, doch Anfang des 20. Jahrhunderts kann diese Art der Bewegung als revolutionär angesehen werden, steht sie doch auch Mädchen und Frauen offen. Die Forderung nach einer täglichen Turnstunde in der Schule hat es schon vor mehr als 100 Jahren gegeben – und damals setzt man diese auch ganz selbstverständlich um.
Es geht überhaupt um den Zusammenhalt, um gemeinsame Werte und Moralvorstellungen, um Eigenschaften wie Selbstkontrolle, Geduld, Disziplin und Respekt. Diese Ideen werden den Schülern und Schülerinnen vermittelt und geben ihnen eine gute Basis für ihr Leben mit auf den Weg. Ein Weg, der viele nach Mitteleuropa führt. Nationalismus hat in diesem Denken keinen Platz, eine liberale, weltoffene Sicht der Dinge steht im Vordergrund. Kein Wunder, dass sich Meszureh und ihr Bruder Hasan in diesen liberalen Wiener Kreisen bewegen und auch wohlfühlen – die Werte sind gleich, Religion spielt keine Rolle.
Ihr Großvater Hasan Akif zählt zu den größten Tabakhändlern, sein Unternehmen beliefert nicht nur Europa, sondern auch Nordamerika. Außerdem besitzt seine Familie in Saloniki das Kaffeehaus des Hotels Olympos und das Hotel Izmir.3
Er begründet eine Zigarettenfabrik in München. Als er im Jahr 1917 stirbt, machen es die Kriegswirren unmöglich, dass er in seiner Heimat Saloniki beigesetzt wird. Doch so bleibt ihm auch erspart, das Ende der Blütezeit Salonikis zu erleben: Die Verträge von Lausanne aus dem Jahre 1923 besagen, dass Griechenland und die Türkei die jeweils anderen Bürger austauschen – die Türken müssen also Saloniki verlassen ebenso wie die Griechen die Türkei. Ein Umstand, der heutzutage in Mitteleuropa kaum mehr bekannt ist, aber mehreren 100 000 Menschen die Heimat genommen hat.
Was passiert mit den Dönmes in Saloniki? Der österreichische Diplomat Theodor Ippen schreibt in der Neuen Freien Presse am 18. Oktober 1923: »Endlich müssen hier auch die 20 000 Dönme (zum Islam bekehrte Juden) aus Saloniki erwähnt werden: dieselben werden der Türkei ein wertvolles Material für Beamte und für den Handel bieten: der bedeutendste Finanzmann der Türkei, Dschawid Bey, ist ein Dönme, er war Führer der Jungtürken, dann Finanzminister im jungtürkischen Kabinett 1913 bis 1918 und ist jetzt Kommissär der türkischen Regierung im Konseil der internationalen Staatsschuldenverwaltung. Mit Interesse kann man auch entgegensehen, ob die 80 000 spanischen Juden in Saloniki sich der Auswanderung in die Türkei anschließen werden; ihr Verhältnis zur griechischen Bevölkerung ist kein gutes, sollten sie nach Smyrna und Konstantinopel auswandern, so werden sie dort bald den Handel den dortigen Griechen strittig machen.«
Hasan Akifs Sohn Nuri muss daher in Saloniki sein Vermögen anmelden, wird im Zuge dessen enteignet und verliert seine Villa – von Wien aus versucht er, eine Entschädigung zu erhalten.4 Wenige Jahre später werden die Nationalsozialisten in Deutschland und Österreich ähnlich vorgehen. Nuri lebt ab 1923 mit seiner Frau und seinen Kindern in Pötzleinsdorf. Seine Tochter Meszureh, die Freundin meiner Großmutter, heiratet 1935 Giorgio Minas, der im Nachbarhaus meiner Großmutter in der Alser Straße aufgewachsen ist – ein großer Freundeskreis. Sie übersiedeln nach Lugano und leben schließlich in Genua. Die Eltern Nuri und Ikbal verlassen Wien am 22. August 1939 und gehen nach Istanbul – in Wien zu bleiben erscheint ihnen wohl zu riskant, obwohl sie Muslime sind. Die Nazi-Postillen hetzen gegen Dönmes und stellen krause Verschwörungstheorien auf, in denen alle Dönmes zugleich auch Freimaurer und somit Feinde seien – keine Atmosphäre, in der man gerne lebt. Die Kinder sind im Ausland, alle Freunde rundherum in Angst und Schrecken, verhaftet, ermordet oder geflohen.
Villa Akif und ein Salettl als Relikt vergangener Zeiten
Meszurehs Mutter Ikbal stirbt 1940 in Istanbul, ihr Nachlass wird durch die Behörden ordnungsgemäß abgewickelt, ohne die sonst üblichen Schikanen.5 Ihr Anteil an der Villa gehört nun ihren Kindern, die jedoch nie mehr dorthin zurückkehren.
![]()
2 »Friendships totally mixed …« Familie Broch
Pötzleinsdorfer Straße 50, später 33
Am 16. März 1938 sind die 64-jährige Laura Broch, ihre betagte Mutter Cä...