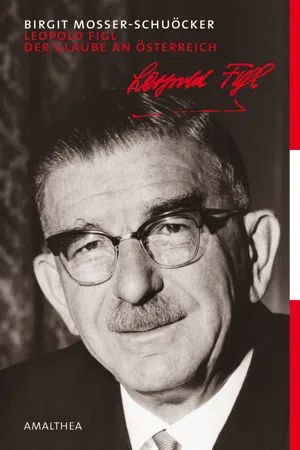![]()
Teil III: Glaube
9. KAPITEL
Österreich ist auf das Wohlwollen der Besatzungsmächte angewiesen. Das wird die nächsten zehn Jahre so bleiben.
Vom Keller in die Kommandantur: April 1945
Wenn er nur endlich Luft bekommen würde. Ruhig, ganz ruhig. Der Mann, der sich unter einem Berg aus alten Kartoffelsäcken versteckt hält, versucht möglichst gleichmäßig zu atmen. Obwohl es kühl ist im Keller, ist seine Stirn feucht. Stimmen dringen an sein Ohr.
„Der Figl soll hier versteckt sein, das Dreckschwein. Wo ist er?“, brüllt eine Stimme im verhassten Kommandoton.
„Der Figl?“, fragt die Hausmeisterin. „Da is er net. Der war doch eing’sperrt.“
„Dann würden wir ihn ja nicht suchen, du blöde Gans! Also, wo ist er?“
Sein Herz rast. Wenn es die Hausmeisterin jetzt mit der Angst bekommt … Schritte nähern sich. Es müssen mehrere Personen sein, vermutlich eine SS-Streife. Der Schein einer Taschenlampe dringt durch den groben Stoff der Säcke. Eine Bewegung, ein Husten – und alles ist vorbei. Er wird Hilde und die Kinder nie wieder sehen.
„Na ja, Herr Offizier, er war scho da, der Figl. Aber er is aufs Land, sei Frau suachen und die Kinder“, stammelt die alte Frau. Sie macht ihre Sache gut.
Leopold Figl hört die SS-Männer fluchen, dann verschwindet der Schein der Taschenlampe. Schritte entfernen sich, die Tür fällt krachend zu.
Nach einer Ewigkeit sagt die Hausmeisterin: „Die SSler san weg. Kumman S’ ausse, Herr Figl!“
Aus einem anderen Teil des dunklen Kellers kommen einige Wehrmachtssoldaten wieder zum Vorschein, die ebenfalls vor der SS-Streife in Deckung gegangen sind. Feuerzeuge flammen auf, Zigaretten werden herumgereicht. Für den Moment ist die Gefahr gebannt.
„Russen!“, sagt ein abgehärmter, älterer Offizier, der sich als „Posten“ erbötig gemacht hat. „Sie kommen!“
Wenig später poltern drei Rotarmisten die Stiegen hinunter. Sie halten Maschinenpistolen im Anschlag. Die Soldaten heben die Hände. Die Hausmeisterin und einige Nonnen, die ebenfalls Zuflucht im Keller gesucht haben, weichen ängstlich zurück. Leopold Figl erhebt sich. „Du Soldat!“, radebrecht einer der Russen und deutet auf seine geschorenen Haare. Der Mann, der erst Tage zuvor der Todeszelle entronnen ist, schüttelt den Kopf. Dann zieht er seinen Entlassungsschein aus der Hosentasche. Der Älteste der drei Sowjetsoldaten beäugt das Papier misstrauisch. Dann, nach Sekunden, die wie eine Ewigkeit scheinen, nickt er bedächtig: „Charaschó. Du nix Soldat!“, sagt der Russe, und ein Grinsen breitet sich über seinem Gesicht aus.
Die Rotarmisten ziehen weiter. Einige Tage später, am 12. April, kommen wieder sowjetische Soldaten in das Haus Kundmanngasse 24. Sie wissen, wen sie suchen. Sie sollen »Gospodin Figl« zum Eroberer Wiens, Marschall Tolbuchin, bringen. Vermutlich hat Figl durchaus gemischte Gefühle, als er den Russen folgt. Er hat keine Ahnung, was ihm bevorsteht. Vielleicht hat der Gesuchte auf dem Weg Gelegenheit, den »Befehl Nr. 1 des Militärkommandanten« zu lesen, der an Häusern und Litfaßsäulen angeschlagen ist. Punkt 1 lautet: »Alle Gewalt ist in meiner Person konzentriert als dem Repräsentanten des Oberkommandos der Roten Armee. Die Anordnungen des Ortskommandanten der Roten Armee sind für die Bevölkerung bindend und haben Gesetzeskraft.«
Was will der Beherrscher Wiens von Leopold Figl?
Die Fahrt geht zum Palais Auersperg, wo ihn der Stadtkommandant schon erwartet. An seiner Seite ist Johann Koplenig, der Vorsitzende der KPÖ, was die Verständigung erleichtert. Der Befehl ist ebenso eindeutig wie schwierig: »Gospodin Figl«, der den Russen als Bauernführer bekannt ist, soll Lebensmittel auftreiben, um die Wiener Bevölkerung zu versorgen. Aber: Rund um Wien wird noch gekämpft. Figl hat keine Vorräte, kein Saatgut, keine Leute und keine Fahrzeuge. Er hat nichts, bis auf den Willen, seinen Landsleuten zu helfen. Das muss genügen.
Im Palais Auersperg trifft Figl auch Vertreter der Widerstandsbewegung 05, die er schon aus Dachau kennt. Unter ihnen seinen Freund Franz Sobek, der sich bald daranmacht, die Beamtenschaft um sich zu scharen.
Der ehemalige Reichsbauernbunddirektor bezieht wieder sein altes Büro in der Schenkenstraße. Auf dem Dach wird die rot-weiß-rote Fahne gehisst und auch die grüne des Bauernbundes. Symbole sind gut für die Moral, für den gemeinsamen Willen. Einen gemeinsamen Willen brauchen die Männer der ersten Stunde notwendiger als alles andere. »Wir errichteten das österreichische Amt für Landwirtschaft und Ernährung, denn Ministerium gab es noch keines; wir hatten noch keine Regierung, die Gemeinde Wien noch keine Verwaltung, einzig und allein der Bauernbund in der Schenkenstraße funktionierte«82, erzählt Figl später nicht ohne Stolz.
Eduard Hartmann, einer seiner ersten Mitarbeiter, berichtet über jenen denkwürdigen Tag: »An den Toren des Bauernbundes und des Kammerhauses brachten wir die in russischer Sprache handgeschriebenen Dokumente an, durch die bestätigt war, dass in diesem Gebäude zur Sicherung der Ernährung des österreichischen Volkes gearbeitet wird. Das war – noch unter dem Eindruck des Kanonendonners des zu Ende gehenden Krieges – die Stunde des Wiedererstehens von Bauernbund und Landwirtschaftskammer.«83
Leopold Figl und seine Mannen verfügen nun zumindest über ein Gebäude. Es wird vorerst zum Mittelpunkt der ÖVP, die wenige Tage später gegründet wird. Am 16. April nimmt Figl gemeinsam mit dem Sozialdemokraten Oskar Helmer das Niederösterreichische Landhaus in Besitz, angeblich mit der Bemerkung: »Hier ist nicht Niederdonau, hier ist Niederösterreich!« Es wird ein Landesausschuss gegründet, in dem sich Leopold Figl ausdrücklich als Platzhalter für Landeshauptmann Reither versteht, der noch nicht aus dem KZ zurückgekehrt ist. Am 18. April bestätigen die Sowjets Leopold Figl als provisorischen Landeshauptmann von Niederösterreich.
In jenen turbulenten Tagen jagt ein Ereignis das nächste. Am 17. April 1945 wird im Schottenstift im 1. Bezirk die Österreichische Volkspartei formal gegründet. Obmann ist Leopold Kunschak, weitere Gründungsmitglieder sind Figls alte KZ-Kameraden: Hans Pernter, Lois Weinberger und Felix Hurdes sowie Julius Raab. »Das war ein Wirbel und ein Durcheinander, den sich heute kaum noch jemand vorstellt. Als wir die ersten Schritte außer Haus wagten, gab es noch manche Tieffliegerangriffe und eine Reihe anderer Gefahren, die durchaus ernst genommen werden mussten. Wir sind trotzdem drauflos marschiert und haben das verwirklicht oder zu verwirklichen begonnen, wofür wir gekämpft und gelitten haben«84, schreibt Weinberger in seinen Erinnerungen.
Zwei Jahre später, am 18. April 1947, wird Leopold Figl vor dem ersten Bundesparteitag der ÖVP erklären: »Wir haben es wiederholt gesagt, man hat es uns anfangs nicht immer recht geglaubt, wir sind keine Nachfolgepartei, sondern wir sind eine neue Partei. […] Wir haben nichts von vorgestern übernommen, aber wir versuchen aus dem Schutt von vorgestern, der uns nach der politischen Weltkatastrophe 1938 im Jahre 1945 überblieb, all das zu retten, was uns des Rettens wert scheint.«85
Im April 1945 machen sich die österreichischen Politiker, die sieben Jahre keine sein durften, daran, den Schutt des untergehenden »Dritten Reiches« zu beseitigen. Der 75-jährige Karl Renner, der erste Staatspräsident der Republik, wagt es, am Semmering gegen die Ausschreitungen sowjetischer Soldaten zu protestieren. Bald schon beginnt der alte Herr seinen Mut zu bereuen. Er wird auf ein Lastauto verladen und weggebracht. Eine Reise ohne Wiederkehr? Es kommt anders, als Renner vermutlich befürchtet hat. Eine größere Anzahl hoher Offiziere empfängt ihn, die über die Geschichte Renners Bescheid wissen. Es entspinnt sich eine Diskussion über die momentane Lage, und Renner betont, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung nichts anderes wünsche als die Wiederherstellung der Republik Österreich.
Nach einem weiteren Gespräch mit dem sowjetischen Generaloberst Alexej Scheltow wird Renner von den Russen in Wien einquartiert und beginnt mit der Bildung einer provisorischen Regierung. Am 23. April einigen sich in Renners Hietzinger Wohnung Vertreter der Sozialisten, der Volkspartei und der Kommunisten auf die Zusammensetzung dieser Regierung.
Felix Hurdes, der neue Generalsekretär, hat in parteiinternen Gesprächen ein Amt in dieser Regierung abgelehnt. Insider Weinberger schreibt darüber: »So waren wir gezwungen, einen neuen Kandidaten zu nennen. Irgendwer, ich glaube, dass es Kunschak selbst war, nannte dann den Exponenten der Bauernschaft, Ing. Figl. So kam dieser schon in das erste Kabinett Renner und damit auch in den politischen Vordergrund. Ich bin überzeugt, dass die damalige Kandidatur Figls in weiterer Folge auch zu seiner Obmannschaft in der Volkspartei und schließlich zur Übernahme der Kanzlerschaft durch ihn geführt hat. So können Zufälle und wenige Minuten für sehr weit tragende Entscheidungen von Bedeutung werden. Hurdes, der sehr viel mitgemacht hatte, magenleidend war und dessen Nerven damals auch etwas auszulassen drohten, wäre vielleicht auch gar nicht so durchgekommen wie der weitaus robustere und zähere Bauernsohn Figl. Dessen Stärke war es schon damals und ist es bis zur Stunde geblieben, dass er mehr aushielt als alle anderen. Figl hat von seinen Vätern eine Zähigkeit und Robustheit vererbt bekommen, die ich oft bewunderte und die gewiss viel dazu beigetragen hat, dass unser Land über manche auch sehr kritische Situation hinwegkam.«86
Die Proklamation: 29. April 1945
Es zieht. Unwillkürlich schlingt Leopold Figl den weiten Mantel enger um seine knochige Gestalt. Von draußen dringt kühle Luft in den hohen Raum. Der April 1945 ist wenig frühlingshaft, und die Fenster des ehrwürdigen Rathaus-Sitzungssaales sind noch ohne Glas. Doch was tut das schon. Heute ist ein großer, ein feierlicher Tag. Die provisorische Regierung wird das Parlament in Besitz nehmen. Gestern erst hat die Wiener Feuerwehr Reichsadler und Hakenkreuze von den Fahnenmasten vor dem Parlament geholt. Die Russen haben den armen Feuerwerkern mit Sibirien gedroht, wenn die Nazi-Symbole nicht bis heute verschwunden wären. Zuerst war die Aufregung groß, doch dann hat sich ein mutiger Mann bereiterklärt, hinaufzusteigen und die Embleme des Dritten Reiches zu entfernen. Und heute ist es so weit: In weniger als einer halben Stunde wird der Regierungschef im Parlament seine Erklärung verlesen.
Leopold Figls Blick fällt auf den weißhaarigen Mann, der den Vorsitz führt. Ob Karl Renner der Richtige ist, um den Russen Paroli zu bieten? Vor sieben Jahren hat er sich nicht gerade wie ein österreichischer Held verhalten. Sogar in Dachau hat der ehemalige „Schutzhäftling“ von dem Interview gehört, das Renner gegeben hat. „Ich stimme mit ja“, hat er verkündet und sich so vor den Karren der Nazi-Propaganda spannen lassen. „Ja“ zum „Anschluss“, „Ja“ zur Auslöschung Österreichs. Der erste Kanzler der Republik hat dem Untergang des Staates, den er selbst mitbegründet hat, applaudiert. Er und Millionen andere haben sich in der Stunde der Not von der Heimat abgewandt. Das Gefühl der Verzweiflung, als in Dachau das Ergebnis der Volksabstimmung triumphierend bekannt gegeben wurde, ist plötzlich ganz nah. So etwas darf es nie wieder geben. Die Österreicher müssen lernen, zu ihrer Heimat zu stehen.
Wenig später verlassen 30 Männer in alten, abgewetzten Anzügen das Rathaus in Richtung Parlament. Karl Renner und Bürgermeister Theodor Körner, fast gleich alt und ebenso weißhaarig, an der Spitze; Leopold Figl, Adolf Schärf und Johann Koplenig in der zweiten Reihe. Figls Gedanken wandern zu jenem Tag, als er auf der anderen Seite des Rathauses aus dem „Grauen Haus“ kam. Der Tag, seit dem er keine Angst mehr haben muss, dass … Nein, er will nicht mehr daran denken. Das ist vorbei, aus und vorbei. Sie haben keine Macht mehr über ihn.
Plötzlich schiebt sich ein Arm unter den seinen: Sein Nebenmann, der Sozialdemokrat Schärf, hat sich untergehakt. Leopold Figl lächelt und tut dasselbe bei Koplenig, dem Kommunisten. In diesem Moment spüren es alle drei: Sie sind die Jungen, auf sie kommt es an. Ob rot, schwarz oder kommunistisch spielt keine Rolle; sie müssen zusammenarbeiten. Die Heimat braucht sie.
Schon sind sie bei der Parlamentsrampe angelangt. Alles erscheint ein wenig unwirklich. Sowjetsoldaten sind als Ehrenformation angetreten, sie präsentieren ihre Maschinengewehre. Stadtkommandant Blagodatow begrüßt die Regierungsmitglieder. Unten, am Ring, sammeln sich immer mehr Menschen. Obwohl es kein reguläres Radioprogramm und keine regelmäßig erscheinenden Zeitungen gibt, muss die Bevölkerung von dem heutigen Geschehen erfahren haben. Die provisorische Regierung nimmt das Parlament wieder in Besitz. Sieben lange Jahre war das ehrwürdige Gebäude am Ring zum „Gauhaus“ degradiert, aber jetzt soll es wieder dem österreichischen Volk dienen. Als sichtbares Zeichen dafür wird die rot-weiß-rote Fahne gehisst. Jubel brandet auf. Niemand hat diese Leute herbestellt, und doch sind sie gekommen, um ihre neue Regierung zu begrüßen.
Leopold Figls Blick wandert von einem Gesicht zum anderen. Tief in den Höhlen liegende Augen, abgehärmte Gesichtszüge, schlotternde Kleider. Männer und Frauen, die vor ihrer Zeit gealtert sind. Doch da ist noch etwas: Man sieht es in ihren Augen, an ihrem Blick. Die Menschen vor dem Parlament haben zum ersten Mal seit Monaten, seit Jahren wieder Hoffnung. Hoffnung, dass es wieder besser wird in diesem Land. „Wir werden sie nicht enttäuschen“, denkt der Mann, der schon bald Bundeskanzler sein wird.
Adolf Schärf erinnert sich: »Uns war feierlich zumute, als wir die Rampe hinaufstiegen; wir bemerkten in vieler Augen Tränen. […] Unter der Aufsicht von russischen Soldaten wurde auf den Masten die rot-weiß-rote Fahne hochgezogen. Viele von uns schluchzten vor Freude auf. Und Renner sprach vor dem sowjetischen Stadtkommandanten Blagodatow und den Zehntausenden von Wienern ein großes Wort: ›Nehmen Sie die Versicherung entgegen, dass wir uns bemühen werden, so bald es die Umstände erlauben, alle Erwachsenen Österreichs zur Urne zu rufen, damit sie sich selbst regieren, durch eine von ihnen selbst eingesetzte Regierung. […] Es lebe die unabhängige, freie, Zweite Republik Österreich. […] Freundschaft für alle! Freiheit für alle! Glück und Segen dem neuen Österreich!‹«87
Feierliche Worte. Unabhängig und frei ist dieses Österreich am 29. April 1945 freilich keineswegs. Die Rote Armee hat Wien und weite Teile des Burgenlands, der Steiermark und Niederösterreichs erobert. So weit erstreckt sich das »Hoheitsgebiet« der provisorischen Regierung, die dabei aber völlig vom Wohlwollen der Sowjets abhängig ist. Die drei westlichen Alliierten betrachten die Regierung von Stalins Gnaden mit Misstrauen.
Auch die Proklamation, die Karl Renner im beschädigten Parlament verliest, enthält starke Worte. Der Mann, der für Hitlers Abstimmung geworben hat, stellt ehemal...