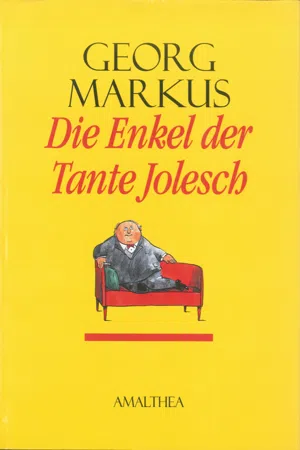![]()
»DAS STÜCK HAT KA GARDEROBER
G’SCHRIEBEN«
Schauspieler und ihre Marotten
Das Problem des Schauspielers sei es, so sagt man in eingeweihten Kreisen, dass er zu Hause weiterspielt. Uns soll diese spezifische Angewohnheit der Theaterleute insofern recht sein, als sie uns eine Vielzahl von Anekdoten beschert. Von Helmut Qualtingers Manie zu Hause und anderswo »weiterspielen« zu müssen, war schon die Rede, hier soll noch ein mit seinem Freund Kurt Sowinetz ausgehecktes Beispiel dafür aufgezeigt werden.
Ich hatte einmal das Vergnügen, die beiden Urkomödianten bei einer ihrer gemeinsamen Aktionen zu erleben. Und zwar Schlittschuh laufend.
Das Außergewöhnliche an der Vorführung im Freundeskreis war, dass die beiden a) keine Schlittschuhe trugen, und dass ihnen b) weit und breit keine Eisfläche zur Verfügung stand – das Ganze ereignete sich vielmehr bei hochsommerlichen Temperaturen im Haus von Heinz Marecek in der Nähe von Hollabrunn.
»Quasi« und »Sowerl« spielten uns einen Eislaufplatz vor – sie drehten ein paar Runden um den Esstisch, liefen Schlingen und Pirouetten und tanzten sogar den Herzerlwalzer. Es war ein Kabinettstück auf staubtrockenem Boden, so hinreißend choreografiert, dass man fürchten musste, die zwei Komödianten könnten jeden Moment ins Schlittern geraten.
Sowinetz fand in seiner Freizeit auch handfestere Betätigungsfelder. Der begeisterte Bastler siedelte sich in der Nachbarschaft seines Freundes Fritz Muliar am Donauoderkanal an, wobei jede der beiden einander benachbarten Parzellen über einen eigenen Badesteg verfügte. Angeregt durch die Nähe des Wassers, begann sich Kurt mit dem Bau eines Modellbootes zu beschäftigen. Und so opferte er ein halbes Jahr lang jede Minute seiner freien Zeit, um ein kleines Schiff zu konstruieren, das mittels Fernsteuerung nicht nur vor, zurück, links und rechts fahren konnte – es war vielmehr auch in der Lage, durch einen elektronischen Impuls ein an Bord befindliches Tonband in Gang zu setzen.
Eines Sonntags, an dem der Nachbar Fritz Muliar friedlich vor seinem Häuschen in der Sonne lag, unternahm das Boot vom Sowinetz-Ufer aus seine Jungfernfahrt. Exakt vor dem Muliar-Steg schaltete sich das Magnetophon ein, aus dessen Lautsprecherbox nun die Worte tönten: »Achtung, Achtung, hier spricht der Kapitän! Fritz Muliar ist ein Arschloch, Ende!«
Danach drehte das Schiffchen um und kehrte zum Sowinetz’schen Ausgangshafen zurück. Kurt hatte ein halbes Jahr Arbeit daran gesetzt, um diesen Satz loszuwerden.
Die Karrieren von Sowinetz und Muliar verliefen in der traditionellen Weise Wienerischen Komödiantentums. Auf diverse Kellerbühnen und Kabaretts folgten Volkstheater, Josefstadt und »Burg«. Muliar definierte die beiden letzten Stationen des sehr österreichischen Schauspielerlebens so: »Die Josefstadt ist für einen Kasperl der Himmel auf Erden. Und das Burgtheater ist für einen Kasperl der pragmatisierte Himmel auf Erden.«
Wer heute die Garderoben des »pragmatisierten Himmels« durchstreift, wird vergeblich nach Anekdoten und witzigen Aussprüchen Ausschau halten, wie man ihnen bis vor nicht allzu langer Zeit auf Schritt und Tritt begegnete. Das liegt wohl daran, dass sich das moderne Regietheater so furchtbar ernst nimmt und die Originale dieser Bühne (wie so vieler anderer auch) beinahe schon ausgestorben sind. Karl Farkas würde heute kaum noch sagen: »Die Anekdote ist ein Witz, der im Burgtheater aufgetreten ist« – denn im Burgtheater treten keine Anekdoten mehr auf.
Halten wir uns also an die Zeiten, da dies der Fall war. Zeiten, die eine Type wie Hugo Gottschlich hervor brachten. Dieser spielte Anfang der sechziger Jahre (neben Heinz Rühmann) im Akademietheater in der Komödie »Mein Freund Harvey« eine kleinere Rolle. Eines Tages passierte ihm, was Schauspieler noch mehr fürchten als eine vernichtende Kritik: Er vergaß, dass er am Abend Vorstellung hatte! Und er war aus irgendeinem, nicht mehr zu eruierenden Grund auch telefonisch nicht erreichbar.
Da kein Ersatzschauspieler aufzutreiben war, wurde die Vorstellung abgesagt und das Publikum nach Hause geschickt. Den durch Rückerstattung der Eintrittspreise entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Schilling musste Gottschlich aus seiner Privatschatulle begleichen.
Als nun der völlig niedergeschlagene Schauspieler am nächsten Tag das Büro des Burgtheaterdirektors Haeusserman betrat, wurde er von diesem freundschaftlich ermahnt: »Mein lieber Gottschlich, wenn Sie das nächste Mal im Zweifel sind, ob Sie spielen sollen oder nicht, dann rufen Sie uns doch bitte an!«
»Das ist es ja, Herr Direktor«, erwiderte Gottschlich, »ich bin nie im Zweifel. Ich weiß es ganz genau!«
Etwas glimpflicher kam der als Sparmeister verschriene Hans Moser in einer ähnlichen Situation davon. Auch ihm war eines Abends entfallen, dass er als Flickschuster Pfrim in Nestroys »Höllenangst« auftreten sollte. Als er gegen halb acht Uhr noch immer nicht im Theater in der Josefstadt eingetroffen war, begann man sich ernste Sorgen zu machen, was mit dem über achtzigjährigen Volksschauspieler geschehen war. Also rief der Abendregisseur in Mosers Villa in Hietzing an. Dieser nuschelte ins Telefon: »Jössas, i hab’s vergessen, i kumm sofort«, warf den Hörer in die Gabel und machte sich auf den Weg.
Ein paar hundert Menschen warteten nun eine volle Stunde, ehe der Komödiant endlich, verschwitzt und abgehetzt, im Theater eintraf. »Herr Moser, wo waren Sie denn so lang?«, überfiel ihn der verzweifelte Regisseur.
Worauf Moser antwortete: »I kann nix dafür, dass es so lang dauert hat, aber die Straßenbahn is nicht und nicht daherkommen.«
Auf die Idee, wenigstens in dieser prekären Situation ein Taxi zu nehmen, wäre er nie gekommen.
Es gibt zahllose Anekdoten über Mosers Sparsamkeit, doch ich scheue mich, sie wiederzugeben, da sein möglicherweise wirklich krankhafter Geiz einen allzu ernsten Hintergrund hatte. Der geniale Menschendarsteller blieb lange unentdeckt und war in der ersten Hälfte seines Lebens zum Auftreten auf billigen Schmierenbühnen verdammt. Moser lebte damals in so ärmlichen Verhältnissen, dass er förmlich hungern musste, woraus seine spätere Existenzangst resultierte, die es im Alter nicht zuließ, das viele Geld, das er verdiente, genießen zu können.
An einer Episode aber, die mir Franz Antel erzählte, will ich doch nicht vorbei gehen, weist sie doch mehr auf Mosers Schlagfertigkeit als auf seine Sparsamkeit hin. Man hatte während der Premierenfeier eines Moser-Films beobachtet, wie der Hauptdarsteller schon zum dritten Mal das gratis zur Verfügung stehende Buffet stürmte. Seine Kollegin Marte Harell sprach ihn offen darauf an: »Sag, Hans, ist es dir nicht peinlich, dreimal Essen zu holen?«
Darauf Moser: »Überhaupt nicht! Ich sag den Leuten jedes Mal, ich hol’s für die Frau Harell!«
Helmut Qualtinger berichtete mir von einem Erlebnis, das ein wenig von der Einzigartigkeit des großen Hans Moser verrät. Die beiden waren 1962 in Erich Neubergs Fernsehverfilmung der »Geschichten aus dem Wienerwald« gemeinsam vor der Kamera gestanden, Moser in der Rolle des Zauberkönigs, Qualtinger als Fleischhauer, der dessen Tochter – dargestellt von Johanna Matz – heiraten soll.
Fünfzehn Jahre später, Moser war bereits tot, wurde der Klassiker Ödön von Horváths neu verfilmt. Diesmal mit Qualtinger als Zauberkönig, der nun aufpassen musste, nicht zu sehr in Mosers Sprachmelodie zu verfallen, so sehr hatte er jedes Wort, jede Silbe von ihm im Ohr. Und wenn er hin und wieder doch zu sehr an Moser erinnerte, forderte ihn der Regisseur Maximilian Schell auf: »Ich bitt dich, moser nicht so!«
Hans Moser hatte, wenn auch erst sehr spät, so gut wie alles erreicht, was ein Schauspieler erreichen kann. Er war durch das Theater bekannt und durch den Film populär geworden. Im Alter aber träumte er davon, die allerhöchsten Weihen seines Berufes zu empfangen. Er träumte davon, auf den Brettern des Burgtheaters zu stehen. Einmal sollte sein Publikum nicht über ihn lachen – sondern über ihn weinen. Der Traum ging in Erfüllung, als Ernst Lothar den Volksschauspieler für die Darstellung des alten Violinspielers Weiring in Schnitzlers »Liebelei« an die »Burg« holte.
Im Rahmen einer Burgtheatertournee reiste Moser in dieser Rolle auch durch Holland. Gleichzeitig war Raoul Aslan, ebenfalls mit dem Burgtheater, als »Nathan der Weise« durch die Niederlande unterwegs. Bei dieser Gelegenheit musste Aslan, der als einer der bedeutendsten Schauspieler seiner Zeit galt und der »Burg« seit Jahrzehnten schon angehörte, vom gewaltigen Unterschied zwischen Film- und Theaterpopularität erfahren. Als Aslan bei der Ankunft am Bahnhof in Amsterdam von keinem einzigen Menschen erkannt oder gar angesprochen wurde, Moser jedoch sofort von einer großen Menschenmenge umringt war, da stieß der Mime verzweifelt aus:
»Iiiich bin das Burgtheater, niiicht der Herr Moser!«
Auch die Welttournee des Burgtheaters im Jahre 1967 gilt es zu erwähnen. Sie führte das Ensemble u. a. in die USA, nach Deutschland, Frankreich, Belgien und zu guter Letzt in das Großherzogtum Luxemburg. Fred Liewehr, der in Nestroys »Einen Jux will er sich machen« den Gemischtwarenhändler Zangler spielte, kam beim Premierenempfang mit Luxemburgs damaligem Ministerpräsidenten Grégoire ins Gespräch. Und da stellte der Schauspieler – der auch als Operettensänger große Erfolge feierte – die naheliegende Frage, ob denn in Luxemburg nicht hin und wieder Lehárs »Graf von Luxemburg« aufgeführt würde.
»Wissen Sie«, erwiderte der Regierungschef, »das ist so eine Sache. Wir lieben unsere Dynastie. Und da dieser ›Graf von Luxemburg‹ ein rechter Filou ist, läuft die Operette bei uns unter dem Titel ›Der Graf von Laxenburg‹.«
Derselbe Fred Liewehr erzählte mir einmal von einer skurrilen Situation, die ihn in jungen Jahren mit Englands nachmaligem König Edward VIII. zusammengeführt hatte. Der Monarch war Anfang der dreißiger Jahre – noch als britischer Thronfolger – samt seiner späteren Frau Wallis Simpson mehrmals in Wien zu Gast. Wien freilich stellte sich damals als triste Metropole dar, es gab fast keinen Fremdenverkehr, Abend- und Nachtlokale standen meist leer. Weil man dem hohen Paar aber »etwas bieten« wollte, engagierte ein rühriger Tourismusobmann mehrere junge Studenten des Reinhardtseminars, die dem Prinzen von Wales Wiener Nachtleben »vorspielen« sollten. Einer der Schüler war Fred Liewehr.
Man setzte die angehenden Schauspieler in das noble Restaurant Zu den drei Husaren, wo das Paar sein Abendessen einnahm. Jeder Student bekam ein Glas Wein, und sie »spielten Gäste«.
Soweit wäre auch alles gutgegangen – hätte nicht vor dem Lokal ein Autobus gewartet, der Liewehr & Co nach dem Diner zur nächsten Station des königlichen Gastes, einem Heurigenlokal in Grinzing, verfrachtete. Nachdem Wiens Künstlernachwuchs auch da in »Gastrollen« brillieren durfte, ging’s weiter in eine Nachtbar. Die jungen Leute spielten abermals Gäste, doch diesmal war’s des Guten zu viel: Der Prinz betrat die Bar, sah zum drittenmal dieselben Gesichter, schmunzelte, drehte sich um – und ging.
Die Künstler hatten ihre Rollen gut gespielt. Nur an der Inszenierung hat’s gehapert.
Als Edward dann König von England und bald darauf infolge seiner Heirat mit eben jener Wallis Simpson nur noch Herzog von Windsor war, gehörte Liewehr bereits dem Ensemble des Burgtheaters an. Sein Repertoire reichte von den großen klassischen Rollen bis zum Petruchio im Musical »Kiss me Kate« an der Volksoper. Für Ernst Haeusserman war er »unter den vielen Sternen des Burgtheaters die Sonne«.
Liewehr war, wie viele Große am Burgtheater, kein Wiener (er kam im mährischen Städtchen Neutitschein zur Welt)....