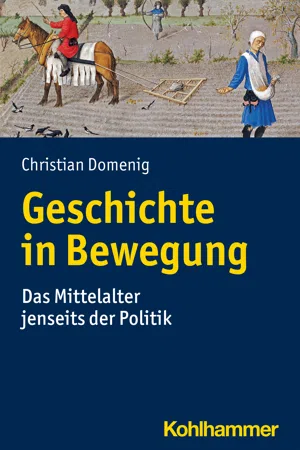
eBook - ePub
Geschichte in Bewegung
Das Mittelalter jenseits der Politik
Christian Domenig
This is a test
Share book
- 254 pages
- German
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Geschichte in Bewegung
Das Mittelalter jenseits der Politik
Christian Domenig
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
Das Ende der 1980er Jahre brachte nicht nur große politische Umbrüche in Europa, sondern auch einen Paradigmenwechsel in der Geschichtswissenschaft. Fortan wird die Mediävistik nicht mehr von politischer Geschichte und der Darstellung von Strukturen dominiert. Vielmehr steht seitdem der Mensch in allen seinen Lebensäußerungen im Mittelpunkt der historischen Betrachtung. Die Kombination von Kulturgeschichte, Historischer Anthropologie und Alltagsgeschichte entfesselte eine kreative Dynamik, durch die unser Verständnis von der Vergangenheit erheblich geschärft wurde.Christian Domenig beschreibt gut lesbar die neuen, erhellenden Wege in eine vermeintlich finstere Epoche.
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is Geschichte in Bewegung an online PDF/ePUB?
Yes, you can access Geschichte in Bewegung by Christian Domenig in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in History & European Medieval History. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
1 Geschichtswissenschaft in Ost und West
Die Geschichtswissenschaft – und mit ihr die Mediävistik – hat im 20. Jahrhundert große Umbrüche erfahren. Als das Jahrhundert begann, stand noch der Historismus im Mittelpunkt. Er führte bereits im 19. Jahrhundert zu einer Professionalisierung und Institutionalisierung des Faches. Aus Geschichtsschreibung wurde Geschichtsforschung. Die Geschichtswissenschaft wurde zu einer Leitwissenschaft über den deutschen Sprachraum hinaus. Themen der mittelalterlichen Geschichte im Rahmen des Historismus waren vor allem Reich und Nation sowie Kirche und Staat. Dieser Blickwinkel spiegelt durchaus die Geschichte des 19. Jahrhunderts wider. Im Fokus der Forschung standen besonders Quellen, die nach historisch-kritischer Methode aufbereitet wurden. Diese Forschungstraditionen ließen sich überaus leicht in die nationalsozialistische Ideologie transferieren. Deutsche Historiker haben fast mühelos die Auffassungen des nationalsozialistischen Geschichtsbilds übernehmen können, »die einen mehr in völkischer oder gar rassistischer Richtung, die anderen mehr in der Erhebung reiner Machtpolitik zum höchsten Beurteilungsmaßstab und im Traum vom ›Reich der Deutschen‹, das über andere Völker zu herrschen berufen sei.«1
Nach den Zweiten Weltkrieg blieb es beim Festhalten am Konzept der »›Nation‹ als Movens historischer Prozesse, deren Gang durch die Geschichte nun zwar nicht mehr als Heldenepos, wohl aber als Tragödie weitererzählt werden konnte.«2
War der Historismus die Geschichtswissenschaft der Moderne, so kann die Wirtschafts- und Sozialgeschichte als jene der Postmoderne verstanden werden. Bei diesen Forschungsansätzen ist es nicht einfach, den Übergang vom einen zum anderen genau zu definieren. In der deutschen Mediävistik ist das Jahr 1945 allerdings keinesfalls als Stunde Null zu sehen. Das kommt auch daher, dass das Mittelalter mehr als lange vor der Zeit des Nationalsozialismus als Tiefpunkt deutscher Geschichte liegt. »Bei der Suche nach Ursachen für die Katastrophe war das deutsche Mittelalter kaum gefragt.«3 Die Entnazifizierung blieb im Westen oberflächlich, eine Rückkehr emigrierter Professoren fand kaum statt, durchgreifende Reformen der Universitäten wurden nicht vorgenommen.
Im kommunistischen Osten hingegen wurde die Geschichtswissenschaft ab den 1950er Jahren in den Dienst des politischen Systems gestellt. Rasch kam es zu einem Generationenwechsel, denn die alten Fachkräfte traten bald ab und eine mittlere Generation fehlte aufgrund des Krieges. Außerdem setzten sich viele Wissenschaftler in den Westen ab. Die nun nachrückenden jungen waren systemtreu.4 Sie stellten sich in den Dienst Stalins, der schon 1928 zum Sturm auf die Festung Wissenschaft aufgerufen hatte: »Diese Festung müssen wir um jeden Preis nehmen. Diese Festung muß die Jugend nehmen, wenn sie der Erbauer eines neuen Lebens sein, wenn sie zu einem wirklichen Nachwuchs der alten Garde werden will.«5 Verbunden mit einer massiven Aufstockung der Stellen entstanden geschichtswissenschaftliche Kader. Es zählte nicht die individuelle Forschungsleistung, sondern eine kontrollierte Mannschaftsbildung in Schwerpunktbereichen. Die Geschichtswissenschaft wurde den Staats- und Parteiinteressen untergeordnet, sie galt offiziell als »eine scharfe ideologische Waffe bei der Erfüllung der vom IV. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands gestellten Aufgaben bei der Erziehung der Arbeiterklasse und aller Werktätigen im Geiste des Patriotismus und des proletarischen Internationalismus.«6 Der Beschluss half wesentlich »mit, einer von der SED abhängigen und ihr bis zuletzt treu ergebenen Geschichtswissenschaft den Weg zu bereiten.«7 Nun herrschte die Lehre des Historischen Materialismus mit festgelegten Gesetzmäßigkeiten und strikter Parteilichkeit. Keiner anderen Wissenschaft in der Deutschen Demokratischen Republik wurden derartige ideologische Vorgaben gemacht, nicht zuletzt von Walter Ulbricht persönlich. Unbedingt zu verifizieren waren die Aussagen von Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin und anfangs Stalin.8 Vorbilder aus der Geschichtswissenschaft waren keine vorhanden, deshalb »haben die jungen Mediävisten der SBZ/DDR die Lehren der ›Klassiker‹ selbst für ihre Forschungszwecke adaptiert.«9 Während der Kontakt zum Westen zusehends abgebrochen wurde, entwickelte sich ein reger Austausch mit den sozialistischen Bruderstaaten.10 Die Geschichtswissenschaft in der Sowjetunion galt gemeinhin als Vorbild.
Innerhalb des Faches Geschichte war das Mittelalter in der DDR von nachrangiger Bedeutung. Es wurde dabei zur Zeit des Feudalismus,11 die teilweise bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts ausgeweitet wurde, und stellte ein Experimentierfeld für die neue Geschichtsinterpretation dar.12 Daneben waren Stadtgeschichtsforschung, Deutsche Ostexpansion und Geschichte der Westslawen sowie religiöse Bewegungen und Häresien Schwerpunkte der DDR-Mediävistik.13 Staatssekretär Wilhelm Girnus brachte es bereits 1958 im Rahmen der 3. Hochschulkonferenz der SED unter dem Titel »Perspektiven der Germanistik« auf den Punkt: »In der Deutschen Demokratischen Republik hat das Mittelalter endgültig ausgespielt, und die Weltanschauung unseres Jahrhunderts ist der dialektische Materialismus.« Die seit der Romantik übliche Überbetonung des Mittelalters gleich in mehreren Fächern an Universitäten müsse ein Ende haben: »Die religiös-klerikale Gedanken- und Gefühlswelt des Mittelalters vollends gehören ins Museum wie Kettenpanzer und Lanze.«14
Die Entwicklung der Geschichtswissenschaft im Westen, wo man im Prinzip davon ausging, dass das Hochschulsystem im Wesentlichen gut aufgestellt sei und nach dem Vorbild der Humboldt’schen Universitätsidee auch wiederhergestellt werden sollte,15 wurde befördert von einem massiven Ausbau der Universitätslandschaft in den 1960er und 70er Jahren. In keinem Zeitabschnitt zuvor stieg die Zahl der Universitäten so stark an. Diese Erweiterung hatte ihren Hintergrund zum einen Teil in einer heftig geführten bildungspolitischen Diskussion, die Bildung als wirtschaftlichen Standortfaktor begriff und rasch von der Politik absorbiert wurde, und zum anderen Teil mit der größeren Nachfrage nach Studienplätzen der geburtenstarken Nachkriegsgeneration. Dem wurde aber weniger durch Einrichtung klassischer Universitäten Rechnung getragen, sondern durch Regional- und Spezialhochschulen, die sich auf Schwerpunkte konzentrierten. Das kam vielen lokalen politischen und wirtschaftlichen Interessen entgegen, zumal in der Bundesrepublik Deutschland die Universitäten unter die Kulturhoheit der Bundesländer fallen. Die volle personelle Einrichtung dieser Reformuniversitäten zog sich oft über Jahre hin, nicht alle Fächer waren vertreten, die Zusammensetzung der Fakultäten war mitunter experimentell. So ergab sich der Zwang, kreativ zu kooperieren und interdisziplinär zu arbeiten. Gerade diese neuen Hochschulen wurden zu Innovationszentren in Forschung und Lehre, während sich die alten Universitäten ihrer Tradition verpflichtet fühlten.
Gab es nach dem Zweiten Weltkrieg in der BRD 16 Universitäten und in der DDR sechs, so waren es kurz vor der Wende 1989 in der BRD 244 Hochschulen und 54 in der DDR. Nach der Wiedervereinigung erfolgte ein Konzentrationsprozess. In Österreich vermehrte sich die Zahl von drei Universitäten bis Anfang der 1990er Jahre auf zwölf. Danach kamen ab 1994 noch Fachhochschulen und seit 2007 neun Pädagogische Hochschulen hinzu. Nur in der Schweiz blieb die Anzahl der kantonalen Universitäten fast gleich.
Inhaltlich geschah im Gesamtfach nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Hinwendung zur Zeitgeschichte eine Aufarbeitung des Nationalsozialismus und seiner Vorgeschichte. Bedeutend im Kalten Krieg war der Ausbau des Faches osteuropäische Geschichte. Damit einher ging eine Abkehr von der nationalen und europäischen Geschichtssicht. Allerdings gehörte der Osten schon zu den favorisierten Forschungsthemen des Dritten Reiches. Das Aufkommen der Strukturgeschichte förderte die Abspaltung der Wirtschafts- und Sozialgeschichte vom klassischen Fach. Gerade an den neu eingerichteten Universitäten konnten diese Felder prosperieren. »Der deutlichste Wandel spiegelt sich in den unsicher und vorsichtig gewordenen Einstellungen gegenüber der Nation und damit der Nationalgeschichte wie auch in der Haltung gegenüber der Bonner Republik und der Demokratie wider.«16 Hier wird die größte Veränderung zur Zwischenkriegszeit deutlich: »Tatsächlich ist unbestreitbar, daß die deutschen Historiker nach 1945 die demokratische Neuordnung in jener Geschlossenheit begrüßt haben, in der sie sie nach 1918/19 angegriffen haben.«17
Im Bereich der mittelalterlichen Geschichte änderte sich an der historistischen Ausrichtung bis zum Beginn der 1960er Jahre noch nichts Wesentliches. Das hängt mit einem Grundprinzip seit dem 19. Jahrhundert zusammen, das nun vollends zum Tragen kam.
»Die traditionelle deutsche Auffassung von Geschichtswissenschaft, die üblicherweise mit dem Begriff Historismus umschrieben wird, hat sich unter den deutschen Historikern nicht oder zumindest nicht kraft ihrer überlegenen wissenschaftlichen Qualität und schon gar nicht aufgrund ihrer angeblichen politischen Funktion durchgesetzt, sondern vornehmlich deshalb, weil ihre Begründer es verstanden, eine treue Gefolgschaft heranzuziehen und fortlaufend mit den wichtigsten Positionen des Faches zu betrauen, so daß Außenseiter von vornherein ausgeschlossen wurden oder isoliert blieben.«18
Die Rolle der Mediävistik im Nationalsozialismus ist auch deshalb bis heute nicht ausreichend reflektiert. Es gab eine starke personelle Kontinuität, die meist mit fachlicher Kompetenz begründet wurde. Auffallend an den verschiedenen Nachkriegsbiographien ist aber, dass die Netzwerke aus der Zeit des Nationalsozialismus weiter einwandfrei funktioniert zu haben scheinen.
Oft wird zur Erklärung des Zustands ein Generationenkonzept der um 1900 Geborenen bemüht. Dabei geht es um die Erinnerungsgemeinschaft der Weltkriegsteilnehmer und der Kriegsjugendgeneration, die direkt oder indirekt ein Fronterlebnis hatten.19 Schon in der Zwischenkriegszeit lehnten viele Mediävisten die Republik ab und blieben Monarchisten, unter denen der Deutschnationalismus weit verbreitet war. So begrüßten viele bedeutende österreichische Historiker den ›Anschluss‹ von 1938 als Erfüllung des deutschen Nationalstaates. Insgesamt blieben selbst später führende Mediävisten dem Nationalsozialismus bis zum Schluss treu ergeben, einige wurden im Rahmen der Aktion Sonderelbe Wissenschaft ab 1943 sogar vom Wehrdienst befreit.20 Bei dieser Aktion ging es um die Erhaltung des geisteswissenschaftlichen Nachwuchses für die ungewisse Zeit nach dem Krieg, denn für Vertreter der weniger kriegswichtigen Fächer war es ansonsten schwer, unabkömmlich gestellt zu werden.21 Insgesamt acht Professoren aus der Alten, Mittleren und Neuen Geschichte wurde dieses Privileg zuteil.22 Viele prägten den Wissenschaftsbetrieb noch lange mit, bis sie am Ende der 1960er Jahre heftig kritisiert wurden.23
Ein wesentlicher Einschnitt erfolgte erst im Zuge der Studentenbewegung von 1968, als an den Universitäten die Ordinarienstruktur, mangelnde Demokratie und fehlende Selbstreflexion kritisiert wurden. Die marxistische Ideologiekritik wurde im Westen als universitä...