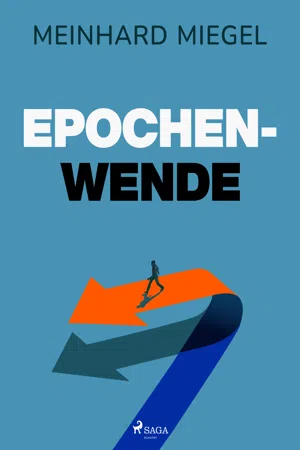
- 312 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Epochenwende
About this book
Der Westen scheint im Wandel begriffen und die Verheißung des ewigen Wachstums lässt zunehmend an Leuchtkraft nach. Diese Beobachtung nimmt der renommierte Soziologe Meinhard Miegel zum Anlass, ein grundlegendes Umdenken in Politik und Wirtschaft zu fordern. Nur ein Abschied vom Mythos des ewigen Wachstums ermögliche es Deutschland und Europa, die nötigen Reformen in die Wege zu leiten. Vermehrt müsse auf Solidarität, Nachhaltigkeit und Angemessenheit geachtet werden. Schonungslos und klarsichtig richtet Miegel seinen Blick auf die westliche Misere, bietet aber gleichzeitig konstruktive Lössungsvorschläge. Ein ebenso wichtiges wie erhellendes Buch.-
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Information
WACHSTUMSMYTHOS – WOHLSTANDSWAHN
Ideale im Wandel
Die Geschichte der Europäer ist eine Geschichte abrupter Brüche, grundlegender Neuorientierungen und Kehrtwendungen. Während des ganzen Mittelalters, etwa vom 5. bis zum 15. Jahrhundert, hatten sie mit dem Christentum eine Religion verinnerlicht, die, stärker noch als andere Hochreligionen, alles Diesseitige gering erachtete und sich ganz am Jenseitigen orientierte. Materielle Güter erschienen auf dem Weg zum Heil hinderlich. Besser war es, sich auf das Notwendigste zu beschränken. Was nicht unabweisbar zum Lebensunterhalt benötigt wurde, sollte der Verherrlichung Gottes dienen. Prächtige Sakralbauten, Kirchen und Klöster, die oft von bedürftigen Gläubigen errichtet wurden, künden bis heute von diesem Geist.
Er schwand mit dem Anbruch der Neuzeit, mit Renaissance und Reformation. Unter Rückgriff auf antikes Gedankengut wandten sich die bis dahin so jenseitig orientierten Europäer nunmehr Diesseitigem mit einer Ausschließlichkeit zu, wie dies zuvor wohl noch keine Zivilisation getan hatte. Die Konflikte, die mit diesem Wechsel der Sichtweise einhergingen, waren beträchtlich. Eine Zeit lang schien es, als zerbrächen die Europäer an ihnen. Doch schließlich lösten sie sie. Von den sieben Tagen der Woche stellten sie sechs in den Dienst Mammons. Ein Tag blieb den alten Gottesdiensten gewidmet. Dann verwiesen sie alles Religiöse in den Privatbereich. Wer wollte, konnte jetzt die ganze Woche, das ganze Jahr über materielle Wohlstandsmehrung betreiben. Inzwischen ist der christliche Wertekanon, der rund ein Jahrtausend lang die Europäer prägte, für die meisten nur noch eine ferne Erinnerung. Und oft nicht einmal mehr das. Das Leben gehört ungeteilt und ungeschmälert Diesseitigem. Es kreist um die Befriedigung materieller Bedürfnisse.
Nirgendwo offenbart sich das Scheitern des Christentums brutaler als hier. Der irdische Ankerpunkt dieser Religion, Jesus von Nazareth, lebte und lehrte völlige materielle Bedürfnislosigkeit. In wenigen Punkten sind die biblischen Berichte über ihn so eindeutig wie in diesem. Vermutlich wächst er in ärmlichen Verhältnissen auf. Anders als die Füchse, die ihre Höhlen, und die Vögel, die ihre Nester haben, hat er noch nicht einmal eine Stätte, wo er sein Haupt hinlegen kann (Matthäus 8, 20). Das aber ist für ihn kein Anlass zur Klage. Vielmehr erwartet er von seinen Jüngern eine ähnliche Bedürfnis- und Mittellosigkeit. Sie sollen sich weder Goldnoch Silber- noch Kupfermünzen verschaffen noch einen Ranzen für die Reise, ebenso wenig Schuhe oder einen zweiten Leibrock (Mt 10, 10). »Macht euch doch keinen Kummer wegen des Morgen«, ermuntert Jesus seine Jünger, »der morgige Tag wird schon für sich selbst sorgen« (Mt 6, 34).
Wer diese und ähnliche Aussagen als Ausdruck der Unbekümmertheit eines antiken Blumenkindes interpretiert, verfehlt den Wesenskern des Christentums. Dessen Distanzierung von materiellen Gütern ist grundsätzlich. Wo solche Schätze sind, da ist nämlich auch das Herz des Menschen (Mt 6, 21). Der Mensch aber kann keinen zwei Herren dienen. Er muss sich entscheiden zwischen Gott und dem Mammon (Mt 6, 24). Dabei wird der Kluge um des Himmelreiches willen sein Grundstück aufgeben (Mt 19, 29), seinen Acker verkaufen und auf all sein Hab und Gut verzichten (Mt 13, 44). Denn eher gelangt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel (Mt 19, 24). Beim Wohlhabenden fällt »das Wort« unter Dornen (Mt 13,22). Wer vollkommen sein will, verzichtet auf allen Besitz und folgt Jesus nach (Mt 19, 23). Im Übrigen ist es ohnehin sinnlos, auf Erden Schätze zu sammeln, wo Motten und Rost daran zehren und Diebe einbrechen und stehlen (Mt 6, 19).
Die frühe Kirche nahm diese Aussagen im Allgemeinen recht ernst, was nicht zuletzt für Jahrhunderte zu einer gewissen Lähmung wirtschaftlicher Aktivitäten beigetragen haben dürfte. Zwar erwarb sie im Laufe der Zeit Grund und Boden sowie sonstigen Besitz. Doch sie betrachtete diese Erwerbungen als bloßes Lehen Gottes, vor allem aber als Voraussetzung der Armenfürsorge. Die Sorge für Arme war für sie tätige Nächstenliebe – das zweite wirtschaftsrelevante Postulat des Neuen Testaments neben dem weitestgehenden Verzicht auf materielle Güter.
Diese tätige Nächstenliebe, die Sorge für die Armen, war der Sprengsatz, der in das hohe und strenge Gemäuer des Armutspostulats die breite Bresche riss, durch die die Christenheit im ausgehenden Mittelalter aus der kirchlichen Ordnung ausbrach, um sich weltlichen, namentlich wirtschaftlichen Dingen zuzuwenden. Gestützt auf das Argument, materielle Güter und deren Mehrung müssten Gott gefallen, weil nur so den Armen wirksam geholfen werden könne, ging ein Ruck durch Europa – stärker im Westen, schwächer im Osten.
Im Wirken des Reformators Luther ist diese Entwicklung geradezu modellhaft nachzuvollziehen. Zu Beginn betrachtet er wertschöpfende Arbeit als ethisch neutral. Sie ist wie Essen und Trinken weder gut noch schlecht. In einer nachfolgenden Phase ist sie für ihn Ausdruck von Nächstenliebe und ihre Vermeidung ein Verstoß gegen diese. In seiner Spätzeit schließlich sieht Luther in der Erfüllung innerweltlicher Pflichten den einzigen Weg, um Gott wohlzugefallen. Sein Zeitgenosse Calvin geht mitsamt seiner puritanischen Bewegung noch weiter. Wer nicht arbeitet, sündigt. Der nach Gewinn strebende Mensch erfreut Gott. Reichtum und Besitz sind ethisch nicht verwerflich. Verwerflich ist nur deren Genuss. Materielle Güter zu schaffen und sie nicht zu genießen gehört hingegen zum Höchsten, was der Mensch zu erreichen vermag.
Von hier bis zum ungehemmten Genussmaterialismus unserer Tage war es nicht weit. Was sollte die ganze Gütermehrung zum Wohle des Nächsten? War sich nicht jeder selbst der Nächste? Nach und nach löste sich die mental-sittliche Verbindung von Gütermehrung und Nächstenliebe auf. Die Mehrung materieller Güter zur Steigerung des individuellen Wohls wurde zur neuen gesellschaftlichen Leitidee. Sie bedurfte keiner Rechtfertigung oder Begründung mehr. Das christliche Armutspostulat hatte ausgedient. Die Bahn war frei für das auf Wirtschaftswachstum und materiellen Wohlstand fixierte Europa, wie wir es heute kennen. Zwangsläufig war diese Entwicklung nicht. Es hätte auch anders kommen können.
Prägungen
Alle Lebewesen werden von ihrer Umwelt geprägt. Wie weit solche Prägungen gehen können, hat der Verhaltensforscher Konrad Lorenz schon vor einem halben Jahrhundert eindrucksvoll gezeigt. Nachdem er sich schlüpfenden Graugänsen vom ersten Augenblick an als »Leittier« zur Verfügung gestellt hatte, folgten sie nur ihm. Andere Graugänse bedeuteten ihnen nichts.
Auch Menschen sind vielfältig geprägt. Das beginnt mit der Sprache der ersten Lebensjahre, die nicht nur Zunge und Kehlkopf, sondern auch spätere Denkmuster formt, und setzt sich fort in unterschiedlichsten Zu- und Abneigungen, Wertund Unwerturteilen. Was macht einen Europäer zum Europäer, einen Briten zum Briten oder einen Franzosen zum Franzosen? Prägungen. Warum lieben die einen Klassik und die anderen Pop? Weil sie so geprägt worden sind. Was ist Heimat? Abermals das Ergebnis von Prägungen, die so oder anders sein können. Wer am grauen Meer aufgewachsen ist, fühlt sich nicht selten ein Leben lang nur da richtig wohl. Nicht anders ergeht es den Kindern der Berge. Nur da geht ihnen das Herz auf.
Prägungen umfassen aber noch mehr. Die Menschen des Westens sind seit langem geprägt von ständigem Wachstum in fast allen Lebensbereichen. Es wuchs nicht nur ihre eigene Zahl. Noch stärker wuchs die Zahl der Wohnungen, der Automobile, der Straßenkilometer – einfach alles. Viele können sich eine Welt ohne Wachstum kaum noch vorstellen. Wachstum ist für sie eine unverzichtbare Voraussetzung für das Funktionieren der Wirtschaft, der sozialen Sicherungssysteme und der politischen Ordnung. Selbst das individuelle Wohlbefinden hängt für sie von Wachstum ab. Ohne Wachstum, befürchten Politiker, seien westliche Gesellschaften unregierbar. Oder wie eine große deutsche Volkspartei in ihrem Programm schnörkellos erklärt: »Ohne Wachstum ist alles nichts.« 80
Menschen früherer Zeiten hätten für eine solche Sichtweise kein Verständnis gehabt. Sie durchlebten die Jahrhunderte, ohne dass sich viel veränderte, und folglich waren sie auch nicht von Veränderungs–, von Wachstumsvorstellungen geprägt. Die Masse wollte leben »nach alter Väter Sitte«, und sie war stolz darauf, wenn ihr das halbwegs gelang. Veränderungen, wie sie unvermeidlich mit Wachstumsprozessen einhergehen, waren ihr verdächtig. Sie fürchtete sie.
Die Umprägung, die die Europäer im ausgehenden Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit erfuhren, dürfte zu den größten Transformationen und zugleich Ironien der Menschheitsgeschichte gehören. Da macht sich eine Gesellschaft auf den Weg, um – idealiter – durch Verzicht und Askese, die Beschränkung auf das Notwendige und die Geringschätzung materieller Güter bis dahin unerreichte geistige Höhen zu erklimmen – oder, in der Sprache jener Zeit: Gott wohlzugefallen – und dadurch die ewige Seligkeit zu erlangen. Und sie endet in einer Welt des fast ausschließlich Materiellen, des Massenwohlstands, des Genusses und des materiellen Überflusses.
Die Radikalität dieser Umprägung offenbart ein Blick in einen etwas älteren Beichtspiegel der katholischen Kirche. Was noch vor einigen Jahrzehnten als Sünde galt, gilt heute als Tugend: Geiz, Habsucht, Eitelkeit. Was vormals als Tugend angesehen wurde, ist jetzt Dummheit: Ehrlichkeit, Selbstlosigkeit, Bescheidenheit. Ein krasserer Wandel ist kaum denkbar. Im 15. Jahrhundert litt Jakob Fugger II., einer der bedeutendsten Vertreter des Frühkapitalismus in Deutschland, ob seines Reichtums noch Höllenqualen. Er sah sich auf ewig vom Himmel ausgeschlossen und versuchte durch gute Werke – die Fuggerei zum Wohle bedürftiger Bürger und die Fuggerkapelle in Augsburg stehen noch heute – Gnade zu erlangen. Diejenigen, die in seine Schuhe schlüpften, kannten derartige Skrupel nicht mehr. Ihre Reichtümer konnten gar nicht groß genug sein, und kaum einer bangte, durch sie sein Seelenheil zu verspielen.
Wendepunkte
Ständiges Wachstum in fast allen Lebensbereichen, namentlich die Mehrung materieller Güter, hat den Westen so tief geprägt, dass jedes Hinterfragen dieser Prägung abwegig oder zumindest befremdlich erscheint. Oft wird sie überhaupt nicht mehr als Prägung wahrgenommen. Wie Deutsche, Italiener oder Spanier geneigt sind zu glauben, wie sie sich verhalten, verhalte man sich eben, und wer sich nicht so verhalte, verhalte sich abnorm, so betrachten die Völker des Westens Expansion als einen gewissermaßen natürlichen Prozess und Stagnation oder gar Kontraktion als dessen Störung. Stagnation bezeichnen sie explizit als Wachstumsschwäche, Kontraktion als negatives Wachstum. Das Verständnis dafür, dass Stagnation und Kontraktion genauso »natürlich« sind wie Expansion, ist weithin verloren gegangen. Dabei zeigt die uns umgebende Wirklichkeit, dass alle drei ein genau austariertes Gefüge bilden, aus dem ein dauerhafter Ausbruch nicht möglich ist.
Das macht die Prägung des Westens überaus problematisch. Denn letztlich fußt sie auf etwas objektiv Unmöglichem. Ob sich das Universum bis in alle Ewigkeit ausdehnen kann, ist noch nicht abschließend geklärt. Geklärt ist hingegen, dass auf unserer endlichen Erde nichts immerfort wächst. Dass Bäume nicht in den Himmel wachsen, wusste schon der Volksmund. Die Wissenschaft hält ungezählte weitere Belege bereit. Erreicht der Schalldruck den Atmosphärendruck, wird Krach zur Stille – bei 194 Dezibel. Regentropfen, die zu Boden fallen, sind nie größer als neun Millimeter. Was größer ist, zerplatzt im Fall. Luftbewegungen können höchstens eine Geschwindigkeit von 520 Stundenkilometern erreichen. Dann ist Schluss. 81 Die Liste derartiger Beispiele ist lang. Sie alle zeigen: In der Natur ist nichts unendlich. Grenzen des Wachstums in Abrede zu stellen zeugt nur von Unwissen. Sinnvoll kann immer nur gefragt werden, wann Wachstum zum Stillstand kommt, nicht, ob dies jemals geschehen wird.
Diese Feststellung ist nicht Ausdruck von Wachstumsskeptizismus und erst recht keine Wachstumskritik, sondern nur die Anerkenntnis der Bedingungen irdischer Existenz. Menschen, die von der Erfahrung anhaltenden Wachstums geprägt sind, fällt diese Anerkenntnis jedoch schwer. Viele halten es beispielsweise für ein Unglück, dass die Einwohnerschaft von Städten und Gemeinden nach jahrhundertelanger Zunahme jetzt in einigen Regionen Europas zurückgeht. Gemeindeväter und -mütter hoffen, dass ihnen dieses Schicksal erspart bleibt. Sie setzen auf Wachstum. Noch 1990 glaubten manche Politiker, Berlin werde in absehbarer Zeit zehn Millionen Einwohner zählen. Das Ziel des wachsenden Hamburg ist bis heute nicht aufgegeben. Köln kämpfte lange verbissen und schließlich erfolgreich um eine Einwohnerschaft von einer Million. Ähnliche Ziele werden in ganz Europa verfolgt.
Auf die Frage nach dem Sinn solcher Zielsetzungen gibt es meist nur verschwommene Antworten. Von allem mehr zu haben, auch mehr Menschen, ist für viele ein Wert an sich. Was diesem Mehr zuwiderläuft, ist in ihren Augen eine Krise. Die bekannteste dieser Krisen ist die Wachstumskrise. Sie wird flankiert von einer Beschäftigungskrise, einer Krise der öffentlichen Haushalte, einer Zahlungskrise, einer Investitionskrise, einer Wertekrise. Es gibt nur noch wenig, was sich nicht in einer Krise befindet. Gleichzeitig werden die Krisen immer länger. In einigen europäischen Ländern – so eine verbreitete Sichtweise – befindet sich die Wirtschaft, vor allem die Bauwirtschaft, schon seit einem Jahrzehnt und länger in der Krise. Das sagt alles.
Die Krisen nehmen kein Ende und hören damit auf, Krisen zu sein. Denn Krisen sind keine Zustände, sondern Zeitpunkte, in denen ein neuer Kurs eingeschlagen wird – Wendepunkte. Von da an geht es anders weiter als bisher. Europa befindet sich an einem solchen Wendepunkt. Doch noch sperren sich viele Europäer, die Wende zu vollziehen. Ihre überkommenen Prägungen hindern sie daran. Zwar sehen sie, dass vieles anders ist als früher. Aber sie halten die Veränderungen für eine Störung des Normalen und begreifen nicht, dass dies die neue Normalität ist.
Diese neue Normalität entspringt, wie die vorangegangene, dem Wirken von Menschen. Deshalb kann und muss sie von Menschen gestaltet werden. Und wie die vorangegangene, so ist auch die neue Normalität voller Ungereimtheiten, Widersprüche und Fehlentwicklungen. Ihnen ist Rechnung zu tragen. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Europäer wie die Völker aller frühindustrialisierten Länder zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Strom der Geschichte eine andere Richtung eingeschlagen hat. Sie täten sich um vieles leichter, wenn sie nicht ständig versuchten, in der bisherigen Richtung weiterzurudern.
Angebot und Nachfrage
Kurz nach Öffnung des Eisernen Vorhangs luden deutsche Unternehmer sowjetische Kombinatsdirektoren ein, sich im Westen mit marktwirtschaftlichen Managementmethoden vertraut zu machen. Der Kursus sollte vier Wochen dauern. Doch schon nach wenigen Tagen begannen die Gäste zu murren. Die deutschen Instruktoren kannten zunächst nicht den Grund, bis einer der Kombinatsdirektoren erklärte: Seit unserer Ankunft hören wir immer nur, wie wir unsere Produkte am besten vermarkten können. Das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass wir nicht wissen, woher wir die Produkte nehmen sollen. Dazu haben wir bisher kein Wort gehört.
Zwei Welten waren aufeinander geprallt. Jemandem erklären zu müssen, wie Güter erzeugt werden, war den Deutschen nicht in den Sinn gekommen. Sie lebten in einer Welt permanenten Überflusses. In dieser Welt lautete die entscheidende Managementfrage: Wie schlagen wir Produkte – Waren und Dienste – gewinnbringend los? Und ihnen gegenüber saßen Angehörige einer Welt permanenter Versorgungsengpässe. Gelang es in dieser Welt, dreißig Paar Herrenschuhe, alle gleich, Größe 43, an ein Warenhaus zu liefern, konnte man gewiss sein, dass sie innerhalb kürzester Zeit vergriffen sein würden. Die Menschen kauften, ob sie die Schuhe brauchten oder nicht. Irgendjemand würde sich schon finden, der für sie Verwendung haben würde.
In der gesamten Wachstumsdebatte, die seit Jahrzehnten nicht nur in Europa, sondern weltweit geführt wird, wird dieser Frage viel zu wenig Raum gegeben: Lahmt das Wirtschaftswachstum, weil die Produktion oder weil der Absatz stockt?
Bei reichlich der Hälfte der Menschheit stockt die Produktion. Ihr fehlen das Wissen oder das Kapital oder die Rohstoffe und zumeist alles zusammen, um einen breiten Güterstrom fließen zu lassen. Ihre Wertschöpfung ist so gering, dass die Erwerbstätigen im Durchschnitt nicht einmal zwei Euro verdienen – am Tag. Für etwa 3,5 Milliarden Menschen ist von brennender Aktualität nicht was sie morgen, sondern was sie heute essen und trinken, wie sie sich heute kleiden und behausen sollen.
Die Völker der frühindustrialisierten Länder und einiger weiterer Regionen stehen vor genau der entgegengesetzten Herausforderung. Auf die Frage, was für sie das größte wirtschaftliche Risiko sei, antworteten vier von fünf deutschen Managern: abnehmende Nachfrage. 82 Risiken bei der Produktion, Lieferengpässe und dergleichen spielten hingegen nur eine untergeordnete Rolle. Zwar gibt es das alles gelegentlich auch im Westen. Aber wirkliche Sorgen bereitet es nicht. Wird es bei den Kapazitäten einmal eng, werden sie schnell erweitert. Das ist eine rein betriebliche Angelegenheit. Für die Volkswirtschaft ist es kein Thema.
Ungleich häufiger als Kapazitätsengpässe sind Überkapazitäten. Welche ungenutzten Reserven in den Volkswirtschaften des Westens schlummern, zeigte sich bei der deutschen Wiedervereinigung. Wer gemeint hatte, dass für den Aufbau des in jedweder Hinsicht darniederliegenden Ostens und für die Versorgung der dortigen Bevölkerung vom Papiertaschentuch bis zum Pkw, vom Dachziegel bis zum Großgenerator erhebliche zusätzliche Produktionsanlagen erforderlich seien, hatte sich geirrt. Rund 16 Millionen Ostdeutsche ließen sich weitgehend aus den vorhandenen Kapazitäten der 64 Mi...
Table of contents
- Titel
- Kolophon
- Inhalt
- VORBEMERKUNG
- PROLOG
- KONFLIKTE
- WACHSTUMSMYTHOS – WOHLSTANDSWAHN
- DIE ZUKUNFT GEWINNEN
- SCHLUSSBEMERKUNG
- DANKSAGUNG
- ABKÜRZUNGEN
- BIBLIOGRAPHIE
- ÜberEpochenwende
- Anmerkungen
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn how to download books offline
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 990+ topics, we’ve got you covered! Learn about our mission
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more about Read Aloud
Yes! You can use the Perlego app on both iOS and Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app
Yes, you can access Epochenwende by Meinhard Miegel in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Economics & Political Economy. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.