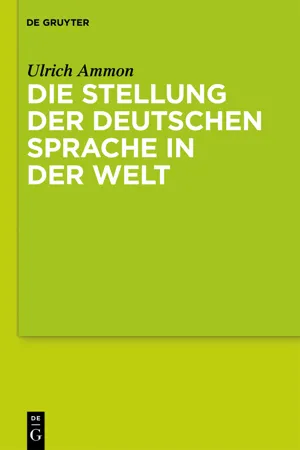![]()
L. Politik der Förderung der deutschen Sprache in der Welt
1. Begriffe, Termini und Rahmenbedingungen
1.1 ‚Sprachförderung‘, ‚Sprachverbreitung(spolitik)‘, ‚Auswärtige Sprachpolitik‘
Im folgenden Kap. geht es in erster Linie um staatliche Sprachpolitik (oder Sprachenpolitik), die sich – als Teil der Außenpolitik – auf Staaten und Gebiete außerhalb des eigenen Staatsgebietes richtet. Sprach(en)politik in einem weiteren Sinn können im Grunde alle Organisationen oder Gruppen betreiben, z.B. Vereine, auf die ich auch kurz zu sprechen komme (Kap. L.3.4); jedoch steht hier die Betrachtung staatlicher Politik im Vordergrund. Wie bei vielen Themen, die von unterschiedlichen Disziplinen und Blickwinkeln aus untersucht werden, ist die Terminologie für diesen Gegenstand uneinheitlich. Es bieten sich zumindest die folgenden unterschiedlichen Termini an, die im Bedeutungskern weitgehend übereinstimmen, aber unterschiedliche Akzente setzen:
1)Auswärtige Sprachpolitik (ASP) (Andrei/Rittberger 2009; A. Schneider 2000), als Teil der Auswärtigen Kulturpolitik (AKP), die wiederum Teil der Außenpolitik (AP) ist (ASP ⊂ AKP ⊂ AP). Für deren Gegenteil eignen sich die Termini interne/ innere Sprachpolitik usw. Diese hier mit Abkürzungen versehenen Termini (ASP, AKP, AP) erscheinen mir sehr brauchbar. Bisher ist allerdings nur AKP gebräuchlich; jedoch verwende ich auch ASP, vor allem ab Kap. L.3.1. Seit dem Jahr 2000 (Kap. L.3.2) ist die Bezeichnung für AKP in Deutschland erweitert und lautet offiziell Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP); ich gebrauche aber, nicht nur für vergangene Zeiten, weiterhin eher die traditionelle, kürzere Form Auswärtige Kulturpolitik (AKP).
2)Auswärtige Sprachförderungspolitik (ASF) (kurz auch Auswärtige Sprachförderung) – mit folgenden Differenzierungen für Unterbegriffe: Auswärtige Sprachverbreitungspolitik) (ASV) und Auswärtige Spracherhalt(ungs)politik (ASE) (ASF = ASV ∪ ASE; vgl. Ammon 1991a: 524-528). Alle drei Abkürzungen sind ungebräuchlich, weshalb ich sie nicht weiter verwende.
3)Die folgenden spezielleren Bezeichnungen liegen aufgrund soziolinguistischer Terminologie nahe, sind aber ungeeignet wegen ihrer Ungebräuchlichkeit und ihrer Schwerverständlichkeit für Nicht-Linguisten: Auswärtige Sprachstatuspolitik – entsprechend der gängigen soziolinguistischen Unterscheidung von Sprachstatus- und Sprachkorpusplanung (Haugen 1966; 1987) oder Auswärtige Sprachstellungspolitik, um das mögliche Missverständnis auszuschließen, es gehe nur um Status im juristischen Sinn, statt – wie es gemeint ist – auch um Gebrauch oder Funktion der Sprache (vgl. Kap. D.1).
4)Ebenso ungeeignet wegen Ungebräuchlichkeit erscheinen mir die denkbaren Termini Sprachaußenpolitik (und als Gegensatz Sprachinnenpolitik) sowie Außensprachpolitik, im Gegensatz z.B. zu Außenwissenschaftspolitik, einem Terminus, der von der Bundesregierung anlässlich der „Initiative Außenwissenschaftspolitik 2009“ offiziell eingeführt wurde („Auftaktkonferenz“ am 19./ 20.01.2009: www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Meldungen/2009/090114-AWP.html – abgerufen 10.02.2013).
Schließlich finde ich den für Auswärtige Sprachpolitik gelegentlich gebrauchten Terminus Sprachexport eher verwirrend als erhellend. Er passt nicht einmal zu ausgesprochener Sprachverbreitungspolitik, da dabei – anders als beim sonstigen Export – kein Besitzwechsel stattfindet. Allenfalls verbindet sich mit Auswärtiger Sprachpolitik die Zielvorstellung, dadurch den Export echter Waren (im ökonomischen Sinn) zu fördern (dazu Kap. L.2).
Meine Wahl der Termini unter 1) und 2) möchte ich kurz begründen und ihre Bedeutung erläutern. Wegen der zahlreichen einschlägigen englischsprachigen Publikationen füge ich jeweils auch die englischen Übersetzungen bei. In früheren Darstellungen habe ich den Terminus Sprachverbreitungspolitik (SVP) für den Oberbegriff gebraucht (z.B. Ammon 1989c: 229f.; 1990d; 1991a: 524-528), weil mir dies die vorrangige Absicht solcher Politik am deutlichsten auszudrücken schien und auch wegen des in der Soziolinguistik aufgekommenen Terminus Sprachverbreitung (engl. language spread; z.B. Cooper 1982; Lowenberg 1988). So auch der von mir geprägte Terminus language spread policy für die von mir (mit)herausgegebenen Bände des International Journal of the Sociology of Language 95 (1992); 107 (1994).
Allerdings war auffällig, dass dieser Terminus von Politikern gemieden wurde. Als einen nicht unwesentlichen Grund vermutete ich den Versuch sprachlicher Verschleierung, um die Assoziation mit Sprachimperialismus zu vermeiden (engl. linguistic imperialism; dazu Phillipson 1992), zumal manche Politiker das Wort Politik für diese Politik (was soll es denn sonst sein?) grundsätzlich ablehnten. Ein Beispiel lieferte Hildegard Hamm-Brücher (Deutscher Bundestag 1986: 25), die freilich auch um äußerste Behutsamkeit in dieser Politik bemüht war.
Der politische Diskurs tendierte, jedenfalls in der BRD und im vereinigten Deutschland, eher zum Terminus Sprachförderung (entsprechend engl. language promotion; z.B. Auswärtiges Amt 1973: 18; Bericht 1985: 4, 6, 11, 17; Witte 1985c; H. Hoffmann 2000). Dieser Terminus hat allerdings auch den Vorteil der Verwendbarkeit für den Oberbegriff einer Politik sowohl der Sprachverbreitung als auch der Spracherhaltung. Bei der heutigen Stellung der deutschen Sprache in der Welt liegt letztere Zielsetzung näher. Auch deshalb erscheint mir jetzt der Terminus Sprachförderung(spolitik) (engl. language promotion) besser geeignet als Sprachverbreitungspolitik. Die Kurzform Sprachförderung ist unproblematisch, da im üblichen Kontext der Verwendung in aller Regel klar ist, dass es sich um Politik handelt oder zumindest, dass Akteure mit entsprechenden Absichten dahinterstehen. Der Terminus Sprachverbreitung impliziert dies jedoch nicht, da sich eine Sprache auch unbeabsichtigt verbreiten kann, so dass man im Falle möglichen Missverständnisses den längeren Ausdruck Sprachverbreitungspolitik verwenden sollte. Wie schon gesagt, hat der Terminus Sprachförderung(spolitik) zudem den Vorteil, dass er sich sowohl auf eine Politik der Verbreitung als auch der Stellungserhaltung einer Sprache (in der Regel der eigenen Amts- oder Muttersprache) beziehen lässt.
In eindeutigen Fällen sollte man jedoch ungeschminkt auch von Sprachverbreitungspolitik reden (engl. language spread policy) (Kap. L.2) und im gegenteiligen Fall entsprechend von Spracherhalt(ungs)politik (engl. language maintenance policy). Dass beide Arten und Ziele von Politik nicht unvereinbar sind, belegen Ausführungen wie die folgende: „Nur durch eine aktive Politik der Verbreitung der deutschen Sprache wird die Bedeutung des Deutschen in der Welt erhalten und möglicherweise gesteigert werden können“ (Bericht 1985: 7).
Im Rahmen dieses Buches geht es um Außen-, nicht um Innenpolitik. Dies impliziert schon, dass es in erster Linie um die Stellung einer Sprache geht, nicht um ihre Struktur. Anders ist dies bei nach innen gerichteter Politik, als Teil von Innenpolitik. In bestimmten Kontexten erscheint der Terminus Sprachinnenpolitik fast unvermeidlich, obwohl ich auf sein Pendant, Sprachaußenpolitik, wegen der Ungebräuchlichkeit verzichte. Sprachinnenpolitik kann sich nicht nur auf die Stellung einer Sprache innerhalb des Staatsgebiets richten, sondern auch auf ihre Struktur, z.B. auf den Wortschatz (Rechts- oder auch Wissenschaftsterminologie, eventuell einer Sprachak...