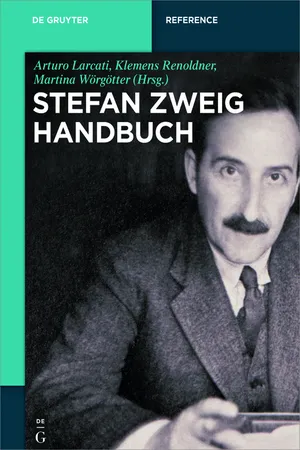2.Typologien lyrischen Schreibens und Wertung
In den Gedichten Zweigs, urteilte im Rückblick Felix Braun, „schwebte eine Schwermut ohne Schwere“ (Braun 1959, S. 42 f.). Damit waren vorrangig die Sammlungen und Zyklen Silberne Saiten (1901) und Die frühen Kränze (1906) gemeint, neu aufgelegt im Jahr des Jeremias (1917), sowie die Gesammelten Gedichte (1924 unter Ausschluss der bei ihm inzwischen restlos in Ungnade gefallenen Silbernen Saiten; vgl. Zweig GWE, Die Welt von Gestern, S. 121), erweitert um die Zyklen Neue Fahrten und Die Herrn des Lebens, lyrische Charakterzeichnungen und damit ins Typologische überführte Entsprechungen zu den biografisch-literarischen Essays. Die Berühmten und Namhaften werden in diesen Porträtgedichten zu exemplarischen Vertretern einer Zunft oder Haltung. Auch das Erzählgedicht gehört zu diesem lyrischen Werk in Gestalt der Ballade von einem Traum (1923), die wiederum eine Gattung exemplarisch vorstellt, ohne jedoch weitere Beispiele folgen zu lassen.
Genauer betrachtet umrahmen aber auch die lyrischen Nachdichtungen das Werk Stefan Zweigs. Frühe Meisterschaft stellt er darin am Beispiel der Lyrik Émile Verhaerens unter Beweis. Bedeutende Übertragungen von Baudelaire und Verlaine sollten folgen. Am Ende steht eine von Zweig übertragene Stanze aus den Lusiadas, dem Hauptwerk des Luís Vaz de Camões. Es mochte für ihn in seinem brasilianischen Exil auch deswegen von besonderer Bedeutung gewesen sein, weil Camões – fern seiner Heimat – auf seiner Reise von Goa nach Macao im Mekong-Delta Schiffbruch erlitt, aber sein Werk retten konnte. Diese Verse also hingen in Petrópolis unter Glas gerahmt über Zweigs Schreibtisch – im portugiesischen Original und in seiner Übertragung:
Weh, wieviel Not und Fährnis auf dem Meere!
Wie nah der Tod in tausendfalt Gestalten!
Auf Erden, wieviel Krieg! Wieviel der Ehre
verhaßt Geschäft! Ach daß nur eine Falte
des Weltballs für den Menschen sicher wäre,
sein bißchen Dasein friedlich durchzuhalten.
Indes die Himmel wetteifern im Sturm.
Und gegen wen? Den ärmsten Erdenwurm!
(Zit. n. Heinrich Eduard Jacob, in: Fitzbauer 1959, S. 102)
Was bereits den frühen Stefan Zweig an der Lyrik Verhaerens beeindruckt hatte, dürfte ihn auch an dieser Strophe des Lusiadas-Epos bewegt haben: das Antlitz des Lebens, das in ihm erkennbar wird, die Konfrontation mit der gefahrvollen Lebensrealität. Diese Verse mag Zweig unmittelbar auf seine eigene Situation bezogen haben, womit gesagt ist: Für ihn wirkte in der Lyrik die Spannung zwischen Lebenserfahrung und rhythmisch-musikalischem Spracherlebnis.
Anders als zahlreiche Gedichte Verhaerens (etwa dessen Zyklus Traumlandschaften) hat Zweigs Lyrik nichts Etüdenhaftes oder Rhapsodisches. Gemessenheit kennzeichnet sie. Die meisten Gedichte dürfen als in sich geschlossen gelten. Selten sind die Gedichte, die sich im Maßlosen (auch der Gefühle) zu verlieren drohen. Ein solches Beispiel ist die quasi expressionistische Elegie Der verlorene Himmel, die mit dem Motiv der Rückkehr in die große Stadt arbeitet und eindrückliche Bilder findet: „Auf hohen Türmen hocken schlaflos die Stunden / Und schlagen mit Glocken nach mir.“ (Zweig GWE, Silberne Saiten, S. 155) Dieses Ich ängstigt sich vor „nie gekannten Gelüsten“ und ist dabei, sich selbst zu verlieren. Doch erweist es sich darin, wie gesagt, eher als Ausnahme. Denn das Ich gerade der frühen Gedichte Zweigs ruht eher in sich, kann sich die Welt und das Schöne, auch wenn es erschreckt, zumuten. Es handelt sich um Gedichte voller Wahrnehmungen, die spürbar auf ihren Rhythmus und Sprachklang bedacht sind. Man sehnt und ahnt und träumt in diesen Gedichten, schlägt ‚silberne Saiten‘ an, um herauszufinden, was man wirklich hören möchte, wie die erste Strophe des Gedichts Nocturno belegt:
Siehe die Nacht hat silberne Saiten
In die träumenden Saaten gespannt!
Weiche verzitternde Klänge gleiten
Über das selig atmende Land
Fernhin in schimmernde Weiten. (S. 26)
Diese Gedichte lassen selbst Spuren, die das lyrische Ich aufnehmen will, vibrieren. Spurenklänge sind diese Gedichte daher ebenso wie ‚silberne Saiten‘. Buchstäblich diesen Doppelton hatte denn auch Hugo Steiner-Prag bildlich mit seiner Einbandzeichnung für Zweigs ersten Gedichtband getroffen: Eine Spur durchzieht den Vordergrund wie ein Chladnisches Klangzeichen eine mit Sand bestreute Oberfläche. Sie führt zu einem dunklen Siedlungsbereich im Hintergrund, von dem sich ein aufgehellter Horizont absetzt.
Nicht nur Nocturno weist spät- oder neoromantische Züge auf. Der frühe Zweig erprobt als Lyriker auch den „Balladenton“ (S. 51), vernimmt das „innre Glockenspiel“ wie einst Mörike, sehnt sich nach dem Abend und seinem Zauber wie vor ihm Eichendorff und benennt das „Sehnsuchtsziel[ ]“ namens „Du“ (S. 30). Die „tiefe[ ] Nacht“ (S. 33) scheint die bevorzugte Zeit zu sein und die Art, wie er sein eigenes „Lied“ (S. 33) besingt und damit sein eigenes Dichten, belegt seine intime Vertrautheit mit der lyrischen Welt der Romantik:
Alle Lichter sind verglommen …
Träumend horch’ ich und beklommen
Wie mein Schmerz zum Liede wird,
Und als Schluchzen müder Geigen
Durch das abendstille Schweigen
Mit gebroch’nen Schwingen irrt … (S. 43)
Alles drängte den frühen Zweig zum „Lied“, zu dem auch die häufige Verwendung des Auslassungszeichens gehörte – oft ein Bestandteil früher Lyrik. Wenn Worte gebrechen, sagen drei Punkte das Ihre. Noch hatte sich die Einsicht in Zweig nicht durchgesetzt, dass man viel geschrieben haben müsse, um Auslassungszeichen verantworten zu können. Nietzsches Gedichte wissen davon; von dessen dithyrambischem Dichten waren die frühen Gedichte Zweigs noch unberührt; allenfalls im Gedicht Junge Glut spürt man den lyrischen Modus Nietzsches („Tiefe Nacht. – / Aus sinnenheißem Traum bin ich erwacht. / […] / … Und sinnetrunken tappen meine Hände / In schweigende Dunkelheiten hinein / Hinein in die leere, nichtssagende Nacht! …“; S. 60). Auch Hölderlins Dichtung, die in Der Kampf mit dem Dämon (1925) zum Thema werden sollte, hatte Zweig zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht wahrgenommen. Überraschender freilich ist, dass er offenbar auch von Heine unbeeinflusst geblieben ist. Dessen ironischer Ton fehlt. Zweigs Gedichte meinen es ernst – mit sich selbst und dem Sinn des Wohlklangs. Das Frühreif-Abgeklärte des jungen Hofmannsthal findet in diesen Gedichten durchaus seine eigenständige Entsprechung, weniger dagegen das Fluten der Welt durch Gedichtströme, wie dies der junge Rilke wagte oder besser: wie es sich ihm aufdrängte. Das „Drängen“ freilich verspürte auch der junge Zweig in sich, zumindest sein poetisches Ich:
Ein Drängen ist in meinem Herz, ein Beben
Nach einem großen, segnenden Erleben,
Nach einer Liebe, die die Seele weitet
Und jede fremde Regung niederstreitet.
Ich harre Tage, Stunden, lange Wochen,
Mein Herz bleibt stumm, die Worte ungesprochen
In müde Lieder flüchtet sich mein Sehnen,
Und heiße Nächte trinken meine Tränen … (S. 45)
Diese Gedichte wirken ebenso gekonnt wie glatt. Ihr sprachlicher Überfluss kokettiert mit den ‚ungesprochenen‘ Worten. Das „Herz“ schlägt in diesen Gedichten hörbar, erzwingt aber keinen Allerweltsreim.
3.Zyklische Ansätze
Das Dichten in Zyklen oder ‚Kränzen‘ ist in der Lyrik der Moderne ein romantisches Erbe. So beschließt denn auch ein Zyklus (Im alten Parke) Stefan Zweigs Band Silberne Saiten. Er nannte ihn einen „Spätsommertraum“ (S. 71). Man könnte ihn als Echo auf Stefan Georges Gedicht Komm in den totgesagten park und schau verstehen, das dessen großen Zyklus Das Jahr der Seele (1897) eröffnet. Der „Park“ in Zweigs Zyklus zeichnet sich durch Lebendigkeit aus: „Der Park ist aufgeblüht … Zu unsrer Liebesfeier / Singt er der Klänge und der Düfte schönstes Lied.“ (S. 74) Und doch schließt er melancholisch mit dem Gedicht Erinnerung:
Nun baut der Winter seine weißen Mauern,
Und alles strahlt in hellem heitrem Licht,
Nur unser Park liegt stets in stillem Trauern,
Das nie ein Laut mit fremder Stimme bricht.
Es ist, als dächt er jener Sommertage,
Die wir verbracht in froher Festlichkeit
Und rührend ist mir seine stumme Klage,
Allein in dieser weiten, schweren Einsamkeit … (S. 78)
Der Park wird in diesem Gedicht zum Subjekt. Er trauert, erinnert, klagt, und das unter einem Eichendorff’schen Vorzeichen, das ihm aus dessen Gedicht Mondnacht vertraut ist: „Es ist, als dächt […].“ Der Irrealis wird in Zweigs Gedicht zur Grundlage der melancholischen Stimmung, was sie freilich relativiert.
Noch ausgeprägter zyklisch präsentiert sich Zweigs Sammlung Die frühen Kränze. Bereits die gewählten Motti – sie reichen von Leopardi über Keats und Grillparzer bis Goethe und Dante – deuten eine erhebliche Horizonterweiterung dieses Dichtens an. Mit diesen Gedichten wollte Zweig offenbar aus dem unmittelbaren Zeitkontext heraustreten. Diese Tendenz setzt sich auch später mit den Zyklen Die Nacht der Gnaden, Bilder und Neue Fahrten fort. Vor allem letzterer versucht sich in räumlicher Entgrenzung, was Zweig motivisch bis nach Indien führen sollte. Das entscheidende Stichwort fällt im Gedicht Hymnus an die Reise: „Die Grenzen zerklirren“ (S. 145), ein geradezu expressionistischer Aufruf zur Aufhebung alles Trennenden. Dem eignet eine besondere Dynamik, die das Gedicht als ästhetisches Erlebnis vorstellt: „Und in dem Hinschwung von Ferne zu Fernen / Wächst dir die Seele, verklärt sich der Blick, / So wie die Welt im Tanz zwischen Sternen / Schwingend ausruht in großer Musik.“ (S. 145)
4.Das ‚Dämonische‘ in expressionistischer Gewandung
Die großen Themen der Prosa finden sich in Zweigs Lyrik nur sehr bedingt, und wenn, dann allenfalls punktuell, nicht aber leitmotivisch: Das ‚Dämonische‘ (→ IV.7 DAS DÄMONISCHE) bleibt auf seine lyrischen Künstlertypologien beschränkt (Die Herren des Lebens), Unruhe prägt das Gedicht Schwüler Abend („Des Blutes Unruh in die Nacht zu jagen! / Dies willenlose Durch-die-Gassen-treiben, / Ob mich nicht etwas aus dem Dunkel will, / Dies lüstern Spähn, die angespannte Hangen / An jeder mattbeglänzten Fensterscheibe – / Wird dieses knabenhaft verworrne Treiben / Denn noch nicht in mir still?“; S. 169 f.), aber ein lyrisches Lob des Pazifismus, überhaupt politische Gedichte sucht man bis auf den expressionistischen Dithyrambus Polyphem von 1917 – eine lyrische Kriegserklärung an den ‚dämonisch‘ mythologisierten Krieg – ebenso vergebens wie das eine große Wien- oder Paris-Gedicht. Überhaupt ist die Stadt quasi nur im Vorübergehen ein Thema (Sonnenaufgang in Venedig, Brügge oder das Konstanz-Gedicht Stadt am See). Und setzt sich das poetische Ich Zweigs einer Stadt etwas länger aus, etwa in seinem auch im Umfang ausgreifenden Gedicht Der verlorene Himmel, der Elegie einer Heimkehr, dann zeigt sich sein Autor, im Grunde ein Kind der Großstadt, vehement stadtkritisch. Die Schärfe dieser Kritik an der urbanen Zivilisation mag eine vom allgemeinen Zeitgeist inspirierte Geste gewesen sein, aber ihre Konturen prägen sich tief ein: Die Stadt habe den Himmel „[z]erbrochen“, sagt das Gedicht: „Scherben, zerschellt am gelben Steinbruch der Straßen, / Blinken nur nieder, umdüstert vom Qualm der Fabriken, / Gassen fenstern ihn eng zu grauen Quadraten, / Plätze schleifen ihn rund und, riesige Schrauben, / Bohren die Schorne den wölbigen flach an die zackigen Dächer.“ (S. 153) Expressionistische Stadtkritik in Elegienform – das ist zumindest eindrücklich gekonnt, einschließlich der Bildung wirkungsvoller Neologismen („fenstern“ und „Schorne“ für „Schornsteine“).
Diese ‚expressionistische Elegie‘ steht in Zweigs lyrischem Schaffen allein – ebenso wie seine epische Ballade von einem Traum (1923). Soll man behaupten, Zweig habe sic...