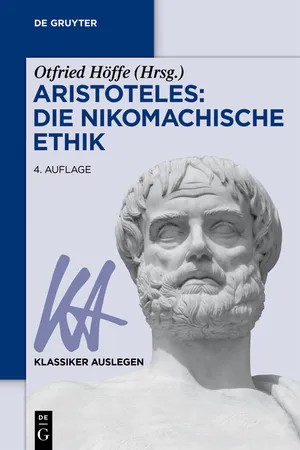
- 268 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Aristoteles: Nikomachische Ethik
About this book
Wer auch immer sich für eine Theorie moralischer bzw. humaner Praxis interessiert, findet in der Nikomachischen Ethik des Aristoteles eines der wenigen bis heute einschlägigen Grundmodelle. Im Mittelpunkt der ebenso nüchternen wie umsichtigen Analyse stehen u.a. die Begriffe Glück, Tugend, Entscheidung, Klugheit, Unbeherrschtheit, Lust und Freundschaft. Die Aristotelischen Ausführungen sind keineswegs nur von historischem Interesse, sondern üben auch auf die ethische Debatte der Gegenwart entscheidenden Einfluss aus. Die 13 Beiträge dieses Bandes legen die Grundlagen der Aristotelischen Untersuchung ebenso dar wie den modernen Hintergrund ihrer Rezeption.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Aristoteles: Nikomachische Ethik by Otfried Höffe in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Philosophie & Philosophie ancienne et classique. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Otfried Höffe
1 Einführung
1 Vom Gegenstand der theoretischen Philosophie, dem Sein, der Natur und der Erkenntnis, denkt man, daß er sich über die verschiedenen Epochen hinweg gleichbleibt. Daß man darüber mit Aristoteles immer noch systematisch diskutieren kann, ist daher nicht so überraschend wie dieselbe Möglichkeit im Bereich der Ethik. Bei ihrem Gegenstand, den Vorstellungen vom guten und gerechten Leben, rechnen wir mit derart grundlegenden Veränderungen seit der Antike, daß wir bei Aristoteles eine uns fremde Welt erwarten. Um so bemerkenswerter ist, daß er sich in der Ethik als ein mindestens ebenso anregender Gesprächspartner wie in der theoretischen Philosophie erweist.
Häufig verfährt man zwar anders. Man spricht vom Kosmosdenken und von einer mit Metaphysik befrachteten Ethik, also von Elementen, deretwegen diese Ethik als längst unzeitgemäß erscheint. Wer solche Gemeinplätze der Aristoteles-Interpretation beiseite schiebt und den Text unvorbelastet liest, wird überrascht sein, wie viele seiner Gedanken immer noch aktuell sind.
Trotz des zeitlichen Abstandes laden sie zu einem philosophischen Diskurs unmittelbar ein. Daß man dieser Einladung besonders gern folgt und die Nikomachische Ethik zu den meistdiskutierten Schriften nicht nur des Aristoteles, sondern der Philosophiegeschichte insgesamt gehört, dieser Tatbestand wird nur aufgrund gewisser Voraussetzungen möglich: Um mit einem Philosophen über die Epochen hinweg diskutieren zu können, dürfen zumindest seine Fragen nicht epochengebunden sein. Ferner sollte wenigstens ein Teil der Begriffe und begrifflichen Unterscheidungen sowie der Argumente nicht so eng mit Besonderheiten der griechischen Polis, mit ihren Traditionen und Üblichkeiten, verquickt sein, daß sie sich einem systematischen Diskurs von heute, einer universalistisch orientierten Debatte, a priori versperren.
Wer die Nikomachische Ethik studiert, findet diese Voraussetzungen erfüllt. Sowohl unter ihren Fragen als auch unter den Begriffen und Argumenten, mit denen sie beantwortet werden, gibt es erstaunlich viele, die bis heute eine Rolle spielen. Dazu gehören Grundbegriffe wie etwa die Unterscheidung von poiêsis und praxis, von Herstellen und Handeln. Außerdem entwickelt Aristoteles ein Modell menschlicher Handlung, das Strebensmodell, das erst durch eine Willensethik vom Typ Kants relativiert und selbst dann nicht einfach abgelöst wird. Ähnliches gilt von der Idee einer wahrhaft praktischen Philosophie, vom Gedanken eines Grundrißwissens und vor allem von den vielen Sacherörterungen. Von den Untersuchungen zur Freiwilligkeit und Entscheidung, zur Gerechtigkeit und zur Freundschaft, zur Willensschwäche (akrasia), der Lust (hêdonê) und der Berufung des Menschen zu einem theoretischen und einem politischen Leben – von all diesen Überlegungen läßt sich bis heute lernen.
Seit einiger Zeit macht die Forderung nach einer „Ethik ohne Metaphysik“ die Runde. Sofern man unter „Metaphysik“ die Theorie eines höchsten Seienden versteht, evtl. die einer jenseitigen Welt, wird das Programm einer „Ethik ohne Metaphysik“ schon von Aristoteles praktiziert, sogar in aller Selbstverständlichkeit und Nüchternheit. Zu den Themen der Aristotelischen Metaphysik gibt es zwar Querverweise, etwa durch die Kritik an Platons Lehre von einer Idee des Guten. Selbst hier ist zwar nicht das einzige, wohl aber das für die Ethik relevante Argument nicht metaphysischer, sondern genuin ethischer Natur. Ebensowenig argumentiert Aristoteles dort metaphysisch, wo er sich auf die für den Menschen charakteristische Leistung, auf ein ergon tou anthrôpou, beruft. Und das sogenannte Kosmosdenken spielt in den einzelnen Argumentationen so gut wie keine Rolle. Insofern gibt es einen weiteren Grund, Aristoteles zu studieren. Er entfaltet eine Ethik, die – je nach Interpretation – entweder ohne jede metaphysische Prämisse auskommt oder sich allenfalls mit einer minimalen Metaphysik zufriedengibt.
Statt dessen trifft die umgekehrte Beziehung zu; nicht die Ethik bedarf der Metaphysik, wohl aber die Metaphysik der Ethik. Die Frage „Wozu Metaphysik?“ ist nämlich eine praktische, sogar existentielle Frage. Als philosophische Disziplinen sind Ethik und Metaphysik weitgehend unabhängig voneinander. Die Rechtfertigung eines der Metaphysik und allgemeiner: eines der reinen Theorie gewidmeten Lebens gehört dagegen in den Aufgabenbereich der Ethik.
2 Überliefert ist Aristoteles’ Ethik in drei Schriften. Seit dem Jahre 1817, seitdem Friedrich Schleiermacher der Berliner Akademie der Wissenschaften die Abhandlung Über die ethischen Werke des Aristoteles vorgelegt hat (Sämtliche philosophische Werke, 3. Abtlg., III 306–333), sucht die philologische Forschung diese Textlage, „welche einzig ist in der ganzen hellenischen Literatur“ (ebd.), wissenschaftlich zu erklären. Trotz einer Fülle akribisch zusammengetragener Beobachtungen ist das „Rätsel der drei Ethiken“ zwar noch nicht gelöst (einen Überblick über die Forschung bietet Dirlmeier 1962, 127–143); es kann hier aber eingeklammert bleiben. Zur Einführung in die Nikomachische Ethik ist – abgesehen von interessanten Parallelen, Ergänzungen, auch Abweichungen – im wesentlichen nur ein Umstand zu erwähnen: Die drei Bücher V, VI und VII der Nikomachischen Ethik sind auch als Bücher IV, V und VI der Eudemischen Ethik überliefert, in ihren Handschriften aber nicht ausgeschrieben, sondern nur in Form eines Verweises auf den anderen Text gegenwärtig.
Wohin diese sogenannten kontroversen Bücher ursprünglich gehörten, ist philologisch bis heute umstritten. Aus stilistischen Gründen plädiert Dirlmeier (a.a.O.) für die Nikomachische Ethik, Kenny (The Aristotelian Ethics) dagegen für die Eudemische Ethik. Im Verhältnis zur Eudemischen Ethik und vor allem zur sogenannten Großen Ethik, den Magna Moralia, sind die Erörterungen der Nikomachischen Ethik meist am ausführlichsten. Aus diesem Grund und weil in den eindrucksvollen Wirkungsgeschichten der Aristotelischen Ethik sie die weitaus größte Rolle spielt, bildet sie den Hauptbezugstext der meisten Studien zu Aristoteles’ Ethik – und auch den Gegenstand der folgenden „kooperativen Kommentierung“.
Übrigens hat sich bis heute nicht klären lassen, warum dieser Text nach Nikomachos benannt ist. Gemeint ist entweder Aristoteles’ Vater, der Leibarzt am Hofe Philipps II. von Makedonien, oder Aristoteles’ Sohn oder sogar eine andere Person des Namens Nikomachos.
3 Das andere Titelwort êthikê (ethisch) übersetzt die lateinische Sprache mit „moralis“, die deutsche Sprache teils mit „sittlich“, teils bleibt sie beim Fremdwort „moralisch“. Weil der etymologische Zusammenhang klar ist, halten wir es für unverfänglich, bei Aristoteles von „Moral“, „moralisch“, auch von „Moralität“ und „moralischem Handeln“ zu sprechen. Was wir darunter verstehen, ist aber so stark von nacharistotelischen Gedanken durchsetzt, daß die Redeweise nicht unbedenklich ist. Andererseits vertritt Aristoteles nicht etwa eine moralfreie Moral. Unseren Begriff von Moral, eine bestimmte Form, menschliches Handeln zu bewerten, und die dieser Bewertung entsprechenden Verbindlichkeiten, kennt Aristoteles „natürlich“ auch; die Bewertung erfolgt aber in einer anderen Weise.
Die Nikomachische Ethik beginnt mit der Beobachtung, daß die für den Menschen charakteristischen Tätigkeiten auf Ziele hin orientiert sind, die vom Handelnden als positiv bewertet und insofern als ein Gut angesprochen werden. Die Begriffe „Ziel“ und „Gut“ sind weitgehend äquivalent. Nun bilden die verschiedenen Ziele bzw. Güter eine Hierarchie, an deren Spitze ein höchstes, und zwar ein schlechthin oder unüberbietbar höchstes Gut steht, das summum bonum, wie es im Lateinischen heißen wird. Aristoteles setzt es mit dem Glück gleich, freilich nicht mit dem Glück, das einem zustößt, mit Fortuna, sondern mit einem Glück, für das der Mensch selber die Verantwortung trägt, mit dem Glück im Sinne eines gelungenen, geglückten Lebens (eu zên).
Weil Aristoteles das Gute (agathon) in Begriffen von Zielen, griechisch: telê, denkt, heißt seine Ethik teleologisch: zielorientiert. Und sie heißt eudämonistisch, glücksorientiert, weil sie das höchste Gut als Glück, griechisch: eudaimonia, anspricht. Beide Begriffe – teleologisch und eudämonistisch – geben jedoch zu manchen Mißverständnissen Anlaß. Von ihnen seien in der Einführung nur zwei genannt. In der neueren Ethik-Debatte nennt man teleologisch jene utilitaristische Ethik, die alles Handeln auf das größte (maximale) Glück aller Betroffenen verpflichtet und die seit Jeremy Bentham und John Stuart Mill im englischen Sprachraum eine große Rolle spielt. Diese Ethik pflegt man mit der sogenannten deontologischen Ethik eines Immanuel Kant zu kontrastieren. Nun vertritt Aristoteles einen radikal anderen Glücksbegriff; weder ist das Glück maximierbar, noch soll es stets für alle Betroffenen gesucht werden. Folglich ist seine Ethik nicht im Sinne des Utilitarismus teleologisch. Und weil sie im Unterschied zu Kant das Glück nicht als „das ganze Wohlbefinden und Zufriedenheit mit seinem Zustande“ versteht (Grundlegung, 1. Abschnitt; Akad. Ausg. IV 393), ist sie auch nicht eudämonistisch in dem von Kant kritisierten Verständnis. Kant selber hat das auch nicht behauptet. An der entsprechenden Stelle, im Paragraphen 8 (Anm. II) der Kritik der praktischen Vernunft, dort, wo er ein System der „materiale(n) Bestimmungsgründe im Prinzip der Sittlichkeit“ verzeichnet, nennt er zwar Epikur und spricht erläuternd vom ‘epikureischen Prinzip der Glückseligkeitslehre’. Der Name Aristoteles taucht jedoch, vermutlich in absichtsvoller Vorsicht, nicht auf. (Zum Verhältnis von Aristoteles und Kant vgl. den abschließenden Beitrag, Nr. 13.)
Weil sich Aristoteles am Glück orientiert, hat er eine nüchterne, eine zwar nicht vollständig, aber doch erheblich „entmoralisierte“ Ethik vorgelegt. Eine Ethik, der alle Anklänge an „Pflicht“ und „Verbindlichkeit“ fehlen, eine Ethik der Traditionen und Üblichkeiten, wie manche Neoaristoteliker glauben, vertritt er aber nicht. Denn einerseits ist häufig von to deon oder dei oder hôs dei, also von dem, was sich gehört, deshalb verpflichtend ist, die Rede, und darunter ist (z. B. 1094a24, 1107a4) mehr zu verstehen als das Geziemende in einem konventionellen Verständnis. Schon aus diesem Grund sprengt Aristoteles die genannte Alternative „teleologisch oder deontologisch“ und ist beiden Seiten zugleich zuzuordnen. Normative Elemente im strengen Sinn einer nichtrelativierbaren Verbindlichkeit sind außerdem im Begriff des Glücks enthalten, da Aristoteles keinen subjektiven, sondern einen objektiven Glücksbegriff entwickelt. Derartige Elemente gibt es ferner in der Kritik am kata pathos zên, am Leben gemäß den Leidenschaften, und in den Formeln kata logon zên (gemäß der Vernunft leben oder vernünftig leben) und orthos logos (richtige Vernunft). Nicht zuletzt birgt einen streng normativen Gehalt der Begriff der aretê, der Tugend. Aristoteles versteht darunter so etwas wie eine menschliche Bestform, eine humane Exzellenz. Im Fall der moralischen Tugend ist ein hervorragender Charakter – in etwa: sittliche Rechtschaffenheit – und im Fall der dianoetischen oder intellektuellen Tugend eine Höchstform menschlicher Intelligenz gemeint.
Vergleicht man nun Aristoteles’ Ethik mit heutigen Ethiken, so fällt nicht nur die andere Form des Bewertens auf, sondern auch der Umstand, daß es nicht lediglich um ein Bewerten geht. Das Grundwort êthos bedeutet nämlich dreierlei: (1) den gewohnten Ort des Lebens, (2) die Gewohnheiten, die an diesem Ort gelebt werden, schließlich (3) die Denkweise und Sinnesart, den Charakter. Wegen der zweiten Bedeutung hat Aristoteles’ Ethik eine gewisse Ähnlichkeit mit der heutigen Ethologie, mit einer Lehre jenes ethos, das mit êthos etymologisch verwandt ist (vgl. auch II 1, 1103a17 f.). Seine Ethik ist durchaus eine Verhaltensforschung, allerdings auf den Menschen bezogen. Sie gehört zur Humanethologie bzw. Anthropologie oder, wie Aristoteles selber sagt, zur peri ta anthrôpeia philosophia, zur „Philosophie der menschlichen Angelegenheiten“ (X 10, 1181b15).
Weil der Mensch nicht auf artspezifisch vorgegebenen Bahnen („Instinkten“) wandelt, sondern in eigener Verantwortung zwischen verschiedenen Möglichkeiten zu wählen hat, unterscheidet sich seine Ethologie von der üblichen Verhaltensforschung grundlegend. Sie hat das Verhalten nicht bloß zu beschreiben, sondern auch zu bewerten. Und bei Aristoteles steht dieser zweite, normative Gesichtspunkt sogar im Vordergrund. Dabei geht es aber nicht bloß um jenes höchste Prinzip und Kriterium menschlichen Handelns, das man heute Moralprinzip nennt. Weit lebensnäher stellt Aristoteles zu den unterschiedlichen Aspekten eine Fülle von phänomenalen Betrachtungen und phänomenologischen Untersuchungen, von Methoden-, Begriffs- und Prinzipienanalysen an.
4 Sosehr sich die Philologen bei anderen Fragen noch unschlüssig sind, in einem Punkt können sie sich einigen: Die Nikomachische Ethik ist keine Jugendschrift des Aristoteles, sondern ein reifes Werk. Ihm liegt eine über weite Strecken wohlüberlegte Komposition zugrunde. Buch I steuert zunächst sehr rasch auf das Leitziel allen menschlichen Handelns, das Glück, zu und entfaltet sodann in mehreren Anläufen dessen Begriff: (a) Das Glück ist entlang von Lebensformen (bioi) zu diskutieren; (b) es ist keine Idee; (c) es ist formal gesehen ein schlechthin höchstes Ziel und (d) substantiell von der eigentümlichen Leistung des Menschen (ergon tou anthrôpou) her zu bestimmen. Aus dem substantiellen Begriff – der Tätigkeit der Seele nach der Vernunft oder doch nicht ohne sie folgt eine Zweiteilung, die von ethischer und von dianoetischer bzw. moralischer und von intellektueller Tugend, die die weitere Gliederung, von Buch II bis einschließlich Buch VI, vorgibt. In den Büchern VII–X 5 schließen sich „damit zusammenhängende Themen“ an: die Willensschwäche, die Lust und die Freundschaft. Den Höhepunkt und zugleich Schluß bildet eine Erörterung jener beiden Lebensformen, die dem Menschen eine gelungene, glückliche Existenz tatsächlich ermöglichen; es ist in erster Linie das theoretische, in zweiter Linie das (moralisch‐)politische Leben.
Des näheren kann man den Text in sieben Teile aufgliedern:
- (1) Buch I handelt über die Methode der Ethik (bes. I 1: Otfried Höffe) und – in mehreren Anläufen – über deren Gegenstand, das Glück (eudaimonia: John Ackrill); außerdem enthält es eine Kritik an Platons Idee des Guten (I 4: Hellmut Flashar).
- (2) Von den zwei Arten der Tugend untersuchen die Bücher II-V die ethischen Tugenden (aretai êthikai: Ursula Wolf) und zugleich das Themenfeld Freiwilligkeit – Entscheidung – Verantwortlichkeit (III 1–7: Christof Rapp). Im Rahmen der Tugendanalysen hat das der Gerechtigkeit gewidmete Buch V das Gewicht einer eigenen Abhandlung (Günther Bien).
- (3) Buch VI befaßt sich mit den „kognitiven Kompetenzen“ des Menschen, also mit der zweiten Art der Tugenden, mit den dianoetischen oder Verstandestugenden. Davon ist für eine Ethik im engeren Sinn vor allem die Klugheit (phronêsis) von Bedeutung (Pavlos Kontos). ...
Table of contents
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Vorwort
- Inhalt
- Hinweise zur Benutzung/Zitierweise
- 1 Einführung
- 2 Ethik als praktische Philosophie – Methodische Überlegungen (I 1, 1094a22–1095a13)
- 3 Aristotle on Eudaimonia (I 1–3 und 5–6)
- 4 Die Platonkritik (I 4)
- 5 Über den Sinn der Aristotelischen Mesoteslehre (II)
- 6 Freiwilligkeit, Entscheidung und Verantwortlichkeit (III 1–7)
- 7 Gerechtigkeit bei Aristoteles (V)
- 8 Phronêsis und ihre Gegenstände (VI 1–5, 8–10, 12)
- 9 Aristotle on Akrasia (VII 1–11)
- 10 Wert und Wesen der Lust (VII 12–15 und X 1–5)
- 11 Friendship (VIII und IX)
- 12 Theoretische und politische Lebensform bei Aristoteles (X 6–9)
- 13 Ausblick: Aristoteles oder Kant – wider eine plane Alternative
- Auswahlbibliographie zur Nikomachischen Ethik
- Glossar
- Personenverzeichnis
- Sachverzeichnis
- Hinweise zu den Autoren