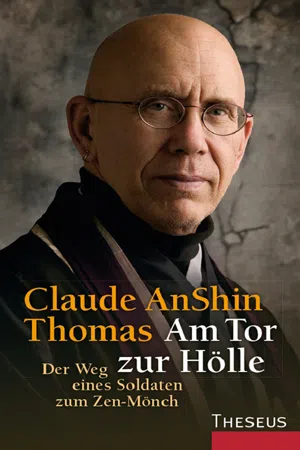![]()
Kapitel 1 | Die Saat des Krieges |
Bitte stellen Sie sich vor, es regnet. Schließen Sie die Augen und beobachten Sie, welche Gefühle, Gedanken und Empfindungen sich einstellen, wenn Sie an Regen denken.
Ich bin jedes Mal im Krieg, wenn es regnet, berühre wieder den Krieg. Zwei Regenzeiten hindurch habe ich schwerste Kämpfe durchlebt. Während der Monsune in Vietnam hinterlassen die gewaltigen Wassermassen alles nass durchtränkt und schlammig. Wenn es heute regnet, gehe ich noch immer über Schlachtfelder voller junger Männer, die schreien und sterben. Ich sehe noch immer Baumreihen vor mir, die vom Napalm zersetzt werden. Ich höre noch immer siebzehnjährige Jungen nach ihren Müttern und Vätern und Freundinnen rufen. Erst danach gelange ich an den Ort, an dem es einfach nur regnet.
In Ermangelung eines besseren Wortes schlage ich vor, diese Erfahrungen »Erinnerungsblitze« zu nennen. Es handelt sich dabei um das Wiedererleben von Erfahrungen, die ich noch nicht verarbeitet habe. Es kann passieren, dass ich in einem Lebensmittelladen eine Dose Gemüse aus dem Regal nehmen will und plötzlich von der Angst überwältigt werde, dass die Dose eine getarnte Sprengstoffladung enthält. Verstandesmäßig weiß ich, dass das nicht so ist, aber ich habe ein Jahr lang in einer Umgebung gelebt, in der es so war – und bis zum heutigen Tag bin ich nicht in der Lage, diese Erfahrung in ihrer ganzen Tiefe wirklich zu verarbeiten.
Dies ist nicht nur meine Geschichte. Sie wiederholt sich jeden Tag überall auf der Welt. Jeden Tag durchleben Menschen ihre Kriegserlebnisse und ihre Kindheitstraumata aufs Neue.
Bevor wir an einen Ort des Friedens gelangen, müssen wir mit unserem Leiden in Berührung kommen – wir müssen es umarmen und halten. Das habe ich in den letzten Jahren gelernt. Während der langen Jahre davor habe ich einzig gelernt, wie man Krieg führt.
Lernen, Krieg zu führen
Während der ersten siebzehn Jahre meines Lebens habe ich die Saat der Gewalt in mir gewässert. Nichts, was ich erlebte, sagte mir, dass Krieg nicht in Ordnung sei. Krieg war überall. Ich wuchs in einer Kleinstadt in Pennsylvania auf. Mein Vater hatte wie die meisten Männer im Ort am Zweiten Weltkrieg teilgenommen. Wenn die Männer über den Krieg sprachen, sagten sie nicht die Wahrheit. Weil sie nicht in der Lage waren, die Saat des Leidens zu berühren, die der Krieg tief in sie hineingelegt hatte, sprachen sie über ihn wie über ein großartiges Abenteuer. So wurde es an mich weitergegeben.
Als ich siebzehn wurde und mein Vater mir vorschlug, Soldat zu werden, hinterfragte ich dieses Ansinnen nicht. Ich wusste auch nicht viel über Politik; Politik spielte keine Rolle in meinem Leben. Heute weiß ich, warum politisches Interesse wichtig ist: Wir müssen wissen, was in der Welt vorgeht, denn was immer geschieht, hat seine Auswirkungen auf jeden von uns.
Mein Vater und die Männer und Frauen seiner Generation waren von Illusion und Verleugnung erfüllt; sie waren nicht in der Lage, Zugang zu der Wirklichkeit ihrer Erfahrungen zu finden. Das wurde weder bei ihnen noch bei mir auf irgendeine Weise gefördert. Doch während des Krieges in Vietnam geschah etwas Ungewöhnliches, etwas, das es vielen von uns unmöglich machte, die Kriegsrealität zu verleugnen.
Ich habe mich freiwillig für den Einsatz in Vietnam gemeldet, weil ich es für richtig hielt. Ich wusste nichts von der Natur des Krieges oder der Natur der Gewalt. Drei Tage nach meiner Ankunft in Vietnam begann ich zu begreifen. Es war irrsinnig. Ich kann es nicht genau beschreiben. Ich konnte und kann es schmecken und riechen und die Leere in den Augen aller um mich herum sehen. Es war, als befände ich mich in einem surrealistischen Horrorfilm. Während ich auf den Befehl wartete, der mich einer Einheit zuweisen würde, verbrachte ich meine ersten drei Tage in Vietnam damit, Tausende von verdorbenen Schokoriegeln in einem Vorratslager zu vernichten. Außerdem konfiszierte ich – das ist der militärische Ausdruck für stehlen – mit Unterstützung des diensthabenden Unteroffiziers eine Halskette aus gezüchteten Mikimoto-Perlen – eine Anschaffung, die meine finanziellen Mittel bei weitem überstiegen hätte. Zwei Tage später brachte ich die Kette zurück, denn ich wusste, dass es unrecht war, zu stehlen.
Während der Grundausbildung lehrte man mich zu hassen. Auf dem Schießstand schossen wir auf Zielscheiben, die Menschen darstellten. Wir lernten, MENSCHEN zu töten. Das ist die Aufgabe des Militärs. Nach den Schießübungen waren wir angehalten, unsere Waffen einzusammeln und zu einer Pyramide aufzustellen. Als ich mich anschickte, mein Gewehr dazuzustellen, ließ ich es fallen. Der Ausbilder, ein Oberfeldwebel, brüllte los, dass ich schlampig mit meinem Gewehr umgehe und dass mein Gewehr das Allerwichtigste in meinem Leben sei, denn von ihm hänge ab, ob ich überlebte oder starb.
Der Typ war einsfünfundneunzig groß, ich hingegen bin nur gut einssiebzig. Er baute sich vor mir auf, seine Brust wölbte sich vor meinem Gesicht, und er erdolchte mich fast mit dem Finger. Dann holte er seinen Penis heraus und pinkelte mich an, vor aller Augen. Ich durfte mich zwei Tage lang nicht waschen. Ich war so tief beschämt, dass ich an das Ausmaß meiner Gefühle nicht im Entferntesten zu rühren vermochte. Ich verspürte nichts als Zorn. Ich konnte es dem Oberfeldwebel nicht heimzahlen, denn dann hätte man mich in den Bau geschickt. Also habe ich meinen Zorn auf DEN FEIND gerichtet. Der Feind war jeder, der anders war als ich, jeder, der kein amerikanischer Soldat war. Diese Konditionierung, diese Entmenschlichung, ist notwendig, um ein guter Soldat zu werden. Ein guter Soldat kann sich dem Feind nicht verbunden fühlen. Soldaten werden darauf getrimmt, alles andere und jeden anderen als bedrohlich, gefährlich und potenziell tödlich wahrzunehmen. Du entmenschlichst den Feind. Du entmenschlichst dich selbst. Von diesem Zeitpunkt an ging eine Veränderung mit mir vor, die schlimme Konsequenzen haben sollte.
Meine Militärausbildung lehrte mich, ein ganzes Volk zu entmenschlichen. Es wurde nicht unterschieden zwischen dem Vietkong, der regulären vietnamesischen Armee und der allgemeinen vietnamesischen Bevölkerung. Doch wäre ich durch mein früheres Leben nicht auf die Militärausbildung vorbereitet gewesen, dann hätte diese Art Unterweisung nicht funktioniert. Als junger Mann wurde ich ermutigt, zu kämpfen, voller Voreingenommenheit zu sein und nationalistisch zu denken. Ich lernte, dass man Probleme durch Gewaltanwendung löst. Im Falle eines Konflikts gewinnt der Stärkere. So lernte ich es von meiner Mutter, von meinem Vater, von meinen Lehrerinnen und Lehrern und von meinen Freunden.
Als ich sechs Jahre alt war, lebte ich mit meinen Eltern in einem Apartment in einer ganz gewöhnlichen amerikanischen Gemeinde im nordwestlichen Pennsylvania. Mein Vater war Lehrer, und meine Mutter machte anderer Leute Wäsche, ging putzen und jobbte manchmal als Kellnerin oder Barfrau, um Geld dazuzuverdienen. Eines Tages wollte ich Fahrrad fahren, aber meine Mutter erlaubte es mir nicht. Ich fing an zu quengeln. Daraufhin gab mir meine Mutter einen Schubs, und ich flog mitsamt meinem Fahrrad die Treppe hinunter – zwanzig Stufen. Ich habe keine Ahnung, wieso ich mir keine ernsthaften Verletzungen zuzog. Vielleicht weil Kinder geschmeidig sind. Aber sie lernen auch entsprechend ihrer Umgebung.
Meine Mutter hat oft Gewalt angewendet. Einmal hat sie mir die Hand in den Nacken gelegt, mich herumgerissen und mein Gesicht an die Wand gedrückt – ohne ersichtlichen Grund. Anschließend hat sie mir gesagt, wenn ich ein besserer Mensch wäre, müsste sie mich nicht so behandeln. Ich lernte, keinen Schmerz zu empfinden und niemandem zu trauen, besonders Autoritätspersonen nicht.
In der Stadt, in der ich lebte, gab es einen See, und im Frühjahr stieg der Wasserpegel wegen der Schneeschmelze ziemlich an. Als ich etwa acht Jahre alt war, ging ich eines Tages hinaus, um zu spielen. Ich hatte ein Paar neue Turnschuhe bekommen, die noch ein sehr sauberes, klares Profil besaßen, und ich sollte spätestens um vier Uhr wieder zu Hause sein. Doch was weiß ein Kind schon von der Zeit? Als ich um vier Uhr nicht zu Hause war, geriet mein Vater in Sorge und machte sich auf die Suche nach mir. Er ging zum See hinunter und fand kleine Fußspuren, die zum Wasser führten, aber nicht mehr zurück. Die Fußspuren wiesen ein Profil auf wie das meiner neuen Turnschuhe. Mein Vater dachte, ich sei in den See gefallen, und der Gedanke, ich könne ertrunken sein, erfüllte ihn mit großer Furcht. Er eilte nach Hause, und als er ankam, war ich bereits dort.
Seine Reaktion auf seine Angst bestand darin, sie auf mich zu übertragen. Mein Vater konnte seine Angst nicht zulassen, er konnte das Gefühl seiner Machtlosigkeit nicht ertragen, also drückte er seine Angst durch das einzige Gefühl aus, zu dem er Zugang hatte: seine Wut. Er zerrte mich ins Badezimmer, zog mir die Hosen herunter, nahm seinen Gürtel ab und schlug mich damit, bis ich grün und blau war und vom Nacken bis zu den Fesseln blutete. Plötzlich merkte mein Vater, dass er mich ernsthaft verletzte, und hielt inne. Er begann Heilsalbe auf meine Wunden aufzutragen und erzählte mir, dass er mich geschlagen habe, weil er mich liebe. Das wiederholte er die ganze Zeit, während er mich verarztete: Er habe mich geschlagen, weil er mich liebe. Das war der Anfang einer langfristigen Beziehung, der Beziehung zwischen Liebe und Gewalt.
Mein Vater hatte nicht die Absicht, mir wehzutun. Er hatte keine andere Wahl. Mein Vater war nicht in der Lage, mit seinem Leiden in Berührung zu kommen. Und deshalb agierte er sein Leiden auf diese Weise an mir aus. Meine Mutter hatte nicht die Absicht, mir wehzutun. Sie war nicht in der Lage, mit ihren Gefühlen in Berührung zu kommen, sich ihr Leiden anzusehen, also ließ sie es an mir aus. Mein Vater, ein Soldat, der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte, starb im Alter von dreiundfünfzig Jahren an Alkoholismus.
Liebe und Gewalt
Liebe und Gewalt: Wenn ich mein Land liebe, müsse ich bereit sein, für mein Land zu kämpfen und zu sterben – so wurde es mir beigebracht. Als ich mit meiner Militärausbildung begann, meldete ich mich freiwillig, um in Vietnam zu kämpfen. Man sagte mir, dass ich dorthin gehe, um Frieden zu bringen. Dass Frieden mit vorgehaltenem Gewehr geschaffen werden könne. Und warum sollte ich etwas anderes glauben?
Im Alter von siebzehn Jahren verließ ich die High School und ging direkt zur Armee. Mein Vater ermutigte mich dazu. Ich brauchte seine schriftliche Einwilligung. Mir war ein Sportstipendium an der Universität angeboten worden, aber mein Vater drängte mich, es abzulehnen, denn er meinte: »Du bist nicht charakterfest genug. Du wirst versagen, und sie werden dich rauswerfen. Du bist zu wild.« Unterdessen habe ich durch die Unterweisungen des Buddha gelernt, »andere Menschen, Kinder eingeschlossen, auf keinerlei Weise zu nötigen, unsere Ansichten zu übernehmen«. Mein Vater teilte diese Überzeugung nicht.
Es steckte ein Körnchen Wahrheit in dem, was er sagte: Ich war ein ungebärdiges Kind. Wenn ich heute das eine oder andere von dem täte, was ich damals tat, würde man mich vermutlich verhaften und ins Gefängnis stecken. Damals war einfach eine andere Zeit. Ich habe regelmäßig Autos geklaut. Ich habe Autos geklaut, einzig um damit durch die Gegend zu kutschieren. Ich ging einfach nach Geschäftsschluss zum nächsten Plymouth-Händler und spähte die Gebrauchtwagen aus, bis ich einen fand, dessen Zündschlüssel steckte. Ich stieg einfach ein, fuhr los und gondelte die ganze Nacht aus reinem Vergnügen durch die Gegend. Anschließend brachte ich den Wagen wieder zurück. Weder die Autos noch ich haben je Schaden genommen. Reines Glück, glaube ich.
Ich kam immer sehr spät abends nach Hause. Niemand kümmerte sich um mich. Ich war auf mich selbst gestellt. Es gab keine festen Regeln. Mein Vater war wohl nicht in der Lage, Regeln aufzustellen, denn er war zu beschäftigt mit seiner Trinkerei, war zu sehr mit seinem eigenen Leiden befasst.
Außerdem war er oft fort. Seit ich zwölf war, wuchs ich auf, ohne dass sich jemand groß um mich kümmerte. Ich stand nicht unter elterlicher Aufsicht. Ich musste meine eigenen Regeln aufstellen.
Wie kam es, dass ich schließlich bei der Armee landete? Ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun können. Ich hatte keine Ahnung. Mein Vater schlug es mir vor, und er war der Vater. Selbst ein abwesender Vater ist eine mächtige Figur im Leben einer Familie, insbesondere im Leben eines Sohnes. Er und seine Freunde, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatten, saßen oft herum und betranken sich und erzählten Geschichten, die den Krieg verherrlichten und ihn aufregend und romantisch erscheinen ließen. Ich lauschte diesen Geschichten nicht bloß – ich sog sie begierig ein und wollte Teil von ihnen sein. Ich verinnerlichte diese Geschichten, ohne sie zu hinterfragen, ich hörte meinem Vater zu, ohne ihn zu hinterfragen, und wurde Soldat. Doch man muss nicht unbedingt mit einem Ex-Soldaten als Vater aufwachsen, um romantisch-verklärende und irreführende Geschichten über den Krieg zu hören. Die amerikanische Massenkultur produziert am laufenden Band Filme, die den Krieg romantisch verklären und verherrlichen. Sie zeigen den Krieg fast nie so, wie er wirklich ist.
Doch der Krieg, ob echt oder im Film, ist nicht der einzige Ort, an dem eine kriegerische Mentalität kultiviert wird. Sie wird auch durch den Sport an den Schulen befördert. In der High School war ich ein guter Sportler. Im Grunde hatte ich es meiner sportlichen Begabung zu verdanken, dass ich nicht von der Schule gewiesen wurde; ich war in allen Sportarten, die angeboten wurden, ziemlich gut: Baseball, Football, Ringen. Und in all diesen Sportarten, in all den Mannschaften herrschte diese kriegerische Mentalität. Auf diese Weise wurde ich konditioniert: durch die Gesellschaft, die Kultur (Filme, Literatur …), die Geschichten meines Vaters, die Geschichten der Freunde meines Vaters und meine eigenen Erfahrungen auf dem Sportplatz. Ich kannte die Wahrheit nicht; ich hatte nicht klar vor Augen, was wirklich geschah. Ich besaß eine romantische Vorstellung von Wettstreit, von Kampf und Krieg. Für mich waren kriegerische Auseinandersetzungen nur ein weiteres Spiel.
Gleichzeitig war ich sehr unsicher, extrem unsicher, schüchtern und zurückhaltend und äußerst misstrauisch. Wenn ich Soldat wurde und in den Krieg zog, so stellte ich mir vor, würde ich eine Menge Orden einheimsen und als Held heimkehren, geliebt und geachtet und versorgt werden. So lautete der Kern der Geschichten: Genau so würde es sein, und ich würde mir über nichts groß Gedanken machen müssen. Romantische Vorstellungen bewogen mich, Soldat zu werden. »Geh zur Armee«, sagte mein Vater, »dort werden sie einen Mann aus dir machen.« Und wenn ich ein Mann war, so dachte ich, würde man mir mit Respekt, Liebe und Fürsorge begegnen.
Ich erinnere mich genau daran, wie mein Vater mich zum Bus brachte. Wir fuhren von Waterford, Pennsylvania, nach Erie, Pennsylvania, eine Strecke von etwa vierzig Kilometern. Mein Vater brachte mich zu der Stelle, an der der Bus halten sollte. Ich hatte einen kleinen braunen Koffer bei mir … den Koffer eines Pfadfinders. Ja, pfadfinderbraun. Und ich hatte mit schwarzem Filzstift meinen Namen auf den Koffer geschrieben. Mein Vater fuhr mich zur Bushaltestelle, kaufte mir eine Fahrkarte und ließ mich dort allein zurück. Er wartete nicht auf den Bus. Er ließ mich einfach allein zurück. Verließ mich. Ließ mich im Stich. Meine Gefühle waren so heftig, so stark, dass ich sie nicht zuzulassen vermochte.
Der Bus brachte mich von Erie nach Buffalo, New York, hundertfünfzig Kilometer weiter, wo ich gemustert werden sollte. Als ich in Buffalo ankam, erhielt ich einen Gutschein für ein Hotel. Das Zimmer war ziemlich groß, und ich musste es mir mit mehreren anderen jungen Männern teilen. Ich ging als Erstes los und kaufte mir was Alkoholisches zu trinken. Ich war nicht bewusst auf der Suche nach einer Fluchtmöglichkeit, aber ich muss entsetzliche Angst gehabt haben. Also zog ich los und besorgte mir Alkohol – oder jemand anders besorgte ihn – und betrank mich. Auf diese Weise konnte ich vor meiner Angst flüchten.
Am nächsten Morgen hatte ich einen ziemlichen Kater, aber ich musste aufstehen und zur Musterung erscheinen. Wir alle mussten uns der ärztlichen Untersuchung unterziehen und eine Menge Papierkram ausfüllen. Dann wurden wir in einen anderen Raum geführt und legten den Eid ab. Ich war nun Soldat.
Am nächsten Tag fuhren wir mit dem Zug nach Fort Dix in New Jersey. Das letzte Stück zur Kaserne legten wir mit dem Bus zurück. Als wir ausstiegen, begrüßte uns ein Feldwebel, indem er uns unflätig beschimpfte, uns anschrie und uns demütigende Obszönitäten an den Kopf warf. Ich dachte sofort: »Meine Entscheidung war falsch. Ich habe eine schlechte Wahl getroffen. Das hier gefällt mir nicht. Mein Vater hat mich belogen. Das hier ist kein Spaß.« Ich wollte einfach nur nach Hause. Aber ich konnte nicht nach Hause gehen. Mein Leben hatte eine unwiderrufliche Wende genommen.
Als Erstes bekamen wir unsere Grundausrüstung: Decken, Uniform und Stiefel, Unterwäsche, Handtücher und eine Tasche, in der wir alles verstauen konnten. Dann mussten wir uns die Haare schneiden lassen. Wir schrieben das Jahr 1965; mein Haar war ziemlich lang. Der Einfluss der Beatles. Als ich vor dem Friseur stand, tauften die anderen mich Professor – vermutlich wegen meiner langen Haare. Ich begriff letztlich nicht, was da vor sich ging. Doch dann war ich auch schon an der Reihe, nahm auf dem Stuhl Platz, und der Friseur schor mir den Kopf. Es war demütigend.
Die achtwöchige Grundausbildung war eine schwierige Zeit für mich. Ich wollte nicht dort sein. Es war ein echter Kampf für mich. Die körperlichen Herausforderungen der Grundausbildung meisterte ich vorzüglich, aber ich hatte enorme Probleme mit der Disziplin, denn sie erschien mir sinnlos. Sie ergab für mich einfach keinen Sinn. Ich begriff nicht, dass es einzig darum ging, meinen Willen zu brechen. Meinen Willen zu brechen und mich nach ihrem Bilde wieder aufzubauen. Ich legte großen Widerstand an den Tag, und die Zeit war sehr schwer für mich.
Nach der ersten Hälfte der Grundausbildung kam ein Zeitpunkt, an dem ich äußerst mutlos war. Ich betrat die Kaserne und schlug mit der Faust jedes einzelne Fenster ein, an dem ich vorüberkam. Meine Fäuste waren voller Schnittwunden und bluteten. Ich ging nach oben und ging in ein Zimmer, schloss die Tür, verbarrikadierte sie mit einem Spind und kletterte zum Fenster hinaus. Ich setzte mich auf das Dach. Ein Oberleutnant, ein sehr aggressiver, zorniger, unsensibler junger Mann von Anfang zwanzig, kletterte zu mir hinaus. Ich weinte und wusste nicht, was ich tun sollte. Die Gefühle überschlugen sich in mir. Er reagierte darauf, indem er mich schlug. Er schlug mich ins Gesicht und boxte auf mich ein. Wenn ich das gemeldet hätte, wäre er in ernste Schwierigkeiten geraten. Doch ich kapierte gar nicht, dass er mich nicht hätte schlagen dürfen – misshandelt zu werden war für mich nichts Ungewöhnliches.
Später sprach ein Feldwebel mit mir. Er war ein freundlicher Mann, ein guter Mensch, und er zeigte ein gewisses Maß an Mi...