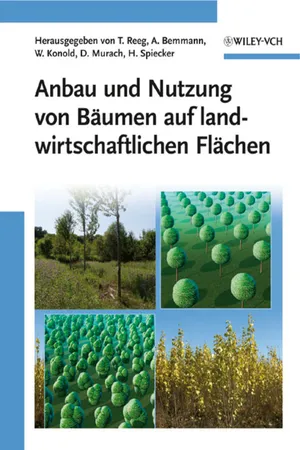![]()
Teil 1:
Kurzumtriebsplantagen
![]()
1
Kurzumtriebsplantagen – Stand des Wissens
Christine Knust
1.1 Einleitung
Kurzumtriebsplantagen haben in Deutschland in den vergangenen Jahren zunehmend Aufmerksamkeit erlangt. Einige land- und forstwirtschaftliche Landesanstalten haben Broschüren für Landwirte über den Anbau von Kurzumtriebsplantagen verfasst, z. B. Sachsen (Röhricht & Ruscher 2004), Mecklenburg-Vorpommern (Boelcke 2006), Baden-Württemberg (Unseld et al. 2008), Bayern (Burger et al. 2005) und Thüringen (Werner et al. 2006). Auch die Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) gab 2007 in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Hessen Rohstoffe (HeRo e.V.) eine Broschüre zur „Energieholzproduktion in der Landwirtschaft“ heraus (Hofmann 2007). Das große Interesse am Thema Kurzumtriebsplantagen zeigt sich auch daran, dass es auf verschiedenen Veranstaltungen intensiv diskutiert wurde (z. B. „Symposium Energiepflanzen“ des BMELV, 2007; „Energiepflanzen im Aufwind“ des Leibniz-Instituts für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V., 2007; „Fachsymposium Umwelt und Raumnutzung – nachhaltige energetische Nutzung von Biomasse“ des LfUG (Landesamt für Umwelt und Geologie) Sachsen, 2007; „3. Fachtagung zu Anbau und Nutzung von Bäumen auf landwirtschaftlichen Flächen“ des BMBF-Verbundvorhabens Dendrom, 2008). Mehrere Forschungsprojekte haben sich mit der Schaffung von praxisrelevantem Wissen über Anbau und Nutzung schnellwachsender Baumarten im Kurzumtrieb auseinandergesetzt und dadurch die wissenschaftliche Basis erheblich gefestigt. Im Rahmen der vom BMBF geförderten Forschungsprojekte Agrowood und Dendrom sowie des DBU-Projektes Novalis und des von der FNR geförderten Projektes ProLoc werden aktuelle Fragestellungen zum Thema Kurzumtriebsplantage behandelt und der Öffentlichkeit präsentiert.
Die rechtliche Einordnung dieser Landnutzungsform besitzt eine große Bedeutung und wird derzeit ebenfalls diskutiert. Es wird erwartet, dass im Rahmen der gegenwärtig stattfindenden Novellierung des Bundeswaldgesetzes eine Regelung zur Ausnahme von Kurzumtriebsplantagen vom Waldbegriff aufgenommen wird. Die Landeswaldgesetze der Bundesländer Bayern, Hessen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen (BayWaldG, Hessisches Forstgesetz, LWaldG Schleswig-Holstein, NWaldLG) enthalten bereits Regelungen, die Kurzumtriebsplantagen vom Waldbegriff ausnehmen.
Trotzdem haben sich Kurzumtriebsplantagen in Deutschland bislang aufgrund verschiedener Restriktionen nicht als landwirtschaftliche Kultur etablieren können (Hoffmann & Weih 2005). Zu den Zielen der beiden Forschungsvorhaben Agrowood und Dendrom gehört daher auch die Analyse der Gründe für die zögerliche Annahme dieses Landnutzungssystems und die Bearbeitung und Lösung der dabei identifizierten Probleme, um einen Beitrag zum Abbau der bestehenden Hemmnisse zu leisten.
1.2 Definition und Entwicklung von Kurzumtriebsplantagen
Wenn in diesem Buch von Kurzumtriebsplantagen die Rede ist, sind damit intensive Produktionssysteme zur Holzerzeugung in kurzen Zeiträumen gemeint. Die Kurzumtriebsplantage wie wir sie heute kennen – bestehend aus speziell zu diesem Zweck gezüchteten sehr produktiven Baumarten, einer hohen Pflanzdichte und vollmechanisierter Ernte in Abständen von wenigen Jahren – stellt dabei keine grundsätzliche Neuerung, sondern lediglich eine Weiterentwicklung Jahrhunderte alter Waldbewirtschaftungsstrategien dar (Dickmann 2006). So werden Kurzumtriebsplantagen gelegentlich mit historischen Niederwaldsystemen verglichen (Splechtna & Glatzel 2005, Dickmann 2006). Beide dienen der Maximierung des Holzertrages und beruhen auf der Regeneration des Bestandes durch Stockausschläge. Ansonsten weisen sie jedoch große Unterschiede in der Intensität der Bewirtschaftung auf, was eine Definition intensiver Kurzumtriebskulturen von Drew et al. (1987) verdeutlicht:
„Ein waldbauliches System basierend auf kurzen Kahlschlagszyklen von meist einem bis 15 Jahren, unter Verwendung intensiver Kulturtechniken wie etwa Düngung, Bewässerung und Unkrautbekämpfung sowie genetisch überlegenen Pflanzenmaterials. “
Ebenfalls häufig verwendet wird die Definition von Thomasius (1991):
„Baumplantagen sind der Produktion spezieller Forsterzeugnisse dienende, nach geometrischen Prinzipien geordnete Anpflanzungen besonders dafür geeigneter Baumarten, Rassen oder Sorten auf von Natur aus oder durch künstliche Zubereitung sehr produktiven Standorten, die bei hinreichendem Schutz und entsprechender Pflege in kurzen Produktionszeiträumen nach Quantität und/oder Qualität über dem natürlichen Niveau liegende Erträge liefern.“
Im Gegensatz dazu wurden historische Niederwälder in Abständen von 15–30 Jahren geerntet (Hofmann 1999) und bestanden aus einheimischen, züchterisch unveränderten Baumarten wie etwa Hasel, Hainbuche und Linde. In den lichten Phasen des Bestandeslebens in den Jahren nach der Ernte war zudem der Eintrieb von Vieh eine ökonomisch relevante Nebennutzung.
In gemäßigten Klimaregionen (Mitteleuropa, Nordamerika) werden den Anforderungen heutiger Kurzumtriebsplantagen besonders Pappeln und Weiden gerecht, die mit dem Ziel der Steigerung des Biomasseertrages und der Resistenz gegenüber bestimmten Schadfaktoren züchterisch bearbeitet wurden (Dickmann 2006, Schütte 1999). Die Intensität der Bewirtschaftung von Kurzumtriebsplantagen, die Anlage in geometrischen Pflanzverbänden, die Verwendung meist nur eines Klons je Teilfläche sowie gegebenenfalls die Verwendung von Dünger und Pflanzenschutzmitteln macht zudem deutlich, dass die Kurzumtriebsplantagen eher ein landwirtschaftliches als ein forstwirtschaftliches System sind. Daher werden Kurzumtriebsplantagen in der Regel auf landwirtschaftlichen Flächen angelegt und von Landwirten bewirtschaftet.
Moderne Kurzumtriebsplantagen gibt es in Mitteleuropa seit etwa einhundert Jahren, als erstmals Hybride aus europäischen Schwarzpappeln (Populus nigra L.) und kanadischen Schwarzpappeln (Populus deltoides L.) aufgrund ihrer überlegenen Wuchseigenschaften angebaut wurden (Dickmann 2006). Seitdem werden weiterhin gezielte Hybridisierungen von Pappeln durchgeführt, deren Nachkommen im Hinblick auf Wuchsleistung und Resistenz gegenüber Schadfaktoren selektiert, vegetativ vermehrt und in Plantagen angebaut werden. Neben der Pappel wird auch die Weide, insbesondere Hybride der Korbweide (Salix viminalis L.), für den Anbau in Kurzumtriebsplantagen verwendet. In Skandinavien, Großbritannien und dem Nordwesten der USA ist die Weide die wichtigste Kurzumtriebsplantagenbaumart (Rowe et al. 2007, Hoffmann & Weih 2005, Volk et al. 2006).
Weidenplantagen eignen sich fast ausschließlich zur Gewinnung von Holzhackschnitzeln für die energetische Verwendung, während Pappelplantagen, je nach Design der Flächenanlage, sowohl für die Energieholz- als auch für die Industrieholzproduktion in Frage kommen. Insbesondere in Italien, Frankreich und dem mittleren Westen der USA werden Pappeln vorwiegend zur Erzeugung von Holzsortimenten für die stoffliche Verwertung genutzt. In Italien gibt es etwa 118 000 ha, in Frankreich 236 000 ha und im mittleren Westen der USA 35 000 ha Pappelplantagen (FAO 2004). Pappelholz wird dort zur Herstellung von Papier und Zellstoff sowie für andere stoffliche Nutzungsmöglichkeiten verwendet. Diese Plantagen werden mit geringeren Pflanzdichten als Energieholzplantagen und meist aus Kernwüchsen begründet und benötigen Umtriebszeiten von ca. 10–15 Jahren. Bei entsprechend hohen Pflanzdichten eignet sich die Pappel jedoch genauso für Energieholzplantagen wie die Weide.
In Deutschland kommen grundsätzlich beide Baumarten für den Anbau in Frage, wobei hauptsächlich die Zielstellung und die standörtlichen Bedingungen die Auswahl bestimmen. In der Regel ist von Pappeln eine größere Wuchsleistung zu erwarten als von Weiden. In den niederschlagsarmen Gebieten Ostdeutschlands sowie zur Rekultivierung von Sonderstandorten wie etwa Bergbaufolgelandschaften wird auch zunehmend die Robinie (Robinia pseudoacacia) verwendet (Grünewald et al. 2007, Landgraf & Böcker 2006). Sie ist anspruchsloser in Bezug auf die Wasser- und Nährstoffversorgung. Als Leguminose kann sie Luftstickstoff binden und somit ihre Stickstoffversorgung auch auf armen Standorten sicherstellen.
1.3 Kurzumtriebsplantagen in Deutschland
Trotz ihrer Vorzüge werden nach wie vor nur wenige Kurzumtriebsplantagen von den Landnutzern angelegt. Eine große Herausforderung für die Einführung dieser Landnutzungsform stellt die Überschneidung landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Kompetenzen dar. Dies ist in Deutschland insbesondere deshalb relevant, weil die Land- und Forstwirtschaft durch eigene Gesetzgebung, eigene Verwaltungsstrukturen und eigene Berufsbilder der jeweiligen Bewirtschafter traditionell streng getrennt sind. Abhängig von den jeweils herrschenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben Kurzumtriebsplantagen in der Vergangenheit jedoch zumindest als Forschungsobjekt in Versuchsanlagen in unterschiedlichem Maße Bedeutung und Aufmerksamkeit erlangt.
Die Ölkrisen 1973 und 1979/80 haben den Industriestaaten die Abhängigkeit ihrer Energieversorgung von Importen aus politisch instabilen Regionen verdeutlicht. Um die Versorgungssicherheit zu erhöhen, kam zunehmend die Energiebereitstellung aus heimisch produzierbaren Rohstoffen ins Gespräch. Der Anbau schnellwachsender Baumarten zur Biomasseproduktion für die energetische Verwendung hat in diesem Kontext erstmals eine nennenswerte Bedeutung erlangt. Zu Beginn der 1990er Jahre wurde die globale Erwärmung als Folge des anthropogenen Treibhauseffektes unübersehbar. Im Rahmen der Rio-Konferenz von 1992 wurde erstmals eine Klimarahmenkonvention mit verbindlichen Klimaschutzzielen formuliert und von den Vertragsstaaten ratifiziert. Bei den darauf folgenden Vertragsstaatenkonferenzen (COP 2 bis 13) wurden diese z.T. konkretisiert und fanden anschließend Eingang in die nationale Politik der Vertragsstaaten, so auch der Europäischen Union und Deutschlands (BMU 2005). Neben der Einsparung von Energie durch Effizienzsteigerung ist die Verwendung erneuerbarer Energiequellen ein wichtiger Bestandteil der Klimaschutzstrategien. Daher wird seitdem die Energieholzproduktion in Kurzumtriebsplantagen insbesondere als Möglichkeit der umweltschonenden Biomasseproduktion zur CO2-neutralen Energiegewinnung diskutiert (SRU 2007, WBA 2007).
Mitte der 1990er Jahre war zudem die sinnvolle Verwendung von nicht für die Nahrungsmittelproduktion benötigten landwirtschaftlichen Flächen ein wichtiges Thema. Ein groß angelegtes Modellvorhaben „Schnellwachsende Baumarten“ beleuchtete die Möglichkeite...