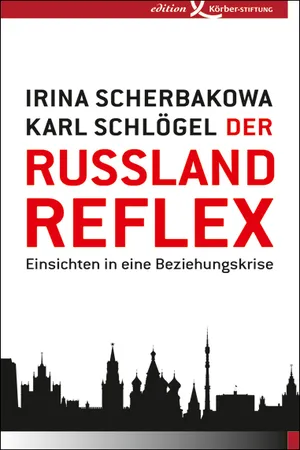
- 144 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Zwei Freunde und Weggefährten im Gespräch: Die russische Historikerin und Bürgerrechtlerin Irina Scherbakowa und der renommierte deutsche Osteuropa-Historiker Karl Schlögel diskutieren über ihre Heimatländer, deren Beziehung in einer tiefen Krise steckt. Ausgang ungewiss.
Schockiert schauen sie auf die erneute Instrumentalisierung von Geschichte und die Rückkehr rhetorischer Stilmittel aus sowjetischen Zeiten. Persönlich und selbstkritisch berichten
sie von ihren Lebens- und Arbeitserfahrungen zwischen Kaltem Krieg, Glasnost und der Putin-Zeit, sprechen kenntnisreich und engagiert über aktuelle politische Tendenzen und den Ukraine-Konflikt.
Dabei bekennen sie sich leidenschaftlich zum Geist der Aufklärung, der Pflicht zum Selberdenken und fordern vehement das Recht des freien Wortes - in beiden Ländern.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Der Russland-Reflex von Irina Scherbakowa,Karl Schlögel im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politics & International Relations & International Relations. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Zeitenwende

Geschichtsbild und Realität
Von den Deutschen heißt es oft, sie seien Meister der Vergangenheitsbewältigung. Neben aller Anerkennung für den kritischen Umgang, den die Deutschen mit ihrer eigenen Diktatur- und Gewaltgeschichte gefunden haben, schwingt dabei manchmal auch eine leise Ironie mit. Hat die besondere Gründlichkeit, mit der sich die Deutschen der Vergangenheit widmen und gewidmet haben, mit Blick auf Russland und die aktuelle Beziehungskrise zu einer gewissen Betriebsblindheit geführt? Was sagt der Umgang mit der Geschichte über das jeweilige Selbstverständnis in Deutschland und Russland aus?
Karl Schlögel: Bei uns in Deutschland hat sich ein Geisteszustand festgesetzt, der davon ausgeht, dass alles schon irgendwie läuft. Es fehlt ein Bewusstsein dafür, dass plötzlich etwas Überraschendes passieren könnte, auf das niemand vorbereitet ist. Dafür, dass es plötzlich wieder Krieg gibt, zum Beispiel. Dem kann man nicht ausweichen. Ich habe zwar 1995 in »Go East« angesichts der Jugoslawienkriege geschrieben, dass nach der Herrschaft der Toten über die Lebenden die Kämpfe der Lebenden gegen die Lebenden folgen würden. Aber dass für ganz Europa noch einmal die Frage Krieg oder Frieden gestellt würde, lag jenseits meiner Vorstellungskraft. Der Krieg ist zurück, dazu muss man eine Einstellung entwickeln. Man merkt jetzt, dass das Gespräch, die Diplomatie nicht das letzte Wort hat, sondern derjenige, der die Macht hat, der bereit ist, Gewalt einzusetzen. Gesellschaften müssen, wenn sie den Frieden erhalten wollen, bereit sein, sich zu verteidigen. Das ist eine elementare Tatsache, ja Banalität, aber wir mussten darüber nicht nachdenken, weil es ja das »Gleichgewicht des Schreckens« gab, eine geborgte Sicherheit.
Die militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine – manche bestreiten ja, dass es die überhaupt gibt – hat dieser Unbekümmertheit, der Gleichgültigkeit der friedensverwöhnten Gesellschaft einen Schlag versetzt. Das ist gut so. Wir müssen neu nachdenken über die Welt, in der wir leben, in der ein souveräner europäischer Staat angegriffen werden kann, in der die Europäische Union, wie sie sich über viele Jahrzehnte herausgebildet hat, vielleicht auseinanderfliegt. Nachdem man sich in den vergangenen Jahrzehnten fast schon daran gewöhnt hat, dass Europa nach den Kriegskatastrophen endlich zusammengefunden hat, steht in der Ukraine und in Russland gerade alles auf dem Spiel. Sich mit dieser Situation intellektuell und dann vielleicht auch praktisch zu konfrontieren, das wird hierzulande abgewehrt und derzeit ja auch überlagert von der Griechenland- und Flüchtlingskrise – auf all diese Herausforderungen gibt es, man muss nur dem Recycling der Talkshows zusehen, keine überzeugenden Antworten. Man muss aufhören, so zu tun, als wüsste man, was morgen in Russland geschieht, und man muss anfangen, sich auf alle Fälle, auch die Fortsetzung der Aggression, einzustellen.
Im Frühjahr 2014 sagte uns Putin, dass in der Ukraine ein Genozid stattfindet. Darin ist eine solche Maßlosigkeit schon der Sprache, dass man den Eindruck hat, der Mann lebt in seiner eigenen Welt. Alles deutet darauf hin, dass er auf die Integrationskraft von Feindbildern setzt – Amerika als der Dämon, der an allem schuld ist, auch an der selbst verschuldeten Krise im heutigen Russland. Wenn er seinem Land schon keine Perspektive der Entwicklung und Modernisierung bieten kann, braucht er wenigstens Feinde und Siege. Walter Laqueur hat von einer neuen Medienwirklichkeit in Russland gesprochen, er nennt sie Konfabulation. Man muss sich nur das lange Interview ansehen, das Putin zum ersten Jahrestag der Besetzung der Krim im Fernsehen gegeben hat, wie animiert, ja prahlerisch er davon spricht, wie gut und professionell er die Krim besetzt und den Konflikt in der Ostukraine angezettelt hat – was er ein Jahr zuvor noch bestritten hatte. Ein Mann, der so frivol über einen Krieg spricht, den er angezettelt hat, mit inzwischen Tausenden von Toten, zwei Millionen Flüchtlingen, entvölkerten Städten und ruinierter Industrie – was fällt einem dazu ein, außer dass man sich gegen ihn verteidigen muss? Minsk II funktioniert nicht, kann gar nicht funktionieren, solange russische Waffen und russisches Militär über die ukrainische Grenze geschafft werden und – mal mehr, mal weniger – der Krieg in Gang gehalten wird. Man nennt das: Eskalationsdominanz.
Irina Scherbakowa: In Russland hatte sich seit der Jahrtausendwende ein völlig neues Selbstbewusstsein entwickelt. Denn in der Perestroika-Zeit verschwand der äußere Feind, man sah sich als ein Teil von Europa, laut Gorbatschow dem »gemeinsamen Haus«. Aber die Enttäuschungen, die die marktwirtschaftlichen Reformen gebracht haben, das Empfinden, dass man sehr lange braucht, um ein gleichberechtigter Teil dieser Welt zu werden, erzeugte bei den Menschen ganz andere Gefühle. Dazu kam, dass dieser scheinbare Reichtum durch Öl und Gas bei den Menschen die Vorstellung erzeugte, der Westen sei von uns abhängig.
Aus diesem falschen Gefühl der Stärke entwickelte sich die Haltung: »Der Westen kann uns mal.« Diese Einstellung ist dann schließlich auch politische Wirklichkeit geworden. Doch dann setzte die Wirtschaftskrise ein, das Leben wurde für viele wieder schwerer. Das Geschichtsbild und die Realität passten plötzlich nicht mehr zusammen, und das führte zu zahlreichen Konflikten auf mehreren Ebenen – in Russland selbst, aber auch im Verhältnis zwischen Russland und seinen europäischen Nachbarn.
Der militante und aggressive Charakter des russischen Nationalpatriotismus in den letzten Jahren begleitete auch die Feierlichkeiten zum 9. Mai 2015. Zum 70. Jubiläum des Kriegsendes empfand ich das als besonders schlimm. Zu einer riesigen Militärparade kam eine ganz offen aggressive Rhetorik hinzu. Da fast keine ehemaligen Verbündeten angereist waren, feierte man fast für sich allein. Dass die Ukraine fehlte, wäre früher unvorstellbar gewesen. Eine Fotoausstellung über die Alliierten wurde in Jekaterinburg verboten. Dann der »patriotische« Kitsch, der überall zu sehen war: Kinder in sowjetischer Militäruniform, bis hin zu Babys, als Panzer dekorierte Kinderwagen, »patriotische« Modeschauen, überall Sankt-Georgs-Bändchen, sogar auf den Hausschuhen, die man extra zum Feiertag produziert hatte.
Die Geschichte des Sankt-Georgs-Bandes reicht zurück bis ins 18. Jahrhundert. Seit dem russischen Kaiserreich galt es als höchste militärische Auszeichnung.
Seit dem 60. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg, dem 9. Mai 2005, wird es wieder vermehrt als Zeichen des Gedenkens verwendet – auch von prorussischen Demonstranten und Aktivisten während der Krimkrise im Frühjahr 2014.
Karl Schlögel: Die Deutschen haben allen Grund, der sowjetischen Opfer im Krieg gegen Hitler, also auch für die Befreiung der Deutschen von Hitler, zu gedenken. Es gibt kaum jemanden, der nicht versteht, welche Bedeutung der »Tag des Sieges« für die Bewohner der ehemaligen Sowjetunion hat. Aber das Gedenken an die Toten, die Gefallenen, zu benutzen, um eine Aggression gegen das Brudervolk der Ukrainer zu maskieren, das ist eine so ungeheuerliche Steigerung putinscher Propaganda, dass sie schon wieder ins Gegenteil umgeschlagen ist. In Kiew gab es am 8. und am 9. Mai zwei getrennte Gedenkfeiern und Paraden, die der geteilten, der gespaltenen Erinnerung an die Befreiung, die auch eine Besetzung war, Rechnung trugen. Im Museum des Großen Vaterländischen Krieges hoch über dem Dnjepr erfährt man fast alles über die deutsche Herrschaft in Kiew und in der Ukraine, aber im Foyer sind auch Uniformen der im Donbass gefallenen freiwilligen Soldaten, die ihr Land verteidigen, zu sehen. Es ist wahr, dass Putins Medienleute, was den Informationskrieg angeht, einen Vorsprung haben, aber sie treiben es zu toll, um nicht irgendwann von ihren Lügen eingeholt zu werden: Siehe die Bilder des russischen Fernsehens vom gekreuzigten Kind im Donbass. Irgendwann wird Putin die Wirklichkeit einholen, sprich: die im Donbass gefallenen russischen Soldaten, die es angeblich gar nicht gibt.
Beziehungskrise
Irina Scherbakowa: Wir müssen uns bewusst machen, dass Europa als politischer Raum weder nach Osten noch nach Südosten klar umrissene Grenzen hat. Heute merken wir sogar, dass auch das Mittelmeer uns nicht nach Süden begrenzt – die Flüchtlinge betrachten das Meer ja fast als, wenn auch lebensgefährliche, »Brücke«. Das sind ganz neue Sichtweisen und Erfahrungen, auf die wir uns einstellen müssen – jeder Einzelne von uns und auch das politische Europa.
Die entscheidende Frage lautet doch: Wie positioniert sich Europa? Will – und kann – Europa etwas gegen die Entwicklung in der Ukraine tun? Wie positioniert sich Europa gegenüber Russland? Die Ukrainepolitik und der Militärkonflikt in der Ostukraine sind das eine. Wenn er sich nicht friedlich lösen lässt, wäre es eine Katastrophe. Aber innerrussisch können wir nun ganz deutlich sehen, welche politischen Strömungen derzeit aktiv sind: Es sind neue nationalistische, ja faschistoide Zustände entstanden. Menschen und Schichten, die bisher keine Rolle spielten oder Bedeutung hatten, treten plötzlich ins Rampenlicht.
Das sind die Kräfte, die sich als Anti-Maidan-Bewegung gruppieren: militante Stalinisten, orthodoxe Fundamentalisten, paramilitärische Klubs und Vereinigungen, Menschen, die schon in Tschetschenien, jetzt in der Ukraine auf der Seite der Separatisten gekämpft haben und zurückkehren.
Man hat den Eindruck, sie schießen wie Giftpilze aus dem Boden. Es gibt natürlich auch Gegenbewegungen – man sah das deutlich auf einer großen Demonstration nach dem Mord an dem Oppositionspolitiker Boris Nemzow –, es gibt unabhängige NGOs, die trotz aller Hetze und Schwierigkeiten in Russland arbeiten, aber diese Kräfte sind schwach im Vergleich zu der großen politischen Bewegung des Nationalismus.
Karl Schlögel: Seit der Annexion der Krim bin ich praktisch ununterbrochen online, um auf dem Laufenden zu bleiben und herauszufinden, was in Russland und in der Ukraine vor sich geht. Wer im Hintergrund welche Fäden zieht, wie das Land tickt und weshalb die Führung Russlands, und besonders der russische Präsident, so agiert: herausfordernd, risikobereit und verhängnisvoll für Russland, aber eben nicht nur für Russland.
Petersburg. Das Laboratorium der Moderne lautet das Werk von Karl Schlögel, das die 300-jährige Geschichte der Stadt als großes gesellschaftliches Experiment erzählt und vor allem die Jahre 1909 bis 1921 in den Fokus nimmt, als in St. Petersburg kulturelle Höchstleistungen stattfanden (Ballett, Literatur, Kunst) und mit der Revolution auch die Weltgeschichte eine neue Wendung bekam.
Es gibt ja Stimmen, die behaupten, dass möglicherweise die Ukraine selbst und eine falsche EU-Politik das Ganze ausgelöst oder provoziert hätten. Ich hingegen bin überzeugt, dass hinter dieser sogenannten Ukrainekrise eher eine russische Krise steckt und dass wir das ganze Reden über die Ukraine verlagern und anfangen müssen, über Russland zu reden. Für mich ist das deutsch-russische Verhältnis, wie wir es bisher kennen, in gewisser Weise zu Ende. Wir müssen im Prinzip ganz neu anfangen. Das heißt nicht, dass alles, was wir gemacht haben, nutzlos oder falsch war. »Petersburg. Das Laboratorium der Moderne«, mein Buch aus den späten 1980er-Jahren, war der Versuch, Petersburg auf die Landkarte der Moderne zurückzuholen, von der es für lange Zeit verschwunden war. Meine Studien über das russische Berlin beleuchten die deutsch-russisch-sowjetischen Beziehungen im »Zeitalter der Extreme« durch das Prisma der russischen Emigrantengemeinde der Zwischenkriegszeit – ein bis heute faszinierendes Kapitel.
Das russische Berlin: Nach der Revolution in Russland flohen viele Menschen in den Westen, viele Tausend davon nach Berlin, wo eine große russische Gemeinde entstand. Im Volksmund kursierte dafür der Begriff »Charlottengrad«. Hier lebten auch zahlreiche Künstler und Schriftsteller, darunter Andrei Bely, Vera Lourié, Vladimir Nabokov und Boris Pasternak.
Mein Buch »Moskau lesen« hat in gewisser Weise Schule gemacht in der Stadtgeschichtsschreibung, und »Terror und Traum. Moskau 1937« ist in fast ein Dutzend Sprachen übersetzt. Nichts davon ist zurückzunehmen.
Aber das Entscheidende ist, dass es uns heute nicht mehr hilft, dass es nicht mehr ausreicht, um die Verhältnisse, wie sie sich jetzt anbahnen, zu erklären und auf die intensiven, auch tragischen Kapitel deutsch-russischer Beziehungen zu verweisen. Beschwörungen dieser Vergangenheit, und sei sie noch so glanzvoll, helfen nicht weiter. Manchmal denke ich sogar, es wäre ein Vorteil, wenn die neue Generation von all dem nichts wüsste, wenn sie alles vergessen und ganz von vorne beginnen könnte. Das geht natürlich nicht. In Deutschland wird ja immer wieder der Gemeinplatz zitiert: »Keine Zukunft ohne Vergangenheit« oder »Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten«. Man könnte aber auch sagen: Um frei für die Bewältigung der Gegenwart zu werden, muss man sich von der Last der Geschichte emanzipieren. Es gibt also womöglich ein Privileg des Vergessens, ein Recht auf Amnesie, wie es der Althistoriker Christian Meier überzeugend am Beispiel der griechischen Antike gezeigt hat, um neu anfangen zu können, um die aktuellen Verhältnisse noch einmal neu zu denken – weg von den Analogien, hin zur Analyse der jeweils konkreten Situation. Doch dazu sind wir gar nicht gerüstet, weder unsere Ökonomen noch unsere Soziologen, nicht unsere Politiker und auch wir Historiker nicht, mich eingeschlossen. Wir bewegen uns eher in Analogieschleifen und schätzen Geistesgegenwart geringer als Geschichtsbewusstsein. Ich hatte einfach nicht für möglich gehalten, dass etwas Derartiges wie in der Ukraine geschehen könnte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine so kecke, dreiste und handstreichartige Aktion – ich will nicht sagen »dämonische«, weil es natürlich um eine konkrete Person geht – möglich war und dass ein einzelner Mensch in einem bestimmten Augenblick eine ausschlaggebende Rolle spielen könnte. Wir sind ja alle Sozialhistoriker geworden, wir haben ja alle gelernt, dass es – nach Hegel und Marx – die anonymen sozialen Triebkräfte sind, nicht »Haupt- und Staatsaktionen« oder einzelne Individuen, die die Geschichte bewegen. Als soziologisch aufgeklärter Historiker rechnete auch ich mit den Massen- und Schwerkraftverhältnissen insgesamt, und da traute ich Russland als Land zu, einem solchen Handstreich und einer solchen Demagogie zu widerstehen.
Wir haben schon über die Bedeutung von geschichtlichen Akteuren, auch von persönlichen Beziehungen zwischen ihnen, gesprochen. Natürlich spielen persönliche Beziehungen eine Rolle. Diplomatie hat nicht nur etwas mit Verträgen, Prozeduren und Formalitäten zu tun, sondern damit, ob die »Chemie« zwischen den Akteuren stimmt oder nicht. Das gilt für den Wiener Kongress, für zahlreiche Friedensschlüsse und stimmt heute natürlich auch. Das bestreite ich nicht. Aber es nur an diesen Personen festzumachen, da sträubt sich alles in mir. Dass Helmut Kohl mit seiner Strickjacke sich so wunderbar mit Gorbatschow verstanden hat, war ein Glücksfall und hatte etwas mit der Erfahrung dieser vom Krieg traumatisierten Generation zu tun. Hinzu kam sicher auch, was wir heute als ein window of opportunity bezeichnen. Ich kann auch nachvollziehen, dass Gerhard Schröder Wladimir Putin als seinen Freund schätzt, ja liebt. Aber von ihrem Verhältnis und ihren Biografien her allein die Beziehungen zwischen unseren Gesellschaften abhängig zu machen, das widerstrebt mir zutiefst. Und wenn jetzt behauptet wird, dass der Dialog abgebrochen ist, dann ist das einfach falsch. Wir unterhalten uns weiter. Wir begegnen uns weiter. Wer immer sich etwas zu sagen hat in Russland und Deutschland, kann sich treffen, sich austauschen, man braucht dazu keine staatlichen Zeremonien, keine großartigen und aufwendigen Haupt- und Staatsaktionen wie den »Petersburger Dialog«, die mehr mit Symbolpolitik als mit wirklichem Gedankenaustausch zu tun haben. Das Gespräch zwischen den Leuten in Russland und Deutschland, die sich etwas zu sagen haben, gab es vor dem Petersburger Dialog und wird es auch nach ihm geben. Es braucht dazu keine Organisatoren, die daraus ihren Lebensjob machen und ihr Selbstwertgefühl beziehen.
Der Petersburger Dialog ist ein deutsch-russisches Gesprächsforum, das 2001 vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ins Leben gerufen wurde. Ziel war es, den Dialog der Zivilgesellschaften beider Länder zu fördern. Hauptveranstaltung des Petersburger Dialogs ist die Jahrestagung, die üblicherweise abwechselnd in Deutschland und Russland stattfindet. Mit der Verschärfung der Ukrainekrise und dem Ausbruch des bewaffneten Konflikts in der Ostukraine wurde in Deutschland Kritik am Petersburger Dialog laut; der zentrale Vorwurf lautete, der Petersburger Dialog sei kein unabhängiges Gesprächsforum mehr, weil Kritiker der russischen Regierung dort nicht mehr zu Wort kämen. Als Folge der Kritik und weiterer Auseinandersetzungen wurde die für 2014 in Sotschi geplante zentrale Tagung des Petersburger Dialogs zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Stattdessen fanden 2014 kleinere Arbeitsgruppensitzungen statt.
Leute wie mich, die ihr Leben lang in Russland unterwegs waren und darin sehr viel investiert haben, gibt es zu Tausenden: Unternehmer, die sich im Land auskennen, »Menschen guten Willens« von Aktion Sühnezeichen, die sich seit Jahrzehnten um die Opfer des Hitler-Krieges in Russland kümmern, ehemalige Austauschstudenten, Hochschullehrer, die Beziehungen zwischen den Universitäten zur Routine haben werden lassen, Musikvereine, Museumsleute, Galeristen, junge Leute, die etwas erleben wollen – ein unendlich großes Feld von Leuten, die eigentlich nur in Ruhe gelassen werden wollen und nicht an irgendwelchen Shows interessiert sind.
Jeder tut, was er kann. Ich bin kein Politiker, ich kann nichts entscheiden, ich kann beschreiben und interpretieren, was ich wahrnehme. Ich kann verdolmetschen, so...
Inhaltsverzeichnis
- Ein Gespräch in Zeiten der Sprachlosigkeit
- Biografische Prägungen
- Die Faszination des Anderen
- Zeitenwende
- Anhang