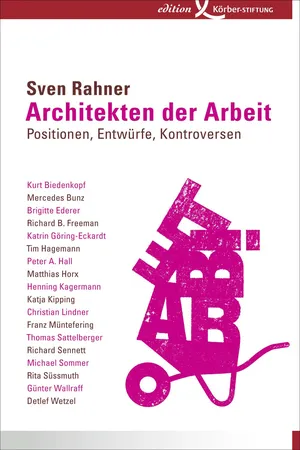
- 312 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Die Frage, wie wir in Zukunft arbeiten werden, beschäftigt wohl jeden, der Arbeit nicht nur als Broterwerb begreift. Arbeit dient längst nicht mehr nur dem Lebensunterhalt, sie ist auch Teil der eigenen Identität. Arbeit soll sich wieder lohnen, Erfüllung bieten und den eigenen Wohlstand ebenso wie den des Landes mehren - ein hoher Anspruch, allzu selten eingelöst. Prekäre und entwürdigende Arbeitsverhältnisse sind auch in Deutschland keine Seltenheit. Das digitale Zeitalter verändert die Arbeitswelt radikal, schafft neue Freiheiten ebenso wie neue Zwänge: Burnout ist auch die Krankheit einer Gesellschaft, in der immer alles möglich sein muss.
Sven Rahner wagt mit 18 Gesprächspartnern einen Blick in die Zukunft der Arbeit. Er hat die Architekten einer neuen Arbeitswelt getroffen, die beobachten, planen und gestalten, wie sich unsere Arbeit verändern wird: Vordenker aus dem In- und Ausland - wie Richard Sennett, Mercedes Bunz und Matthias Horx -, Praktiker - wie Thomas Sattelberger, Henning Kagermann und Detlef Wetzel - sowie Spitzenpolitiker aller Parteien stellen ihre Entwürfe der neuen Arbeitswelt vor. Der Wettbewerb um die besten Ideen ist eröffnet!
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Architekten der Arbeit von Sven Rahner,Ralf Nietmann im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politics & International Relations & Workplace Culture. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thomas Sattelberger:
Über die Demokratisierung der Arbeitswelt
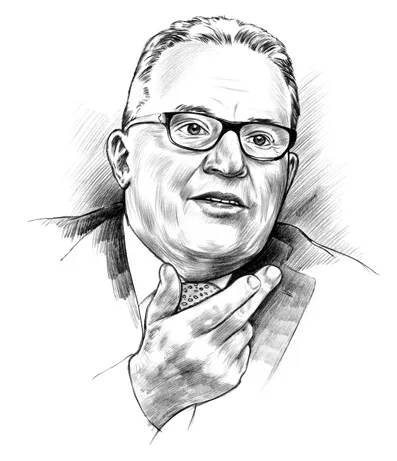
Die Zukunft der Arbeit liegt ihm am Herzen. Dafür, dass die Arbeitswelt vielfältiger und weiblicher wird, hat Thomas Sattelberger schon einiges getan. Nahezu im Alleingang trieb er als Telekom-Personalchef die Gleichstellung von Frauen in deutschen Unternehmen voran und löste Anfang 2010 mit der Einführung der ersten Frauenquote für Führungsposten in einem DAX-Unternehmen eine bundesweite Diskussion aus. Seit seinem Ausscheiden aus dem Telekom-Vorstand im Jahr 2012 ist der wohl bekannteste deutsche Personalexperte in politischer Mission unterwegs. Jetzt will er die arbeitsmarktpolitische Transformation mitgestalten. Und er tut dies, wie er es immer getan hat: mit vollem Einsatz. Auch auf die Gefahr hin, Gegenwind zu provozieren. Als Sprecher und Themenbotschafter für Personalführung der »Initiative Neue Qualität der Arbeit« (INQA) setzt er sich für eine moderne Arbeitskultur und Personalpolitik ein. In seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der BDA/BDI-Initiative »MINT Zukunft schaffen« gilt sein Engagement dem Fachkräftenachwuchs in technischen und naturwissenschaftlichen Fächern.
Thomas Sattelberger wurde 1949 im schwäbischen Munderkingen geboren. Er war bis Mai 2012 Personalvorstand und Arbeitsdirektor der Deutschen Telekom AG. Der doppelte Studienabbrecher (Soziologie und Lehramt) und spätere Diplom-Betriebswirt war zuvor von 2003 bis 2007 Mitglied des Vorstandes der Continental AG in Hannover. In dieser Funktion verantwortete und gestaltete er die strategische Ausrichtung der konzernweiten Personalentwicklung sowie das weltweite Talentmanagement. Sein Berufseinstieg gelang ihm 1975 in der Direktion »Zentrale Bildung« von Daimler-Benz in Stuttgart. Zwischenzeitlich war Sattelberger auch als Leiter der Personalentwicklung bei der Deutschen Lufthansa AG in Frankfurt am Main tätig und gründete dort mit der Lufthansa School of Business die erste Corporate University in Deutschland. Sattelberger ist Vizepräsident der European Foundation for Management Development (EFMD) und Fellow der International Academy of Management.
Im Gespräch wirkt der Verfechter des Diversity Managements hellwach und vor Kraft strotzend. Für seine Zunft hat er eine provokante Botschaft parat: Die Frauenquote sei für ihn nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einer fundamentalen Demokratisierung der Arbeitswelt, in der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als »Unternehmensbürger« ihre Vorgesetzten auf Zeit selbst wählen können. Seine Vision für die Zukunft der Arbeit gründet sich auf ein positives Menschenbild. Dies solle sich künftig auch in einem wertschätzenden personalpolitischen Vokabular ausdrücken.
Rahner: Welche entscheidenden Trends und Entwicklungen werden Ihrer Auffassung nach die Zukunft der Arbeit im Wesentlichen bestimmen?
Sattelberger: Für mich sind es im Grunde sieben Trends, und die beeinflussen sich alle wechselseitig. Der erste große Trend ist mit Sicherheit die Demografie, die Überalterung der Gesellschaft bei stagnierender Reproduktionsrate. Der zweite ist eng damit verknüpft und betrifft die Migration und damit Steuerungsaspekte der Höhe und Qualität von Zuwanderung nach Deutschland.
Ein drittes großes Thema ist das des Wertewandels: Sämtliche Befragungen, von Allensbach bis hin zur Stiftung für Zukunftsfragen, legen nahe, dass die Menschen sich mehr Souveränität – auch an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz – wünschen. Der vierte zentrale Trend lautet Vielfalt: Die Gesellschaft und damit die Arbeitswelt wird differenzierter. Sie wird immer mehr zu einem Flickenteppich, egal, ob es um Alter, Geschlecht oder unterschiedliche ethnische Hintergründe geht.
Als Fünftes ist die Digitalisierung zu nennen. Ich habe das bei der Telekom selbst erlebt: Social Media sind nicht mehr nur kleine Add-Ons. Sie verändern die Arbeitskultur und berühren damit auch Fragen der örtlichen und zeitlichen Unabhängigkeit und Erreichbarkeit, aber auch des direkten Zugangs zu Hierarchien. Hinzu kommen Open Innovations, also die aktive Öffnung des Innovationsprozesses von Organisationen zur Außenwelt, wie wir es von Open-Source-Gemeinschaften wie z.B. Wikipedia oder der Entwicklung von quelloffener Software kennen.
Der sechste wichtige Trend hat mit dem Charakter von Innovation selbst zu tun: Deutschland ist für mich ein klassisches Land der Effizienzinnovation. Wir arbeiten im Kern immer noch auf den Grundlagen von Werner von Siemens, Robert Bosch und Carl Benz. Effizienzinnovation steht in dieser Tradition und bedeutet: mehr, schneller, höher und weiter. In anderen Ländern der Welt geht es stärker um die Frage, wie etwas grundlegend anderes entwickelt werden kann. Man ist dort also auf der Suche nach Quantensprung-Innovationen. Sie können diesen Unterschied bei der Herausbildung der modernen Biotechnologie und der Entstehung der Internetökonomie, in der Deutschland keine führende Rolle einnehmen konnte, ablesen. Dies hat letztlich zur Folge, dass viele deutsche Unternehmen und mit ihnen ganze Branchen an die Grenzen ihres Geschäftsmodells kommen.
Als letzten Punkt sehe ich, dass die Arbeitswelt der Zukunft stärker von neuen Akteuren beeinflusst wird. Während früher in erster Linie die Sozialpartner, also Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, die Arbeitswelt ausgestalteten, werden in Zukunft zivilgesellschaftliche Organisationen, z.B. Menschenrechts- und Verbraucherorganisationen, sowie Investoren und Analysten hinzukommen und ihren Einfluss geltend machen. Die Politik versucht schon heute, jedes soziale Vakuum durch regulatives Handeln zu füllen. Auch die Medien, welche die Arbeitswelt gläsern machen und dadurch Veränderungsdruck erzeugen können, spielen eine Rolle. Wir haben es also zunehmend mit einer Multiakteurs-Arbeitswelt zu tun.
Alle diese sieben Trends sind angemessen und auch in ihrer Wechselwirkung zu berücksichtigen. Nur so lässt sich die Debatte über Arbeit in Deutschland versachlichen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der außerordentlichen interessenpolitischen Fundierungen bei all den Fragen um die Zukunft der Arbeit.
Rahner: Beginnen wir bei der wohl größten Veränderung: Wie beeinflusst die demografische Entwicklung den deutschen Arbeitsmarkt bzw. die Arbeitsbedingungen für die Bevölkerung?
Sattelberger: Zunächst: Wir können in Deutschland derzeit einen Akademisierungstrend beobachten. Dies ist auch folgerichtig, denn auf der Suche nach Quantensprung-Innovationen werden kognitive Kompetenzen wie Analyse-, Abstraktions- und Verknüpfungsfähigkeit an Bedeutung gewinnen. Das bedeutet, der akademische Bereich der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes wird wachsen. Der zweite Punkt ist, dass die deutsche Wirtschaft eine stark industriell geprägte Kernstruktur aufweist. Es gibt eine Faustregel, die besagt, zwei Facharbeiter auf einen Ingenieur, d.h., in dieser Welt wächst die Bedeutung nicht nur der akademischen, sondern auch der Facharbeit und damit der dualen Berufsausbildung und der anschließenden Qualifikation z.B. zum klassischen Techniker oder Meister.
In Bezug auf hoch qualifizierte Akademiker habe ich, was den für die kommenden zwei Dekaden zu erwartenden Fachkräfteengpass angeht, nur bedingt Sorge. Durch den zwischenzeitlich großen Anstieg an Akademikern scheint mir die verbleibende derzeitig diskutierte Fachkräftelücke im akademischen Bereich mittelfristig über qualifizierte Zuwanderung beherrschbar zu sein.
Das größere Problem liegt in der Facharbeit, und zwar insbesondere in der technischen und in der Pflege. Der deutsche Arbeitsmarkt wird jedes Jahr, und zwar schon seit vielen Jahren, mit bis zu 150.000 jungen Menschen gefüttert, die ohne Ausbildung sind. Sie können davon ausgehen, dass in jeder Generation Erwerbstätiger irgendwo zwischen 1,3 und 1,6 Millionen nicht ausgebildete Menschen arbeiten, das sind in vier Erwerbsgenerationen ca. 6,5 Millionen Menschen ohne Berufsausbildung. Hinzu kommt, dass Sie bei der Facharbeit mit Zuwanderungsstrategien alleine nicht besonders weit kommen. Ungefähr die Hälfte der Zuwanderer, die nach Deutschland kommen, haben heutzutage akademische Abschlüsse, und zum anderen kehren viele Migranten nach einigen Jahren in ihre Heimat zurück bzw. migrieren in einwanderungsfreundliche Länder. Ich sehe daher die größte Chance darin, die Bildungspotenziale unter den jungen Menschen zu heben. Dies zielt auf die Warteschleifen an den Bildungsübergängen, z.B. von der Schule in die Ausbildung, und betrifft Fragen der Nachqualifizierung der 20- bis 29-Jährigen sowie der älteren Generationen und ganz klar natürlich auch die Frauenbeschäftigung.
Letzteres ist insofern eng verknüpft mit der zentralen Frage, ob es die Wirtschaft schafft, Arbeitskulturen zu etablieren, in denen die unterschiedlichen Lebenssphären mit der Arbeit in Balance gebracht werden können. Dazu gehören natürlich sowohl finanzierbare Auszeitmodelle, die individualisierte Rückkehrmodelle für Frauen wie Männer nach Erziehungs- und Pflegezeiten als auch entsprechende Karrieremodelle beinhalten. Das Potenzial nicht ausgebildeter, häufig prekär beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer muss voll ausgeschöpft werden. Denkbar wäre für mich hier durchaus ein zyklisches Modell, in dem die immer jeweils untere Stufe in die nächste Stufe hinaufgehoben wird, um sozialen Aufstieg zu gewährleisten. Wenngleich ich mir der Beharrungskräfte in dieser Republik ohne Zweifel bewusst bin: egal, ob es die Verteidigung der nicht modularen Form dualer Berufsausbildung, die Barrieren für Berufstätige beim Hochschulzugang oder die Öffnung der Hochschulen für Diversity sind.
Sie können natürlich auch alternative Szenarien aufmachen. Dann würden deutsche Firmen wegen Talentmangel im Bereich technischer Facharbeit ins Ausland gehen, also eine talentgetriebene Offshore-Welle in Gang setzen. Ein mögliches Alternativszenario wäre auch, dass infolge der immer größer werdenden Kluft zwischen den Karriere- und Flexibilisierungswünschen der Frauen und den Angeboten aus der Wirtschaft verstärkt weiter Auswanderung in die Schweiz oder Skandinavien einsetzt – ein »Braindrain«, der eine sich schließende Arbeitswelt nach sich ziehen würde. Wenn wir nicht entschlossen die Arbeitswelt familienfreundlicher gestalten, halte ich das noch nicht einmal für unrealistische Szenarien.
Rahner: Welche Fähigkeiten und Qualifikationen werden in der von Ihnen eingangs skizzierten Arbeitswelt von morgen wichtiger, und welche treten stärker in den Hintergrund?
Sattelberger: Ich bin jemand, der praktische Erfahrung und empirische Forschung versucht zusammenzubringen und da, wo beide nicht zusammenpassen, eigentlich extrem unruhig wird. Wir müssen in vielen Punkten deutlich schneller dazulernen und eine weniger passive oder gar Opferrolle im Rahmen des Veränderungsmanagements einnehmen. Das ist weniger eine Frage des Wissens als eine des Wollens und Dürfens.
Es ist empirisch beobachtbar, dass das Verlassen eingeschliffener Denkbahnen für die Gestaltung der Arbeit der Zukunft von ganz herausragender Bedeutung sein wird. Implizit darin enthalten ist der Abschied von traditionellen Geschlechterstereotypen oder auch Arbeitszeitritualen. Dazu gehört zudem eine gute Portion geistige Mobilität, die sich z.B. darin ausdrückt, dass ich auf neuartige Problemlösungsmuster zugreifen kann. Das setzt natürlich eine gute Analysefähigkeit voraus. Hinzu kommt die Fähigkeit, auf Grundlage des impliziten Wissens und der Intuition eine Frühwarnsensorik für Veränderungen »draußen« entwickeln zu können.
Darüber hinaus wird der Bereich der Kreation in einer von technologischen, sozialen und marktbezogenen Umbrüchen gekennzeichneten Arbeitswelt einen Bedeutungsgewinn erfahren. Die Start-up-Forschung bietet hier Anschauungsmaterial: Innovationssprünge und Erfindungen setzen häufig einen individuellen wie organisationalen Lernprozess voraus, der Versuchs- und Irrtumsschleifen beinhaltet: »develop, try, fail, re-try«. Das sind zum Teil viele kurze Zyklen eines längeren Entwicklungsprozesses. In den Großkonzernen, in denen ich bisher gearbeitet habe, wurde hingegen immer in großen perfekten Schleifen gedacht, und erst zum Schluss stand eine abschließende Bewertung.
Auch die Vernetzungsfähigkeit wird wichtiger werden, weil Problemlösungen nur noch ganz selten aus einem Feld kommen. Die weiterführenden Überlegungen, die hier anzustellen sind, betreffen Fragen wie z.B. »Wie sind die Firmen der Zukunft überhaupt strukturiert?«, »Taugen die fordistischen oder postfordistischen Modelle noch?«, »Wie horizontal muss ein Unternehmen vor dem Hintergrund der Vernetzungserfordernisse organisiert sein?«. Ich habe hier zwar mehr Fragen als Antworten, bin aber davon überzeugt, dass die neuen Organisationsmodelle, die sich aus deren Beantwortung ergeben werden, massive Konsequenzen für den Einzelnen und seine Gestaltungs- und Vernetzungsperspektiven haben werden. Das alles geschieht vor dem Hintergrund, dass wir stärker mit Strategien der Open Innovation arbeiten werden, weil geschlossene Systeme kaum noch in der Lage sind, die notwendigen Erneuerungsprozesse anzustoßen. Wenn Sie jetzt noch in Betracht ziehen, dass die Studien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) seit Jahren darauf verweisen, dass die Anteile kognitiver und sozialer Komplexität in der Arbeit weiter anwachsen werden, wird offenkundig, dass wir in Deutschland die Schulbildung, die Berufsausbildung sowie die Hochschulbildung von Grund auf reformieren müssen, nicht in den Makrostrukturen, sondern im Binnenleben.
Rahner: Was können Unternehmen tun, um in der von Ihnen beschriebenen volatiler werdenden Arbeitswelt neue Talente zu gewinnen und eine größere Chancengerechtigkeit zu gewährleisten?
Sattelberger: Ich halte eine nachhaltige und vorausschauende Personalplanung für ein absolutes Schlüsselthema. Ich muss also in einem Unternehmen in einem ersten Schritt verschiedene Szenarien der Geschäftsentwicklung durchspielen, um dann im nächsten Schritt zu schauen, welche Bandbreite an Beschäftigungskapazitäten ich für die weitere Unternehmensentwicklung quantitativ, aber vor allem auch qualitativ, d.h. skill- und demografiebedingt, benötige.
Wenn Sie die deutschen Unternehmen betrachten, werden Sie ein verheerendes Bild vorfinden. Qualitative Personalplanung – ich spreche hier immer von der »Mutter aller Schlachten« – wird vielfach nur rudimentär betrieben. Dies betrifft Konzerne, insbesondere aber auch den Mittelstand, der im Verdrängungskampf um Talente mit den großen Konzernen ohnehin häufig das Nachsehen hat. Viele Unternehmen leben in Bezug auf die Fachkräfteausbildung und -gewinnung mangels organisierter Planung daher von der »Hand in den Mund«.
Notwendig wäre bei der Personalplanung im Mittelstand ein anderes Vorgehen: Zunächst gilt es, die beispielsweise 20 bis 25 neuralgischen Positionen oder schwer besetzbaren Know-how-Träger im Unternehmen, von denen die Weiterentwicklung des Unternehmens abhängt, zu identifizieren. Von da aus lässt sich eine vorausschauende Nachfolgebetrachtung für Schlüsselpersonen entwickeln: Man kann sich im zweiten Schritt dann auch sehr genau die Zusammensetzung der Teams anschauen und beispielsweise ermitteln, wie viele Frauen in technischen Bereichen tätig sind oder wie viele Talente mit Migrationshintergrund rekrutiert werden oder über die duale Berufsausbildung nachwachsen. Es lässt sich dann auch feststellen, ob ich für mein Unternehmen Angebote für möglicherweise versteckte Talentquellen entwickeln muss, ob ich Beschäftigungspotenziale unter alleinerziehenden Frauen heben kann, indem ich etwa Teilzeitberufsausbildungen ermögliche oder die Chancen von Telearbeit nutze.
Der nächste Punkt ist, ob ich als Firma in einer Region ansässig bin, die für Zuzügler wenig attraktiv ist und mit anderen Mittelständlern zusammen darum ringt, Talente anzuziehen. Diese Anziehungskräfte hängen auch davon ab, welche Bildungsinfrastruktur es in der Region gibt, welche Gesundheits-, welche Unterhaltungsinfrastruktur etc. Manche Regionen wie z.B. Oldenburg konnten so bereits einen bemerkenswerten Talentmagnetismus entfalten. Insofern ist für die Fachkräftesicherung in Deutschland mittel- bis langfristig auch eine Regionalanalyse und -entwicklung entscheidend. Dazu gehört auch eine ehrliche und eben auch systematisch abgeleitete Antwort auf die Frage, wie viele Ingenieure von der Technischen Universität München glaube ich, z.B. nach Ostwestfalen-Lippe locken zu können.
Rahner: Mit der qualitativen Personalplanung in Unternehmen sprechen Sie auch die Frage nach der Vielfalt der Belegschaften und der Besetzung von Führungspositionen an. Die G...
Inhaltsverzeichnis
- Die Arbeit der Zukunft braucht uns alle! Von Sven Rahner
- Arbeit in Deutschland, Europa und der Welt
- Megatrends, Arbeitsglück und die stille Revolution
- Innenansichten und praktische Perspektiven
- Politische Reflexion und Gestaltung
- Anhang