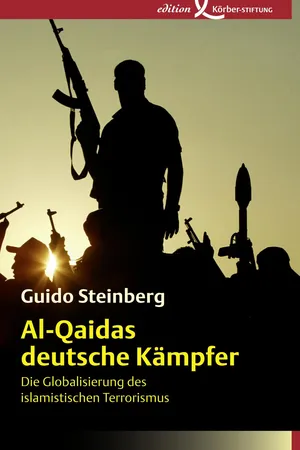
eBook - ePub
Al-Qaidas deutsche Kämpfer
Die Globalisierung des islamistischen Terrorismus
- 464 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Die Dschihadisten-Szene in Deutschland gilt als die dynamischste Europas. Nirgendwo sonst in der westlichen Welt ist die Zahl der Rekruten für al-Qaida und andere Terrororganisationen ähnlich schnell gewachsen wie hier. Deutsche Glaubenskrieger aus Berlin, Hamburg und Bonn - Konvertiten ebenso wie Immigranten - reisen in Länder wie Pakistan, Tschetschenien und Somalia, werden dort militärisch ausgebildet und im terroristischen Kampf eingesetzt. Mittlerweile verfügen viele von ihnen über Kampferfahrung, erworben etwa in Afghanistan und seit einigen Jahren auch in Syrien.
Guido Steinbergs umfassende, niemals alarmistische politische Analyse zeichnet die Radikalisierung dieser Kämpfer für Gott und al-Qaida nach und ordnet das Phänomen in die internationale Entwicklung des islamistischen Terrorismus ein. Um die drohende Terrorgefahr in den nächsten Jahren auch hierzulande abzuwehren, fehlen Deutschland bis heute starke und wirksame Sicherheitsmaßnahmen. Eindringlich warnt der Terrorismusexperte daher vor einer Entwicklung, die aus Deutschland kommend auch wieder dorthin zurückkehren kann.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Al-Qaidas deutsche Kämpfer von Guido Steinberg im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politik & Internationale Beziehungen & Terrorismus. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1. Unerwarteter Internationalismus.
Die Deutschen in der dschihadistischen Bewegung
Im März 2010 endete der bis dahin aufsehenerregendste Prozess gegen islamistische Terroristen in Deutschland mit Haftstrafen zwischen fünf und zwölf Jahren für die vier Angeklagten. Die Gruppe unter Führung des deutschen Islamkonvertiten Fritz Gelowicz war im September 2007 beim Bombenbasteln überrascht und verhaftet worden. Die Sauerland-Zelle, wie sie in den deutschen Medien hieß, hatte Anschläge auf Diskotheken geplant, in denen amerikanische Militärangehörige verkehrten, möglicherweise auch einen Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Ramstein, die größte militärische Einrichtung der US-Streitkräfte in Deutschland. Zwar führte Arid Uka den bis 2011 einzigen erfolgreichen dschihadistischen Anschlag in Deutschland durch, aber das Sauerland-Komplott war der potenziell gefährlichste terroristische Plan, der seit den Tagen der am 11. September beteiligten Hamburger Zelle auf deutschem Boden ausgeheckt worden war.
Für Gelowicz und seine Freunde Adem Yilmaz, Daniel Schneider und Atilla Selek war es ein weiter Weg von ihrem Leben in deutschen Provinzstädten zu einer Karriere als bekannteste Terrorverdächtige der jüngsten deutschen Geschichte. Zwischen 2004 und 2007 unternahmen die Verschwörer ausgedehnte Reisen, die sie zunächst in die Türkei führten, das logistische Drehkreuz der Dschihadisten und Durchgangsstation zwischen Europa, dem Nahen Osten und Südasien. Anschließend ging es weiter zu Arabisch-Sprachschulen in Syrien und Ägypten und dann in den Iran, von wo aus sie schließlich in die pakistanischen Stammesgebiete geschleust wurden – das Epizentrum des internationalen islamistischen Terrorismus, seitdem sich al-Qaida und ihre Verbündeten aus Afghanistan über die Grenze nach Pakistan zurückgezogen hatten.
Das Komplott nahm kurz nach dem 11. September 2001 im schwäbischen Ulm und dem benachbarten Neu-Ulm seinen Anfang. Der spätere Kopf der Sauerland-Gruppe Fritz Gelowicz und sein Freund Atilla Selek gehörten zu einem kleinen Netzwerk junger Deutscher, Türken und Araber, die im Multikulturhaus in Neu-Ulm, einem Zentrum der Salafisten, radikalisiert worden waren. Die zentrale Gestalt der Ulmer Szene war ein ägyptischer Imam, der seit Anfang der 1990er Jahre in islamistischen Kreisen Deutschlands zum Begriff geworden war und bekanntermaßen gute Kontakte zu Dschihadisten in aller Welt pflegte. In die Fußstapfen von Freunden tretend, die bereits im April 2002 aus Ulm und Neu-Ulm in den Kaukasus aufgebrochen waren, suchte Gelowicz 2004 nach Möglichkeiten, sich den Rebellen in Tschetschenien anzuschließen. Als er von Kontaktleuten in Istanbul hörte, eine Fahrt nach Tschetschenien sei nicht machbar, pilgerten er und seine Freunde im Januar 2005 zunächst nach Mekka und reisten von dort weiter nach Syrien und Ägypten, um Arabisch zu lernen und die Möglichkeit auszuloten, sich den Aufständischen im Irak anzuschließen.
Nach den späteren Geständnissen der vier jungen Männer traten in der syrischen Hauptstadt Damaskus einige Dschihadisten aus Aserbaidschan an Gelowicz und Yilmaz heran und erboten sich, sie mit nach Tschetschenien zu nehmen. Ihre neuen Freunde wiesen sie jedoch darauf hin, dass, wenn sie sich den tschetschenischen Rebellen anschließen wollten, sie zunächst ein militärisches Training absolvieren müssten. Zu diesem Zweck schickten die Aserbaidschaner sie nach Pakistan, wo sie im Camp einer kleinen usbekischen Organisation, der Islamischen Dschihad-Union (IJU), ausgebildet werden sollten. Im April 2006 traten die vier Freiwilligen ihre Reise über die Türkei und den Iran nach Pakistan an. In den Stammesgebieten Nord-Waziristans nahe der afghanischen Grenze schlossen sie sich der IJU an. Doch schon bald schickte die Führung der Organisation die jungen Männer mit dem Auftrag nach Deutschland zurück, Anschläge auf amerikanische Ziele zu verüben.
Ihre Reiseroute und ihre Kontakte wiesen das Sauerland-Quartett als echte Internationalisten aus, auch wenn die beiden deutschen Konvertiten und die beiden ethnischen Türken offenbar schlecht gerüstet waren für die Reise von Deutschland in den Nahen Osten und dann nach Südasien, wo sie sich einer zentralasiatischen Organisation anschlossen. Keiner der jungen Männer sprach Englisch oder eine andere Fremdsprache außer Türkisch, ihre Schulbildung ließ zu wünschen übrig, und vor 2005 beschränkte sich ihre internationale Erfahrung auf kurze Aufenthalte in der Türkei. Weder ihre Erziehung noch ihre Ausbildung prädestinierte sie für den Weg, der vor ihnen lag, sondern das salafistische Milieu, in das sie eintauchten, eine zunehmend internationalistische Dschihadisten-Ideologie, die sie sich aneigneten, und die Bereitschaft militanter Netzwerke, die deutsch-türkischen Neulinge aufzunehmen. All diese Faktoren ermöglichten es den Mitgliedern dieser kleinen Gruppe, um die halbe Welt zu reisen, um sich den Dschihadisten anzuschließen, und den vielleicht gefährlichsten terroristischen Anschlagsplan der deutschen Geschichte vorzubereiten.
Ein nicht ganz so globaler »Dschihad«
Die zentrale These dieses Buches lautet, dass die internationalistische Szene und Ideologie, die wir heute beobachten, sich erst nach dem 11. September 2001 entwickelte und dass die dschihadistische Bewegung seither einen Prozess der Internationalisierung vollzogen hat, der ihren Charakter maßgeblich veränderte. Während es 2001 so etwas wie einen »globalen Dschihad« noch gar nicht gab, besitzt dieser Begriff 2014 durchaus seine Berechtigung. Diese Feststellung mag all jene überraschen, die sich daran gewöhnt haben, dass Politiker, Wissenschaftler und Journalisten al-Qaida schon seit den Anschlägen auf die New Yorker Zwillingstürme 2001 als globales Phänomen bezeichnen. Tatsache aber ist, dass es zwei verschiedene Ansätze gibt, die Beweggründe von al-Qaida und ihrer Führung zu erklären.
Die erste, globalistische Denkrichtung betrachtete al-Qaida in erster Linie als antiwestliche und antiamerikanische Kraft, die im Spätsommer 2001 ihre Ausrichtung auf die Heimatländer ihrer Anführer und Mitglieder im arabischen Nahen Osten aufgegeben hatte. Bei den Befürwortern dieses Ansatzes und in einer breiteren Öffentlichkeit bürgerten sich Begriffe und Vorstellungen wie globaler Dschihad, transnationaler oder neuer Terrorismus und später radikaler Islam ein. Unter dem Eindruck der Ereignisse vom 11. September 2001 unterstrichen jene, die zuvor keine Beziehung zum Nahen Osten und keine Kenntnisse dieser Region gehabt hatten, al-Qaida habe bei ihrem Angriff auf die Vereinigten Staaten eher globale als regionale Absichten verfolgt. Einige Anhänger dieser Richtung interpretierten die Ereignisse kulturalistisch und sahen darin den Beleg für einen Kulturkonflikt zwischen der muslimischen und der westlichen Welt. Andere betonten den nihilistischen Charakter al-Qaidas und begründeten diese Ansicht unter anderem mit der Absurdität des Versuchs, die einzig verbliebene Supermacht und ihre zahlreichen Verbündeten in aller Welt zu besiegen. Nach diesem Ansatz verfolgte al-Qaida keine konkreten politischen Ziele, sondern betrachtete die terroristische Gewalt als Selbstzweck.14
Jenen Beobachtern, die sich für al-Qaida auf der Basis vorheriger Kenntnisse über den Nahen Osten interessierten, lieferte die erste Denkrichtung keine überzeugenden Erklärungen. Für diesen zweiten, regionalistischen Ansatz schien es auf der Hand zu liegen, dass die Dschihadisten-Bewegung nur eine Splittergruppe in einem weitaus größeren Bürgerkrieg innerhalb arabischer und muslimischer Länder war und dass die Angriffe auf westliche Ziele einen Nebeneffekt und eine Reaktion auf die Nah- und Mittelostpolitik Amerikas und des Westens darstellten. Einige Experten konzentrierten sich auf den israelisch-palästinensischen Konflikt als wichtigstem Motivationsfaktor, andere Anhänger dieser Richtung betonten hingegen, dass die al-Qaida-Führung mehrheitlich aus Ägypten und Saudi-Arabien stammte und die eigentlichen Ursachen des 11. September in diesen Ländern zu finden seien. Die Wurzel der Entscheidung al-Qaidas, in ihren Herkunftsländern und im Ausland Terrorangriffe durchzuführen, liege in der westlichen Unterstützung repressiver Regierungen in der arabischen Welt. Für Verfechter dieser Theorie war es offensichtlich, dass al-Qaida die Vereinigten Staaten angegriffen hatte, um sie zum Rückzug aus dem Nahen Osten zu zwingen, vor allem aus Saudi-Arabien und Ägypten. Die Botschaft der Drahtzieher des 11. September lautete: »Zieht eure Truppen aus Saudi-Arabien ab und hört auf, Ägypten finanziell und militärisch zu unterstützen; andernfalls werden wir euch in den Vereinigten Staaten und anderswo immer wieder angreifen.« Dieser Interpretation zufolge waren die dschihadistische Bewegung im Allgemeinen und al-Qaida im Besonderen fest in ihren Heimatländern verwurzelt, und jeder, der die tragischen Ereignisse in New York und Washington verstehen wollte, musste sich das heimische Umfeld von al-Qaida und den Nahen Osten insgesamt genauer anschauen.15
2001 waren die Vertreter der regionalistischen Denkrichtung weit näher an der Wahrheit als die Globalisten. Trotz der Beliebtheit von Globalisierungstheorien blieben die Anhänger der Dschihadisten-Bewegung im Allgemeinen und von al-Qaida im Besonderen in der politischen Kultur ihrer Länder fest verankert. Deutlich wird dies, wenn man sich die Mitgliederstruktur von al-Qaida ansieht, kurz bevor die Organisation ihren sicheren Unterschlupf in Afghanistan einbüßte. Al-Qaida war zuallererst eine multinationale, keine multiethnische Organisation. Mit wenigen Ausnahmen gehörten ihr Araber unterschiedlicher Nationalität an. Die bekannteste Ausnahme bildete Khalid Scheich Mohammed (von Sicherheitsexperten mit dem Kürzel KSM bedacht), der Chefplaner der Anschläge vom 11. September. Er wurde 1964 in Kuwait geboren, und obwohl sein Vater aus der pakistanischen Provinz Belutschistan stammte, war Scheich Mohammed in die kuwaitische Gesellschaft gut integriert und sein frühes Denken zutiefst geprägt von der in dem kleinen Emirat vorherrschenden Form des Islamismus, er kann also soziologisch durchaus als Kuwaiter gelten.16
Zur Zeit der Anschläge vom 11. September 2001 war al-Qaida eine ausschließlich arabische Organisation, der neben Ägyptern und Saudi-Arabern auch einige Kuwaiter und Jemeniten angehörten. Ihre Gefolgschaft waren Araber aus den Staaten der Arabischen Halbinsel, vor allem saudi-arabische Staatsbürger wie Osama bin Laden, Jemeniten aus der Heimat von bin Ladens Vorfahren und Kuwaiter. All diese Nationalitäten waren durch religiöse, ideologische, kulturelle und sogar Stammes- und Familienbande verbunden, was bei der Gründung einer Kerngruppe mit relativ engem Zusammenhalt hilfreich war. Diese saudi-arabisch-jemenitisch-kuwaitische Gruppe war seit den frühen 1990er Jahren zur dynamischsten Kraft im internationalen Terrorismus geworden. Unter den verschiedenen al-Qaida-nahen Gruppierungen war sie am stärksten internationalistisch, weil ihre Radikalisierung auf den Golfkrieg in Kuwait 1991 und die Proteste gegen die amerikanische Präsenz auf saudi-arabischem und kuwaitischem Territorium zurückging. Die saudi-arabische Landsmannschaft innerhalb von al-Qaida war der militante Flügel einer islamistischen Oppositionsbewegung, die entstand, nachdem das Königreich im August 1990 die Vereinigten Staaten gebeten hatte, in seinem Land Truppen zu stationieren, um es vor einer drohenden irakischen Invasion zu schützen. Infolgedessen war Antiamerikanismus ein herausragendes Motiv für die Dschihadisten von der Arabischen Halbinsel.17
Mitte der 1990er Jahre gingen bin Laden und seine Anhänger eine Allianz mit einer ägyptischen Gruppierung unter Führung von Aiman az-Zawahiri ein, der Nummer zwei in der al-Qaida-Hierarchie und ab 2011 bin Ladens Nachfolger. Zuvor waren Zawahiri und seine Anhänger von der ägyptischen Dschihad-Organisation (Tanzim al-Jihad) stärker nationalistisch eingestellt gewesen als ihre Brüder von der Arabischen Halbinsel.18 Seit den frühen 1980er Jahren bestand ihr einziges Ziel darin, das Regime des ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak zu stürzen, und ihre sämtlichen Aktivitäten in Afghanistan und im Sudan waren darauf ausgerichtet. Dies änderte sich, als sie Mitte der 1990er Jahre erkannten, dass in ihrer Heimat der islamistische Aufstand von 1992 gescheitert war. Aiman az-Zawahiri kam zu dem Schluss, zur Fortsetzung des bewaffneten Kampfes sei ein Strategiewechsel notwendig. Daher beschloss er, den »fernen Feind« (die Vereinigten Staaten) anzugreifen, um den »nahen Feind« (das Mubarak-Regime) zu schwächen.19
Das Bündnis zwischen Zawahiri und bin Laden, zwischen den Ägyptern und den Saudi-Arabern, bildete die ideologische und strategische Basis der neuen Organisation. Durch Angriffe auf die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten wollten sie die Amerikaner zwingen, sich aus der arabischen und muslimischen Welt zurückzuziehen. Nach Erreichen dieses Ziels wollten sie die Regierungen in ihren Heimatländern und den Heimatländern ihrer Anhänger stürzen. Es war also keine rein globale Strategie, sondern eine, in der lokale und globale Ziele eng verflochten waren. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass al-Qaida die Hilfe einer dritten, für die Professionalisierung ihrer Terroraktivitäten zuständigen Gruppe benötigte, um eine Organisation mit globaler Reichweite zu werden (und sei es nur für einen einzigen Anschlag auf die Vereinigten Staaten). 1996 stieß Khalid Scheich Mohammed, der mehrere Jahre Terrorerfahrung mitbrachte, zu al-Qaida in Afghanistan. Er war bereits am ersten Bombenanschlag auf das World Trade Center 1993 beteiligt gewesen, und 1994/1995 plante er, in Flugzeugen auf dem Weg von Ost- und Südostasien in die Vereinigten Staaten Bomben detonieren zu lassen. Al-Qaida schloss er sich als eine Art »Terror-Subunternehmer« an und genoss bei seinen Operationen ein hohes Maß an Unabhängigkeit. Er fügte sich in keine der nationalen Gruppen, aus denen al-Qaida damals bestand, so recht ein und ähnelte mehr dem Typus des profitorientierten Terroristen, wie ihn der bekannte Venezolaner Illich Ramírez Sánchez verkörperte. Unter dem Decknamen »Carlos, der Schakal« war Ramírez bis zu seiner Verhaftung 1994 Osama bin Ladens Vorgänger als meistgesuchter internationaler Terrorist gewesen.20 Erst als Khalid Scheich Mohammed Teile der Operationsplanung von al-Qaida übernahm, entwickelte die Organisation die Fähigkeiten, derer sie bedurfte, um die Anschläge vom 11. September 2001 auszuführen.21
Sobald diese Elemente zusammengefunden hatten, war al-Qaida in der Lage, einen stärker transnationalen Charakter zu entwickeln. Insbesondere nach den Bombenanschlägen auf die US-Botschaften in Nairobi und Daressalam im August 1998 wurden al-Qaida und seine Führungsriege weltberühmt, und aus der ganzen Welt strömten junge Rekruten nach Afghanistan, um in Osama bin Ladens antiamerikanischem »Dschihad« mitzukämpfen. Dennoch stellten die Araber weiterhin die überwältigende Mehrheit innerhalb der Organisation, und die Anführer kamen vornehmlich aus Ägypten und Saudi-Arabien. Dieses Phänomen Ende 2001 als »globalen Dschihad« zu bezeichnen, war daher irreführend. Vielmehr hatte al-Qaida die Bürgerkriege der arabischen Welt in die Vereinigten Staaten exportiert, ohne dabei die eigenen Heimatländer aus dem Blick zu verlieren. Es sollte noch mehrerer Jahre und schwerer Fehler auf Seiten der al-Qaida-Gegner bedürfen, um die Internationalisierung der Dschihadisten-Bewegung voranzutreiben.
Die Internationalisierung des dschihadistischen Terrorismus
Mehr als zehn Jahre nach dem 11. September 2001 herrscht eine ganz andere Situation. Al-Qaida und die dschihadistische Bewegung allgemein haben einen tief greifenden Prozess der »Internationalisierung« hinter sich. Nationale, regionale und ethnische Trennlinien haben ihre einstige Bedeutung verloren und einer in einem umfassenderen Sinn globalen Bewegung Platz gemacht. Die Organisation, die noch 2001 ein ausschließlich arabisches Phänomen war, zog in den darauffolgenden Jahren zunehmend Pakistaner, Afghanen, Türken, Kurden und europäische Konvertiten unterschiedlicher Nationalität in ihren Bann. In der noch 2001 von Ägyptern und Arabern aus den Golfstaaten dominierten und von anderen Arabern als rein ägyptisch-saudi-arabisches Unterfangen betrachteten Organisation gewannen jetzt Nordafrikaner, Jordanier, Palästinenser und Iraker an Einfluss, was der Bildung regionaler Filialen im Irak, in Algerien und im Jemen zu verdanken war. Der Prozess der Internationalisierung – der in den Biografien und den Reiserouten der Sauerland-Gruppe und vieler anderer deutscher Dschihadisten so deutlich abzulesen ist – begann vor dem 11. September und hat sich seither fortgesetzt. Am offenkundigsten ist dies im Hinblick auf die nationale und ethnische Basis der Dschihadisten-Bewegung, aber der Prozess besitzt überdies auch ideologische und strategische Dimensionen.
Internationalistische Ideologie und Ideologen
2001 herrschte in der Dschihadisten-Bewegung noch das Paradigma des »nahen Feindes«, aber bereits die spektakulären al-Qaida-Anschläge auf die amerikanischen Botschaften in Ostafrika von 1998 und auf den Zerstörer USS Cole im Hafen von Aden im Oktober 2000 hatten bin Laden und seine Anhänger an die Spitze der Bewegung katapultiert. Bin Ladens und Aiman az-Zawahiris Strategie wurde in militanten Kreisen hitzig debattiert, weil viele Dschihadisten nach wie vor an der Strategie des »nahen Feindes« festhielten und das Ziel verfolgten, in ihren Heimatländern nationale Revolutionen zu entfachen. Vor allem die Ägypter hatten sich seit Anfang der 1980er Jahre auf den Kampf gegen das Regime von Präsident Hosni Mubarak vorbereitet. Viele von ihnen waren nicht bereit, ihre Prioritäten zurückzustellen und stattdessen den Kampf gegen die Vereinigten Staaten und deren Verbündete aufzunehmen, der einigen als unrealistisches Unterfangen erschien. Dieser Zweig der Dschihadisten-Bewegung verlor jedoch nach dem 11. September 2001 an Einfluss, als Amerikas »Krieg gegen den Terror« sich nicht nur gegen die Internationalisten richtete, die für die Anschläge verantwortlich waren, sondern auch gegen die nationalistischen Revolutionäre, die gar nicht vorhatten, den fernen Feind anzugreifen. Für Letztere wurde es immer schw...
Inhaltsverzeichnis
- Anschläge von Einzeltätern und der Europlot
- 1. Unerwarteter Internationalismus. Die Deutschen in der dschihadistischen Bewegung
- 2. Zwei Hamburger Zellen. Eine Geschichte des Dschihadismus in Deutschland
- 3. »Ein zweiter 11. September«. Das Sauerland-Komplott
- 4. »Der erste deutsche Selbstmordattentäter«. Die Deutschen in der Islamischen Dschihad-Union
- 5. Mehr als nur Logistikdrehscheibe. Die Türkei, ihre Dschihadisten und die Deutschen
- 6. »Kuffaristan verlassen«. Radikalisierung und Rekrutierung in Deutschland
- 7. Unvollendete Terrororganisation. Die Deutschen Taliban Mudschahidin
- 8. »Der schlimmste Feind des Islam«. Die Islamische Bewegung Usbekistans gegen Deutschland
- 9. »Ich kann es nicht erwarten, Deutsche zu töten«. Aufstandsbekämpfung in Kunduz
- 10. Der neue »Boden der Ehre«. Deutsche Dschihadisten im syrischen Bürgerkrieg
- 11. »Dies ist das letzte Jahr Amerika«. Gefahren und Perspektiven
- Dank
- Abkürzungen
- Anmerkungen
- Zum Autor
- Impressum