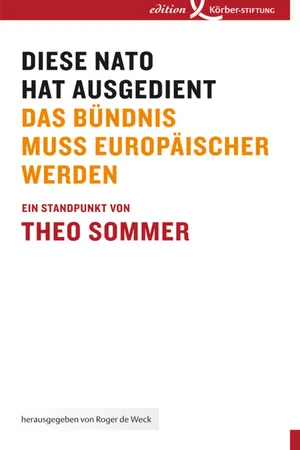
- 130 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Die NATO kann den neuen Bedrohungen wenig entgegensetzen. Für den Kampf um Ressourcen und für asymmetrische Konflikte, für die Abwehr von Cyber-Attacken und die sicherheitspolitischen Folgen des Klimawandels hat das einst erfolgreichste Bündnis der Militärgeschichte noch keine Strategie gefunden. Der Verlust des Feindbilds nach dem Ende des Ost-West-Konflikts hat die NATO verunsichert, der "Krieg gegen den Terrorismus" stellt sie auf eine harte Probe.
Die NATO muss ihren Auftrag neu definieren: Ist sie ein reines Verteidigungsbündnis oder die militärische Reserve der Vereinten Nationen? Soll sie eingreifen, wo immer westliche Werte bedroht scheinen?
Theo Sommer, einer der renommiertesten Journalisten Deutschlands, findet Antworten: Das Bündnis muss politischer und europäischer werden. Es gilt, die militärische Seite zu verschlanken. Und: Die NATO gewinnt nichts, wenn sie sich zum weltumspannenden Bündnis überdehnt. Zukunft hat sie als Allianz, in der Europa und Amerika auf Augenhöhe zusammenwirken.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Diese NATO hat ausgedient von Theo Sommer im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politics & International Relations & International Relations. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
VII. Die NATO der Zukunft
Das Problem der NATO ist, dass seit Jahren die politische Schaustellerei die gemeinsame strategische Willensbildung überwiegt. Die Allianz wirkt ratlos, in vieler Hinsicht zerstritten, ihrer Bestimmung ungewiss. Und sie ist in Gefahr, sich zu übernehmen. Ihr institutioneller Ehrgeiz ist größer als die Bereitschaft und vor allem das Vermögen der Bündnispartner, die nötigen Mittel zur Umsetzung ihrer hoch gespannten Zielsetzung bereitzustellen. Dies wird sich angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit denen alle Bündnispartner sich herumschlagen, auf absehbare Zeit auch nicht ändern. Daran kommt keine nüchterne Analyse vorbei.
Die folgenden Überlegungen über die künftige Zweckbestimmung und Gestalt der Atlantischen Allianz sind, wie könnte es anders sein im Strudel des grundstürzenden Wandels, der die Welt ergriffen hat, tastender und tentativer Natur.
Nicht nur rüsten – reden!
Es wäre kindisch, den Willen und die Fähigkeit zur Verteidigung durch pazifistische Illusionen zu ersetzen. Die Welt, in der wir leben, ist kein sicherheitspolitisches Schlaraffenland. Es gibt derzeit zwar keinen klassischen Krieg zwischen Staaten. Doch auf mehreren Kontinenten toben blutige Bürgerkriege, der Krieg hat sich entstaatlicht, und die Welt ist voller Spannungs- und Konfliktlinien, an denen sich jederzeit bewaffnete Konflikte entladen können. In Europa herrscht nach einem Jahrtausend der Bruderkriege endlich Frieden, und die Hoffnung ist mehr als berechtigt, dass kein großer Orlog zwischen den Ländern des Kontinents uns jemals wieder mit seinen Schrecknissen überziehen wird. Aber Europa ist nicht die Welt. Die geopolitischen Stress- und Verwerfungslinien rund um den Globus bergen viel Zündstoff für bewaffnete Auseinandersetzungen. Einige könnten auch die Interessen des Westens berühren.
In einer solchen Welt hat die NATO weiterhin eine Funktion. Sie bietet den Bündnispartnern eine Rückversicherung für den – ziemlich unwahrscheinlich gewordenen – Fall eines Wiederauflebens aggressiv-imperialen Denkens im Kreml. Sie schützt auch künftig die Bündnisgrenzen, zu denen – was viele vergessen – sogar die exponierte türkische Ostgrenze gehört. Mit ihrem eingespielten militärischen Apparat, ihrer Planungskapazität und ihrem soliden logistischen Unterbau kann die Allianz die Vereinten Nationen bei Friedenseinsätzen unterstützen. Als internationaler Katastrophenhelfer vermag sie nützliche und notwendige Hilfe zu leisten. Darüber hinaus muss sie genau beobachten, wie sich das Mächtemuster des 21. Jahrhunderts entwickelt und welche neuen militärischen Bedrohungen daraus entstehen könnten. Doch sollte das Bündnis sich nicht länger bloß als waffenstarrende Feuerwehr verstehen, es müsste vielmehr eine Art weltpolitischer Rauchmelder werden.
Ein derartiges Umdenken setzt allerdings voraus, dass die NATO den militärischen Flecktarn ebenso ablegt wie die einengende Bürokratenkrawatte. Sie muss wieder ein politisches Forum werden, in dem offene und aufrichtige Diskussion zwischen den transatlantischen Partnern möglich ist, muss heraus aus der routinemäßigen Beschäftigung mit sich selbst und muss wieder lernen, über den Brüsseler Tellerrand hinauszublicken.
Dabei tut kühle Analyse not. Was bedroht uns wirklich existenziell? Was müssen, was können wir dagegen tun? Und auf der Suche nach den richtigen Antworten dürfen wir die nüchterne Prüfung nicht einseitigem militärischem Sicherheitsdenken opfern. Nicht jede Gefahr, nicht jede Bedrohung, nicht jedes Risiko ist ein Nagel, auf den der militärische Hammer passt. Dieser Hammer darf immer nur das letzte Mittel sein. Politik und Diplomatie müssen stets den Vorrang haben. Konfrontationspolitik verschärft die Abgrenzung. Sie verringert die Möglichkeit, Gesprächskanäle zu eröffnen. Damit verschüttet sie nicht nur den Zugang zu Ausgleich und Einigung, sie stößt auch Prozesse an, in denen die krampfhafte Fixierung auf den schlimmsten Fall leicht zu einer sich von selbst erfüllenden Prophezeiung wird. Das Worst case-Denken muss überwunden und ersetzt werden durch ein Denken, das sich auf die wahrscheinlichsten Fälle konzentriert. Die Endzeitschlacht von Armageddon, der alles verheerende große Atomkrieg, gehört nicht dazu, und zu ideologiegetriebenen Umsturz-Interventionen in fernen Ländern wird sich fürs Erste auch niemand mehr hineinreißen lassen.
Mitten im Kalten Krieg rang sich die NATO nach den Vorschlägen des 2009 verstorbenen belgischen Politikers Pierre Harmel zu einer Doppelstrategie durch, die militärische Stärke mit Verhandlungsbereitschaft verband. Rüsten und Reden war von 1967 an die Devise. Auch für die Zukunft ist dies eine empfehlenswerte Kombination. In der gegenwärtigen Epoche, in der eine neue Weltordnung aus den Trümmern der alten erwächst, mag es in manchen Fällen sogar ratsam sein, dem Rüsten das Reden vorzuschalten, um einen Rüstungswettlauf zu verhindern, den am Ende doch alle bedauern würden. Dies gilt zumal für den Umgang mit China. Selbst gegenüber dem Iran ist, um es mit Winston Churchill zu sagen, jaw-jaw allemal besser als war-war.
Amerika und Europa: Mars und Venus?
Je kraftvoller die neu aufsteigenden Mächte ins Rampenlicht der Weltbühne treten, desto klarer werden Amerikaner und Europäer wieder erkennen, was sie aneinander haben. Die vielfältigen Beschwörungen eines breiter werdenden »Grabens«, einer »Kluft« zwischen ihnen, selbst einer »Scheidung« der transatlantischen Partner sollten uns nicht irre machen. Solche Lamentos sind seit 60 Jahren zu hören.
Schon 1959, vier Jahre nach ihrer Gründung, klagte der US-Strategieprofessor Klaus Knorr über the strained alliance, das »Bündnis unter Stress«. Jüngst erst belehrte uns Robert Kagan herablassend-missbilligend, dass die Europäer auf der Venus leben, die Amerikaner jedoch auf dem Mars: Bushs USA in einer Hobbes’schen Welt, wo internationale Regelungen und das Völkerrecht ohne Belang sind, da nur militärische Stärke zählt; in einem Kant’schen Paradies des Ewigen Friedens Europa, das auf Gesetze und Regeln baut, auf transnationale Verhandlungen und internationale Kooperation. Kagan vergaß hinzuzufügen, warum dies so ist: weil wir Europäer nämlich vom Mars kommen – von Austerlitz und Auschwitz, der Varusschlacht und Verdun, Solferino und Stalingrad, Coventry und Dresden. Unsere kriegerische Phase haben wir hinter uns. Inzwischen kommen auch die Amerikaner wieder weniger martialisch daher.
Die Geschichte der Atlantischen Allianz war oft genug eine Geschichte gravierender Differenzen: über Hähnchenhandel und Mannesmann-Röhren, Inflationsraten und Nuklearstrategie, Bananen und Beef, Irak und Guantanamo, Abrüstung und Klimawandel. In der Ära Bush führte die Entfremdung fast zum Bruch.
Doch all dies ist nur die halbe Wahrheit. Wahr ist auch, dass Amerikaner und Europäer noch immer mehr miteinander gemein haben als mit irgendjemand sonst in der Welt, dass sie dabei sind, mit ihren Differenzen leben zu lernen.
Ihre historische, kulturelle, philosophische Wesensverwandschaft bindet sie weiterhin zusammen. Für beide ist China inzwischen zum wichtigsten Handelspartner geworden, doch ihre wirtschaftliche Verflechtung ist breiter und tiefer. Amerikanische Firmen geben in Europa Millionen Menschen Arbeit und Brot; umgekehrt arbeiten Millionen US-Bürger in den amerikanischen Filialen europäischer Unternehmen. Drei Viertel der Auslandsinvestitionen in Amerika stammen aus Europa, 56 Prozent der US-Auslandsinvestitionen fließen in die Europäische Union. Und die Heerschaaren von Touristen, die alljährlich den Atlantik überqueren, liefern den Beweis, dass auch die noch immer existierende emotionale Nähe zueinander weiterhin große Bindekraft hat.
Beide werden die gegenwärtige Krise meistern. Amerika hat bewundernswerte Steher- und Stehaufmännchen-Qualitäten, und auch die Europäer werden sich aus ihrer derzeitigen Malaise herausarbeiten. Wenn alle erst einmal den Kopf wieder frei haben, werden sie ein demografisches Faktum entdecken, das sie nachdenklich stimmen muss. Mitte des 21. Jahrhunderts werden 9 Milliarden Menschen auf der Erde leben, davon je eine halbe Millliarde in Nordamerika und in der Europäischen Union. Getrennt voneinander stünden sie mit ihren jeweils 500 Millionen Einwohnern 8 Milliarden Menschen im Rest der Welt gegenüber. Zusammen hätten sie mit immerhin 1 Milliarde Einwohner weit bessere Aussichten, sich behaupten zu können.
Die Vereinigten Staaten sind nicht mehr der Welthegemon, aber sie bleiben auf absehbare Zeit die stärkste Macht der Erde. Doch auch die Europäische Union ist keine vernachlässigbare Größe. Sie hat mit einer halben Milliarde Menschen nach China und Indien die drittgrößte Bevölkerung der Welt. Ihre Wirtschaftsleistung von 18 Billionen Dollar ist um 2 Billionen größer als die amerikanische und mehr als doppelt so groß wie die chinesische. Sie ist der größte Geber von Entwicklungshilfe. Weiter ist die EU bei all ihren Schwächen die zweitgrößte Militärmacht der Welt. Frankreich und England allein geben zusammen etwa so viel für Verteidigung aus wie China. Die europäische Wirtschaft mag gegenwärtig kriseln, und im Vergleich mit dem üppigen Pentagon-Budget nehmen sich die europäischen Wehretats bescheiden aus. Aber ökonomisch wie militärisch bleiben Amerika und Europa komplementäre Größen.
Europa braucht in dem derzeit unwahrscheinlichen, jedoch nicht für alle Zeiten verlässlich auszuschließenden Fall einer wiederkehrenden existenziellen Bedrohung die strategische Potenz der USA. Umgekehrt brauchen die Amerikaner gerade dann, wenn sie sich nun stärker nach Asien wenden, den Rückhalt an der wirtschaftlichen und diplomatischen Potenz der Europäer – im Mittelmeer und in dem krisengeschüttelten Mittleren Osten, im frühlingsfiebernden arabischen Krisenbogen und im unruhigen Schwarzafrika. Soft power ergänzt hard power. So profitieren beide von der transatlantischen Verklammerung in der NATO.
Zurück zu den Wurzeln
Die NATO-Mitglieder müssen sich ganz neu über Sinn und Zweck ihres Bündnisses in der heutigen Zeit verständigen. Einfach wird dies nicht sein, denn die Vorstellungen, die darüber im Schwange sind, gehen auf beiden Seiten des Atlantiks weit auseinander.
Die erste, extremste Richtung vertritt John Kornblum, als US-Botschafter in Berlin einst der letzte »Vizekönig« auf diesem Posten und von jeher ein glühender Verfechter des amerikanischen Primats in der Atlantischen Allianz. Er hält den Versuch der Europäer, sich im Rahmen der NATO eine eigene Verteidigungsidentität zu geben, von Grund auf für verfehlt. Die Folge, die er in The Security Times ausmalte: »Die transatlantische Sicherheitsgemeinschaft ist für die Vereinigten Staaten bei der Verfolgung ihrer Interessen immer weniger von Nutzen.« Die Europäer hätten ihre Fähigkeit verloren, auf der poltisch-militärischen Weltbühne ein Wörtchen mitzureden, woraufhin Amerika es aufgegeben habe, seine Sicherheitsinteressen gemeinsam mit den europäischen Partnern zu definieren. Als Remedur schwebt Kornblum vor, »dass Europa sich wieder aktiv der Alantischen Gemeinschaft anschließt« – eine merkwürdige Formulierung, die im Kern besagt, die Europäer sollten sich wieder allem unterwerfen, was aus Washington kommt, seien es Verteidigungsdoktrinen, Strategien, Kriegsgründe oder Forderungen nach burden-sharing. Damit wäre in der Tat die angeknackste amerikanische Hegemonie wiederhergestellt. Aber so wird es nicht gehen. Eine Allianz kann nicht funktionieren, in der das jeweilige nationale Interesse der stärksten Macht das Definitionskriterium für den Einsatz der Bündnisstreitkräfte ist.
Der jüngst verstorbene Ronald Asmus plädierte für eine weniger rabiate Lösung: eine Erweiterung des NATO-Pflichtenhefts auf Eventualfälle jenseits der Bündnisgrenzen. Die Allianz, so argumentierte er leidenschaftlich, müsse den neuen Risiken, Gefährdungen und Bedrohungen ebenso wirksam gegenübertreten wie den Sowjets während des Kalten Krieges – gleichgültig, aus welcher Richtung, aus welcher Entfernung und mit welcher Wucht sie sich präsentierten. Fortan müsse sie sich in der Rolle des »Stabilitätsprojektors« auf Regionen weit außerhalb der Bündnisgrenzen profilieren.
Auf dem Balkan hat solcher Stabilitätstransfer in der Tat funktioniert, doch je weiter sich das Bündnis von der eigenen Peripherie entfernte, desto schwieriger war die neue Rolle durchzuhalten und desto unbefriedigender auch der Erfolg. Und je klarer es in der Amtszeit von George W. Bush wurde, dass die Allianz damit letztlich zum Erfüllungsgehilfen Washingtons bei der Realisierung seiner geopolitischen Träume wie seiner Neigung zu militärischem Aktionismus werden sollte, desto mehr Zweifel regten sich an dieser neuen Ausrichtung. Gleichwohl hielt Asmus an seinem Konzept fest. Bis zuletzt blieb er bei seiner Botschaft: »Die NATO muss eine weltweite Allianz werden – eine, die sich in Ländern und Gebieten weit jenseits des europäischen Herzlands engagiert, und dies in Missionen, die das Vorstellungsvermögen der Gründer weit übersteigen.«
Die Schwierigkeit mit diesem Konzept liegt darin, dass Washington begierig darauf ist, die europäischen Verbündeten ins weltumspannende Obligo zu nehmen, aber nur wenig Neigung verspürt, ihnen ein Mitspracherecht bei der Festlegung der Notwendigkeiten und Möglichkeiten des Handelns einzuräumen. Die Allianz wird im Pentagon gern als Hemmschuh gesehen, der die eigene Handlungsfreiheit einengt. Lieber verließ sich Donald Rumsfeld als US-Verteidigungsminister auf »Koalitionen der Willigen«. Alliierte waren ihm wichtiger als die Allianz; die diente ihm nur als Werkzeugkasten (mit Gratiszugriff, versteht sich). Doch ohne wirkliche Mitsprache werden sich die Europäer schwerlich bereitfinden, den Amerikanern auch nur einen Teil der Bürde ihrer globalen Verantwortung abzunehmen.
Wirklichkeitsnäher ist der Bericht, den das Washington NATO Project unter der Federführung von Daniel Hamilton 2009 vorgelegt hat. Er geht davon aus, dass die transatlantische Partnerschaft auch in Zukunft eine bedeutsame Rolle zu spielen hat; dass sich die NATO nicht nur auf den Terrorismus oder auf potenzielle zwischenstaatliche Konflikte konzentrieren darf, sondern ihre Aufmerksamkeit vordringlich auf eine »Vielzahl unorthodoxer Herausforderungen« richten muss; und dass sie zu diesem Ende ihre Institutionen und Mechanismen, besonders die Partnerschaft zwischen den USA und der EU, »repositionieren« sollte. Ein neuer Konsens über den Auftrag der NATO ist Hamiltons Ziel. Drei Schwerpunkte skizziert sein Bericht: Krisenverhinderung und Krisenreaktion; Stabilisierungs- und Wiederaufbau-Operationen und bessere Zusammenarbeit mit internationalen und regionalen Organisationen.
Realistischerweise geht Hamilton von der Erkenntnis aus, dass zusätzliche Finanzmittel nicht zur Verfügung stehen werden, sondern dass eher mit einem Sinken der Verteidigungsetats zu rechnen ist. Deshalb schlägt er vor, die NATO-Kommandostruktur weiter zu straffen, die wuchernden Agenturen und Subagenturen der Allianz kräftig zurückzustutzen und nach zwei Jahrzehnten, in denen das Schlagwort out of area, out of business galt, externe und interne Aspekte wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Eine Umschichtung der vorhandenen Mittel soll die Handlungsfähigkeit des Bündnisses erhöhen. Aus der Fülle detaillierter Vorschläge ragt vor allem eine Anregung heraus, die inzwischen aufgegriffen worden ist: den überzogenen Ehrgeiz aufzugeben, gleichzeitig zwei große Kriege und sechs kleinere Unternehmen durchführen zu können. Dem liegt die Einsicht zu...
Inhaltsverzeichnis
- Roger de Weck: Kurze Ewigkeiten
- Vorwort
- I. Die Anfänge
- II. Umbruch und Transformation
- III. Altes Bündnis sucht neuen Auftrag
- IV. Out of area – out of business?
- V. Die neuen Ungewissheiten
- VI. Amerika und Europa: noch Partner?
- VII. Die NATO der Zukunft
- VIII. Altes Bündnis, neuer Bund
- Der Autor
- Impressum