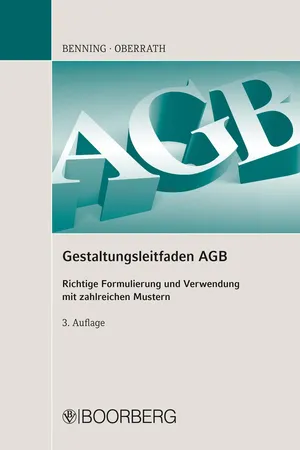
eBook - ePub
Gestaltungsleitfaden AGB
Richtige Formulierung und Verwendung mit zahlreichen Mustern
- 242 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Gestaltungsleitfaden AGB
Richtige Formulierung und Verwendung mit zahlreichen Mustern
Über dieses Buch
Das Problem:
Für den Unternehmer, aber auch für seine Berater werden Allgemeine Geschäftsbedingungen immer mehr zu einer unbekannten Materie und ihre Abfassung und Verwendung zu einem unkalkulierbaren Risiko.
Die Lösung:
Hier schafft der Leitfaden Abhilfe. Er ist besonders anwenderfreundlich ausgerichtet. Der Ratgeber dient als erster Einstieg bei der Gestaltung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen und hilft, grobe Fehler bei der Abfassung zu vermeiden.
Mit Formulierungshilfen:
Der Leser kann sich gezielt über die Zulässigkeit einzelner Klauseln und über allgemeine Probleme bei der Abfassung und Verwendung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen informieren.
Der Band zeigt, welche branchenübergreifenden Gestaltungsgrenzen es für einzelne AGB-Bestimmungen gibt, und bietet hierzu jeweils Formulierungshilfen: Angefangen von Annahmefristen und Abwehrklauseln über Eigentumsvorbehalte und Haftungsausschlüsse bis hin zu Schriftformklauseln und Zahlungsmodalitäten geht der Leitfaden auf alle wesentlichen AGB-Regelungen ein, die für die Praxis von Bedeutung sind.
Inklusive Muster AGBs:
Neben den allgemeinen Gestaltungshinweisen finden sich für eine Vielzahl von Vertragstypen ausformulierte Muster-AGBs. Dabei verweist das Praxiswerk auf die jeweiligen rechtlichen Besonderheiten von Arbeitsverträgen, Bau- oder Mietverträgen, Reparatur- oder Wartungsverträgen u.v.m.
Topaktueller Rechtsstand:
Die 3. Auflage berücksichtigt die Fortentwicklung der Rechtsprechung und der Literatur, wie etwa
- die Entwicklungen im Mängelhaftungsrecht bei Kauf- und Werkverträgen,
- die nahezu unüberschaubare Rechtsprechung zu Schönheitsreparaturen im Mietrecht sowie
- die Neuerungen beim Verbraucherwiderrufsrecht durch die EU-Verbraucherschutz-RL.
Mit Problem-ABC:
Eine Auflistung der wichtigsten Probleme führt schnell zur gesuchten Information rundet den Ratgeber ab.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Gestaltungsleitfaden AGB von Prof. Dr. iur. Axel Benning,Bettina Benning,Prof. Dr. iur. Jörg-Dieter Oberrath,Ellen Oberrath im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Law & Civil Law. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
E. Gestaltung von AGB bei einzelnen Vertragstypen
240
Aufbauend auf den Ausführungen zu generell häufig vorkommenden AGB-Bestimmungen soll im Folgenden aufgezeigt werden, welche besonderen Problemstellungen bei bestimmten Branchen bzw. Vertragstypen bestehen und inwieweit diese durch AGB gelöst werden können. Zusätzlich werden für die besonders praxisrelevanten Vertragstypen Vorschläge für Basis-AGB unterbreitet, die nach den Bedürfnissen des konkreten Verwenders erweitert oder modifiziert werden können. Hierzu können die in Kapitel C vorgeschlagenen Formulierungen verwendet werden. Außerdem kann sich der Unternehmer in bestimmten Wirtschaftsbereichen an sog. Konditionenempfehlungen der jeweils zuständigen Wirtschafts- oder Berufsvereinigung orientieren. Bei diesen handelt es sich um Vorschläge zur Vereinheitlichung der AGB für eine bestimmte Branche. Nach dem Wegfall des § 22 Abs. 3 GWB a. F. bedürfen diese nicht mehr der Anmeldung bei der Kartellbehörde (näher dazu Ulmer, in: Ulmer/Brandner/Hensen, AGB-Recht, Einl. Rn. 75 a ff.).
241
Unabhängig von konkreten Formulierungsvorschlägen, sollten AGB immer Regelungen zu ihrem Geltungsbereich, zum Zeitpunkt des Zustandekommens des Vertrages, zu der Preisgestaltung und den Zahlungsbedingungen, zur Haftung für Schadensersatzansprüche und ggf. Mängeln, zur Verjährung sowie zum Gerichtsstand und der Rechtswahl enthalten. Bei Dauerschuldverhältnissen sind Regelungen zur Vertragsdauer und zur Beendigung unentbehrlich. Lieferverträge sollten überdies immer Regelungen zum Eigentumsvorbehalt enthalten. Soweit im Folgenden keine konkreten Formulierungsvorschläge für Basis-AGB unterbreitet werden können, kann folgendes Grundschema für die Erstellung verwendet werden.
242
§ *
Geltungsbereich – Vertragsgegenstand
Allgemein dazu Kap. C III
(…)
§ *
Angebot und Vertragsschluss (und Angebotsunterlagen)
Allgemein dazu Kap. C II
(…)
§ *
Preise und Zahlungsbedingungen
Allgemein dazu Kap. C XVI und C XXV
(…)
§ *
Vertragsdauer – Kündigung (nur bei Dauerschuldverhältnissen)
Allgemein dazu Kap. C XX und C XXI
(…)
§ *
Leistungszeit
Allgemein dazu Kap. C XIII
(…)
§ *
Haftung für Mängel
Allgemein dazu Kap. C V
(…)
§ *
Haftung für Schäden
Allgemein dazu Kap. C XII
(…)
§ *
Eigentumsvorbehalt (nur bei Lieferverträgen)
Allgemein dazu Kap. C VII
(…)
§ *
Verjährung eigener Ansprüche
Allgemein dazu Kap. C XIX
(…)
§ *
Form von Erklärungen
Allgemein dazu Kap. C IX
(…)
§ *
Erfüllungsort – Rechtswahl – Gerichtsstand
Allgemein dazu Kap. C VIII, C XVII und C XI
(…)
Geltungsbereich – Vertragsgegenstand
Allgemein dazu Kap. C III
(…)
§ *
Angebot und Vertragsschluss (und Angebotsunterlagen)
Allgemein dazu Kap. C II
(…)
§ *
Preise und Zahlungsbedingungen
Allgemein dazu Kap. C XVI und C XXV
(…)
§ *
Vertragsdauer – Kündigung (nur bei Dauerschuldverhältnissen)
Allgemein dazu Kap. C XX und C XXI
(…)
§ *
Leistungszeit
Allgemein dazu Kap. C XIII
(…)
§ *
Haftung für Mängel
Allgemein dazu Kap. C V
(…)
§ *
Haftung für Schäden
Allgemein dazu Kap. C XII
(…)
§ *
Eigentumsvorbehalt (nur bei Lieferverträgen)
Allgemein dazu Kap. C VII
(…)
§ *
Verjährung eigener Ansprüche
Allgemein dazu Kap. C XIX
(…)
§ *
Form von Erklärungen
Allgemein dazu Kap. C IX
(…)
§ *
Erfüllungsort – Rechtswahl – Gerichtsstand
Allgemein dazu Kap. C VIII, C XVII und C XI
(…)
I. Arbeitsverträge
Literatur
Annuß, Grundstrukturen der AGB-Kontrolle von Arbeitsverträgen, BB 2006, 1333. Herbert/Oberrath, Arbeitsrecht nach der Schuldrechtsreform – eine Zwischenbilanz NJW 2005, 3745; Hunold, Die aktuelle Rechtsprechung zur Inhaltskontrolle arbeitsrechtlicher Absprachen – AGB-Kontrolle, NZA-RR, 2008, 449 ff.; Hümmerich, Gestaltung von Arbeitsverträgen nach der Schuldrechtsreform, NZA 2003, 754 ff.; Schrader/Schubert, AGB-Kontrolle von Arbeitsverträgen (Teil 1): Tätigkeit, Arbeitszeit und Vergütung, NZA-RR 2005, 169; Lakies, AGB-Kontrolle von Arbeitsverträgen, ArbR Aktuell 2013, 318 ff.; Lakies, AGB-Kontrolle von Vertragsstrafenvereinbarungen, ArbR Aktuell 2014, 313 ff.; Niebling, Anwaltskommentar AGB-Recht, Teil 2 Arbeitsverträge, Rn. 6 ff.; Schrader/Schubert, AGB-Kontrolle von Arbeitsverträgen – Grundsätze der Inhaltskontrolle arbeitsvertraglicher Vereinbarungen (Teil 2): Gestaltung des Arbeitsverhältnisses, Vertragsstrafe und Ausschlussfristen, NZA 2005, 225; Singer, Arbeitsvertragsgestaltung nach der Schuldrechtsreform, RdA 2003, 194 ff.
Annuß, Grundstrukturen der AGB-Kontrolle von Arbeitsverträgen, BB 2006, 1333. Herbert/Oberrath, Arbeitsrecht nach der Schuldrechtsreform – eine Zwischenbilanz NJW 2005, 3745; Hunold, Die aktuelle Rechtsprechung zur Inhaltskontrolle arbeitsrechtlicher Absprachen – AGB-Kontrolle, NZA-RR, 2008, 449 ff.; Hümmerich, Gestaltung von Arbeitsverträgen nach der Schuldrechtsreform, NZA 2003, 754 ff.; Schrader/Schubert, AGB-Kontrolle von Arbeitsverträgen (Teil 1): Tätigkeit, Arbeitszeit und Vergütung, NZA-RR 2005, 169; Lakies, AGB-Kontrolle von Arbeitsverträgen, ArbR Aktuell 2013, 318 ff.; Lakies, AGB-Kontrolle von Vertragsstrafenvereinbarungen, ArbR Aktuell 2014, 313 ff.; Niebling, Anwaltskommentar AGB-Recht, Teil 2 Arbeitsverträge, Rn. 6 ff.; Schrader/Schubert, AGB-Kontrolle von Arbeitsverträgen – Grundsätze der Inhaltskontrolle arbeitsvertraglicher Vereinbarungen (Teil 2): Gestaltung des Arbeitsverhältnisses, Vertragsstrafe und Ausschlussfristen, NZA 2005, 225; Singer, Arbeitsvertragsgestaltung nach der Schuldrechtsreform, RdA 2003, 194 ff.
1. Rechtliche Besonderheiten
a) Grundlagen
243
Seit der Schuldrechtsreform sind gemäß § 310 Abs. 4 Satz 2 BGB die AGB-Bestimmungen der §§ 305 ff. BGB grundsätzlich auf Arbeitsverträge anwendbar. Die Anwendbarkeit der §§ 305 ff. BGB steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Besonderheiten des Arbeitsrechts angemessen zu berücksichtigen sind.
244
Die §§ 305 ff. BGB kommen zur Anwendung, wenn vorformulierte Vertragsbedingungen für eine Vielzahl von Verträgen Anwendung finden und vom Verwender gestellt werden. Das BAG hat inzwischen entschieden, dass ein Arbeitnehmer Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist (BAG NZA 2005, 1111). Daher ist § 310 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BGB auch auf Arbeitsverträge anwendbar. Es wird daher vermutet, dass die Vertragsbedingungen vom Arbeitgeber gestellt wurden. Darüber hinaus finden die §§ 307 ff. BGB auch Anwendung, wenn die Vertragsbedingungen nur zur einmaligen Verwendung bestimmt sind.
b) Einbeziehung
245
Für die Frage, ob die AGB Vertragsbestandteil geworden sind, gelten nach § 310 Abs. 4 Satz 2 BGB die Vorgaben des § 305 Abs. 2 und 3 BGB nicht. Daher reicht eine zumindest konkludent erfolgte Einigung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Geltung der AGB aus. Wie generell im AGB-Recht werden trotz einer entsprechenden Einigung Klauseln nicht Bestandteil, wenn sie im Sinne von § 305c BGB überraschend sind oder eine Individualvereinbarung im Sinne von § 305b BGB vorliegt. Weder Bestimmungen über Ausschlussfristen oder eine Ausgleichsquittung bezüglich Ansprüchen des Arbeitnehmers noch eine Vertragsstrafenklausel stellen nach dem BAG grundsätzlich eine überraschende Klausel dar. Allerdings kann sich im Einzelfall der Überraschungseffekt daraus ergeben, dass die Klausel nicht hinreichend drucktechnisch hervorgehoben wurde (BAG NZA 2006, 324).
c) Inhaltskontrolle
246
Für die Inhaltskontrolle gelten zunächst sowohl die Klauselverbote der §§ 308, 309 BGB als auch die Generalklausel des § 307 BGB sowie das Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB. Allerdings steht die Inhaltskontrolle nach § 310 Abs. 4 Satz 2 unter dem Vorbehalt, dass die Besonderheiten des Arbeitsrechts hinreichend berücksichtigt werden. Die Unzulässigkeit einer Klausel kann daher trotz Vorliegen eines ausdrücklichen Klauselverbots zu verneinen sein, wenn tatsächliche oder rechtliche Besonderheiten des Rechtsgebiets Arbeitsrecht eine Abweichung von dem im Klauselverbot zum Ausdruck kommenden Regelungsanliegen gebieten. Daher sind z. B. Vertragsstrafenklauseln in Arbeitsverträgen nicht nach § 309 Nr. 6 BGB unzulässig, da wegen der fehlenden Vollstreckbarkeit der Arbeitsleistung das Verbot von Vertragsstrafen gegenüber Verbrauchern im Arbeitsrecht nicht sachgerecht erscheint (BAG NZA 2004, 727).
d) Rechtsfolgen
247
Die Rechtsfolgen unwirksamer Klauseln bestimmen sich nach § 306 BGB. Entgegen der früheren Rechtsprechung des BAG (z. B. BAG NZA 2005, 465) gilt jetzt auch für vor dem 1.1.2002 geschlossene Verträge das Verbot der geltungserhaltenden Reduktion (BAG NZA 2008, 293). Ist eine Klausel unwirksam, scheidet eine ergänzende Vertragsauslegung daher aus, und es kommen die gesetzlichen Regelungen zur Anwendung.
2. Formulierungsvorschläge für einzelne Klauseln
248
Im Hinblick auf die nach Branche, Stellung und Tätigkeit sehr unterschiedlichen Anforderungen an die Gestaltung eines Arbeitsvertrages wird von der Unterbreitung eines Formulierungsvorschlages für einen vorformulierten Arbeitsvertrag abgesehen. Mindestens sollte er Angaben zu Beginn des Arbeitsverhältnisses, zum Arbeitsort, zur vom Arbeitnehmer zu erbringenden Tätigkeit, zum Arbeitsentgelt, zur Arbeitszeit, zum Urlaubsanspruch und zu den Kündigungsgründen und -fristen enthalten. Im Übrigen sollten die gem. § 2 Abs. 1 NachwG erforderlichen Angaben enthalten sein.
249
Im Folgenden sollen noch einige konkrete Klauseln, die häufig verwendet werden und mit deren Zulässigkeit sich Literatur und Gerichte beschäftigen, kurz erläutert werden:
a) Änderungs- oder Leistungsvorbehalte
249a
Unter dem Stichwort Änderungsvorbehalte oder Leistungsvorbehalte werden Klauseln diskutiert, mit Hilfe derer sich der Arbeitgeber Flexibilität hinsichtlich der von ihm zu erbringenden Leistungen bzw. bezüglich Gegenstand, Ort und zeitlichem Umfang der Arbeitsleistung des Arbeitsnehmers bewahren will. Solche Klauseln werden von der Rechtsprechung, soweit kein Klauselverbot greift, allgemein einer Angemessenheits- und einer Transparenzkontrolle unterzogen. Bei der Angemessenheitskontrolle muss insbesondere geprüft werden, ob die Klausel einer gerechten Abwägung zwischen dem Interesse des Arbeitgebers an einer gewissen Flexibilität der Arbeitsbedingungen und dem Interesse des Arbeitnehmers an Vertragsinhaltsschutz entspricht (näher ErfK/Preis, §§ 305–310 BGB Rn. 51 ff.). Die Einzelheiten richten sich danach, wie die Klausel genau konstruiert ist. Nach der Rechtsprechung muss die Klausel je konkreter sein, desto einschneidender die Änderung ist (BAG NJW 2011, 2153; Palandt/Grüneberg, § 308 BGB Rn. 25). Unterschieden werden insbesondere Freiwilligkeitsvorbehalte, Versetzungsklauseln und Widerrufsvorbehalte, auf die wir unter dem jeweiligen Stichwort im Folgenden noch näher eingehen werden.
b) Arbeitszeitregelungen
249b
Arbeitszeitregelungen in AGB sind, soweit sie die Arbeitszeit nur vorübergehend verlängern oder verkürzen, als Konkretisierung des Direktionsrechts nach § 106 GewO grundsätzlich zulässig. Sowohl die Formulierung einer entsprechenden Klausel als auch der konkrete Gebrauch einer solchen unterliegt der Angemessenheitskontrolle i. S. v. § 307 BGB (BAG NZA-RR 2008, 129). Daher wird bei Überstundenregelungen die Angabe von Gründen, wann solche zu leisten sind, notwendig sein. Bei Klauseln zur Einführung von Kurzarbeit darf die Verkürzung nicht mehr als 25% betragen.
c) Ausgleichsquittungen
249c
Formularmäßige Ausgleichsquittungen, mit denen Arbeitgeber sich bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses vom Arbeitnehmer bestätigen lassen, dass dieser keine Ansprüche mehr hat, sind nach dem BAG einer Transparenz- und einer Angemessenheitskontrolle zu unterziehen. Unangemessen ist eine entsprechende Klausel wohl, wenn keine kompensatorische Gegenleistung des Arbeitgebers vereinbart wurde. Das BAG hat dies jedenfalls für den Fall angenommen, dass auch ein Verzicht auf die Kündigungsschutzklage bestimmt war (BAG NZA 2008, 355).
d) Ausschlussfristen
249d
Ausschlussfristen für Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind nach der Rechtsprechung nicht grundsätzlich unwirksam, sofern sie für beide Parteien gelten (BAG NZA 2006, 324). Nach dem BAG (NJW...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- A. Einführung
- B. Einbeziehung von AGB
- C. Branchenübergreifende Gestaltungsgrenzen für einzelne Bestimmungen
- D. Allgemeine Gestaltungshinweise
- E. Gestaltung von AGB bei einzelnen Vertragstypen
- F. Problem-ABC
- Literaturverzeichnis
- Stichwortverzeichnis