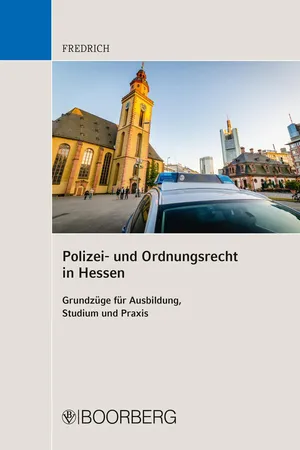
eBook - ePub
Polizei- und Ordnungsrecht in Hessen
Grundzüge für Ausbildung, Studium und Praxis
- 200 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Schlanke Darstellung
Der Autor erläutert in verständlicher Sprache die Grundzüge des Polizei- und Ordnungsrechts in Hessen. Das Buch konzentriert sich auf die Rechtsfragen, die bei der Anwendung des HSOG (Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung) durch Polizei- und Ordnungsbehörden und durch die Verwaltungsbehörden sowie in Studium und Ausbildung zu beantworten sind.
Tiefer gehende Ausführungen enthält die Darstellung nur, soweit diese für ein besseres Verständnis einzelner Rechtsprobleme erforderlich sind. Beispiele aus der Praxis erleichtern den Zugang zur Rechtsmaterie. Praxistipps zum Umgang mit dem HSOG sowie Übersichten und zusammenfassende Hinweise ergänzen den Leitfaden.
Gliederung für die Praxis
Das Buch ist – analog der Vorgehensweise bei der Rechtsanwendung – in sechs Kapitel aufgeteilt:
Die Aufgaben nach geltendem Recht (Gefahrenabwehr, Vollzugshilfe)
Organisation und Zuständigkeiten der Gefahrenabwehrbehörden
Organisation und Zuständigkeiten der Polizeibehörden
Befugnisse der Gefahrenabwehr- und Polizeibehörden
Verwaltungszwang
Möglichkeiten des Schadensausgleichs
Aktueller Inhalt
Der Verfasser hat die umfangreichen Änderungen des HSOG aus dem Jahr 2018 eingearbeitet, die u.a. auf die Umsetzung der EU-Datenschutzreform sowie auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 20. April 2016 zurückgehen. Auch neue Befugnisse wie z.B. die elektronische Aufenthaltsüberwachung, die Online-Durchsuchung oder die Datenanalyse sind berücksichtigt.
Ein umfangreiches Stichwortverzeichnis ermöglicht den schnellen Zugang zu speziellen Themen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Polizei- und Ordnungsrecht in Hessen von Dirk Fredrich im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Law & Administrative Law. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1. Gefahrenabwehr als Aufgabe des Staates
1.1 Rechtshistorische Entwicklung
1.1.1 Gefahrenabwehr
1
Wesentliche Rechtsgrundlage für das Polizei- und Ordnungsrecht in Hessen ist das Hessische Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG). Das HSOG gilt derzeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. August 2018 (GVBl. S. 374).
Der Begriff „Polizei“ ist, anders als der Begriff „Ordnung“ in der Überschrift des Gesetzes „Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung“, nicht enthalten. Das HSOG geht aber in seiner Aufgabengeneralklausel vom materiellen Polizeibegriff aus (vgl. RN 7). Zum formellen Polizeibegriff vgl. RN 94.
Der Begriff hat seinen Ursprung in dem griechischen Wort „Politeia“ und umfasste die gesamte Staatsverwaltung. In Deutschland verstand man unter dem Begriff „Polizey“ seit dem Spätmittelalter einen Zustand der guten Ordnung des Gemeinwesens. In Polizeiordnungen des Reiches, der Länder und Städte wurden Regelungen getroffen, die die verschiedenartigsten Lebensbereiche erfassten, z. B. auch, welche Tracht zu tragen war oder wie sich der Geselle gegenüber dem Meister zu verhalten hatte (vgl. Lisken/Denniger, Abschnitt A, RN 5).
Im 17. und 18. Jahrhundert, also im Zeitalter des Absolutismus, wurde auch die Förderung der Wohlfahrt als „polizeiliche“ Aufgabe angesehen. Diese Epoche wird als Polizeistaat bezeichnet (vgl. Pausch/Dölger, S. 29, 30).
Im Zeitalter der Aufklärung wandelte sich der Polizeibegriff. Der Staat sollte nicht mehr unbegrenzt in das Leben der Bürger eingreifen, sondern sich auf die Abwehr von Gefahren beschränken (vgl. Krollmann, S. 7). Im Allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten vom 2. Mai 1794 (ALR) hieß es in § 10 Teil II Titel 17:
„Die nötigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung, und zur Abwendung der dem Publiko, oder einzelnen Mitgliedern desselben bevorstehenden Gefahr zu treffen, ist das Amt der Polizey.“
Damit schied die Wohlfahrtspflege aus dem polizeilichen Aufgabenkreis aus (vgl. Schneider, Vorwort, S. 8). Es dauerte allerdings noch viele Jahrzehnte, nämlich bis zu dem sogenannten Kreuzbergurteil des Preußischen OVG vom 14.06.1882, Pr. OVGE 9, 353 ff., bis sich diese Auffassung auch tatsächlich durchgesetzt hatte (vgl. Wesel, RN 280).
3
Die Formulierung in § 10 II 17 ALR fand später sinngemäß Eingang in § 14 des preußischen Polizeiverwaltungsgesetzes (PVG) vom 1. Juni 1931 (GS S. 77). Das PVG hielt in § 14 Abs. 2 auch bereits fest, dass den Polizeibehörden neben der Abwehr von Gefahren durch Gesetz weitere Aufgaben übertragen werden können. Das PVG galt nach der Bildung des Landes Groß-Hessen durch die Proklamation Nr. 2 der Militärregierung Deutschland-Amerikanische Zone vom 19. September 1945 (vgl. Boehncke/Sarcowicz, S. 201), das in der Verfassung vom 1. Dezember 1946 den Namen Hessen erhielt (vgl. Art. 64 HV), in den Teilen des Landes Hessen weiter, die vorher zu Preußen gehörten. In den Gebieten des früheren Volksstaates Hessen fanden die einschlägigen Bestimmungen der Städteordnung und der Kreis- und Provinzialordnung von 1911 Anwendung (vgl. Krollmann, S. 9).
Durch das Hessische Polizeigesetz (HPolG) vom 10. November 1954 (GVBl. S. 203) war ein erstes landeseinheitliches Polizeirecht geschaffen worden. Es übernahm in seinem § 1 sinngemäß die Formulierung des § 14 PVG. und fasste die Beschreibung der Aufgabe „von der Allgemeinheit oder dem einzelnen Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht wird“ als Legaldefinition unter dem Begriff „Gefahrenabwehr“ zusammen. Der Schutz privater Rechte war nicht ausdrücklich als Aufgabe definiert, ergab sich aber aus § 21 Abs. 2 HPolG, der eine Personalienfeststellung zuließ. Die Aufgabe der Vollzugshilfe fand sich in § 3 HPolG.
Das HSOG vom 17. Dezember 1964 (GVBl. I S. 209), das an die Stelle des HPolG trat, übernahm § 1 Abs. 1 die gesetzliche Definition der Gefahrenabwehr. § 1 Abs. 2 enthielt die Aufgabenabgrenzung für Eilfälle und den Hinweis auf gesetzlich besonders übertragene Aufgaben. Die Aufgaben in den Bereichen der Zusammenarbeit, des Privatrechtsschutzes, der einen Antrag des Berechtigten voraussetzte, und der Vollzugshilfe waren in §§ 2, 3 sowie § 44 Abs. 3 niedergelegt. In der Neufassung des HSOG vom 26. Januar 1972 (GVBl. I S. 23) blieben diese Regelungen unverändert.
4
Das HSOG vom 26. Juni 1990 (GVBl. I S. 197), das das HSOG in der Fassung von 1972 ersetzte, hat den Begriff „Gefahrenabwehr“ leicht abgewandelt, indem es nicht mehr zwischen der Allgemeinheit oder dem Einzelnen unterscheidet. Zudem wird dem von der Innenministerkonferenz im Jahre 1977 beschlossenen Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes (zum Text, s. Schenke, S. 405 ff.) gefolgt und eine Trennung zwischen Aufgaben und Befugnissen vollzogen. In § 1 Abs. 1 Satz 1 wird die Aufgabe der „Gefahrenabwehr“ in der sogenannten Generalklausel beschrieben. Die Aufgaben des Privatrechtsschutzes, die keinen Antrag der berechtigten Person mehr vorsehen, die der Vollzugshilfe und der Zusammenarbeit sind nunmehr in § 1 beschrieben (Abs. 3, 5 und 6). Darüber hinaus sind die Aufgaben „Vorbereitung für die Hilfeleistung in Gefahrenfällen sowie „vorbeugende Bekämpfung von Straftaten“ in der Form der Verhütung zu erwartender Straftaten als Teil der Gefahrenabwehraufgabe aufgenommen worden (§ 1 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4). Die Regelung über die Aufgabenabgrenzung für Eilfälle ist leicht abgewandelt in § 2 verlegt worden. Die zur Verfügung stehenden Befugnisse, mit denen die Aufgaben erfüllt werden können, die mit Eingriffen verbunden sind, finden sich in den §§ 11 ff. (vgl. RN 114 ff.).
Das HSOG von 1990 ist am 1. Januar 1991 in Kraft getreten (vgl. § 115 HSOG) und gilt noch heute. In den Jahren 1994 und 2005 sind aber nach umfangreichen Änderungen jeweils Bekanntmachungen der Neufassungen des HSOG vom 31. März 1994 (GVBl. I S. 174) und vom 14. Januar 2005 (GVBl. I S. 14) erfolgt.
Durch das Änderungsgesetz vom 3. November 1998 (GVBl. I S. 399) ist in § 1 Abs. 4 die Aufgabe der Vorsorge für die Verfolgung künftiger Straftaten (vgl. RN 17) aufgenommen worden.
Durch das Änderungsgesetz vom 22. Mai 2000 (GVBl. I S. 577 ist in § 1 Abs. 6 der Aufgabenbereich durch eine Regelung über die Bildung von Kriminalpräventionsräten (vgl. RN 27) ergänzt worden.
Schließlich ist durch Änderungsgesetz vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 635) in § 1 Abs. 4 HSOG festgehalten worden, dass die Aufgabe der Vorsorge für die Verfolgung künftiger Straftaten (vgl. RN 17) nicht zum Bereich der Gefahrenabwehr gehört.
Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich am 14.06.2017 verständigt, dass ein Musterpolizeigesetz erstellt werden soll, das deutschlandweit einheitliche Sicherheitsstandards enthält (Quelle: Beck-Online aktuell, 14. Juni 2017).
1.1.2 Der Träger der Aufgaben
5
Die Aufgabe der Polizei ist Angelegenheit des Staates. So formulierte es bereits das PVG in seinem § 1. Das HSOG 1964 stellte in § 55 klar: „Die polizeiliche Gefahrenabwehr ist Angelegenheit des Landes“. Im HSOG 1990 und deren Neufassungen 1994 und 2005 lautet die Überschrift des § 81: „Gefahrenabwehr als staatliche Aufgabe“.
1.2 Die Aufgaben im geltenden Recht
1.2.1. Die Gefahrenabwehr als Aufgabe des Staates
6
Die Gefahrenabwehr ist nach § 81 HSOG eine Aufgabe des Staates. Damit kommt die Verantwortlichkeit des Staates für die innere Sicherheit zum Ausdruck (vgl. Pausch/Dölger, S. 41). In der Bundesrepublik Deutschland sind die Bundesländer grundsätzlich für die Gefahrenabwehr zuständig. Das ergibt sich aus Art. 30 und Art. 70 GG, wonach die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben und das Recht der Gesetzgebung Sache der Länder ist, soweit das Grundgesetz keine anderen Regelungen trifft.
Der Bund hat daher nur ausnahmsweise Zuständigkeiten im Bereich der Gefahrenabwehr, die für den polizeilichen Bereich insbesondere im Bundespolizeigesetz (BPolG) und im Bundeskriminalamtgesetz (BKAG) zusammengefasst sind. Der Bundespolizei obliegen z. B. die Aufgaben des Grenzschutzes, der Bahnpolizei und der Luftsicherheit (vgl. §§ 2, 3 und 4 BPolG). Das Bundeskriminalamt ist insbesondere die Zentralstelle für das polizeiliche Auskunfts- und Nachrichtenwesen (vgl. § 2 Abs. 1 BKAG) und kann nach Maßgabe des § 5 BKAG die Aufgabe der Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus wahrnehmen.
In Hessen sind die Gefahrenabwehrbehörden (GAB) und die Polizeibehörden (PB) mit der Gefahrenabwehr als gemeinsame Aufgabe betraut worden (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 1 HSOG). Damit wird ein Grundsatz zum Ausdruck gebracht, der insbesondere in der Zusammenarbeit (vgl. RN 27) konkretisiert wird. Er bedeutet nicht, dass beide Behörden stets zusammen tätig werden müssen. GAB, das sind die Verwaltungsbehörden und die Ordnungsbehörden (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 1 HSOG). Die GAB sind zum überwiegenden Teil kommunale Behörden (vgl. Art. 137 HV). Die Behörden des Landes haben Weisungsrechte (vgl. §§ 84 und 87 HSOG). Näheres zur Organisation und Zuständigkeit der GAB und der PB, vgl. RN 45 ff.
Die Aufgaben sind von den Befugnissen zu unterscheiden. Zur Erfüllung der Aufgaben, die Eingriffe (vgl. RN 111) erfordern, stehen den GAB und d...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Vorwort
- Inhalt
- Abkürzungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- 1. Gefahrenabwehr als Aufgabe des Staates
- 2. Die Organisation und Zuständigkeiten der Gefahrenabwehrbehörden
- 3. Die Organisation und die Zuständigkeiten der Polizeibehörden
- 4. Die Befugnisse der Gefahrenabwehrbehörden und der Polizeibehörden
- 5. Der Verwaltungszwang
- 6. Schadensausgleich
- Stichwortverzeichnis