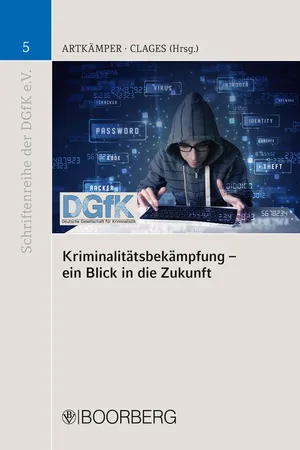
eBook - ePub
Kriminalitätsbekämpfung - ein Blick in die Zukunft
- 379 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Kriminalitätsbekämpfung - ein Blick in die Zukunft
Über dieses Buch
Kriminalität bekämpfen - jetzt und in Zukunft
Der Titel "Kriminalitätsbekämpfung" behandelt zahlreiche Phänomene, die sich in einer Zeit grundlegender weltpolitischer Veränderungen auch im Kriminalitätsgeschehen widerspiegeln. Alle 17 Beiträge lassen sich komplexen Taktiken der aktuellen und zukünftigen Kriminalitätsbekämpfung zuordnen.
Digitale Vernetzung und neue Forschungsergebnisse
Die Bandbreite reicht von der digitalen Vernetzung als fundamentale Grundlage heutiger kriminalistischer Arbeit über Spezifizierungen im internationalen organisierten kriminellen Feld bis hin zur globalen Kriminalität.
Die Beiträge behandeln neue Erkenntnisse aus kriminologisch-kriminalistischen Forschungen zu Mordmotiven und den Schwierigkeiten, Morde aufzuklären, sowie Themen wie z.B.
• Jugenddelinquenz,
• polizeilicher Einsatz gegen Einbruchdiebstähle,
• Ermittlungserschwernisse in Ost- und Südosteuropa,
• Ehrverbrechen,
• Spannungsverhältnis zwischen Ermittlungsbeamten und Strafverteidigung sowie
• digitale Daten im persönlichen Umfeld.
Die aktuellen Kriminalistik-Erfahrungen aus der Schweiz und Überlegungen zu ethischen Problemstellungen der Kriminalistik runden die hochinteressante Palette ab.
Mit ausführlichem Autorenverzeichnis sowie einem Vorwort von Prof. Dr. Armin Forker.
Über die Reihe
Die Bände der Schriftenreihe enthalten Sammlungen verschiedener aktueller Themen, die die komplexe Bandbreite der Kriminalistik wiedergeben.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Kriminalitätsbekämpfung - ein Blick in die Zukunft von Heiko Artkämper, Horst Clages, Heiko Artkämper,Horst Clages im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Jura & Strafrecht. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
JuraThema
StrafrechtErmittlungsbeamte und Strafverteidigung im Konflikt
Von Andy Neumann
Vorwort
1. Grundsätzliches zur möglichen Interaktion
2. Klischee und Realität – Rollenbilder im Fokus
2.1 Das Feindbild – ein altes, neues Klischee
2.2 Die Rollenbilder in der modernen Realität
2.2.1 Verteidigung ist Kampf!?
2.2.2 Verteidigerpersönlichkeiten und Verteidigungsstile
2.2.3 Das (kriminal-) polizeiliche Rollenverständnis
3. Der „Grundkonflikt“ zwischen Polizei und Strafverteidigung
4. Die Kooperation als logische Folge?
5. Konfliktpotenziale und deren Vermeidung
5.1 Der Konflikt im Ermittlungsverfahren
5.2 Der Polizeibeamte als Zeuge vor Gericht
5.2.1 Das Auftreten des Polizeibeamten
5.2.2 Der Regelfall des konsensualen Verteidigerverhaltens
5.2.3 Das Problem der unterschiedlichen Wahrheitsbegriffe
6. „Konflikt-“, „Chaos-“ oder „Klamaukverteidigung“? Eine Begriffsanalyse
7. Konflikt provozierendes Verteidigerverhalten und mögliche Reaktionen
Vorwort
„Der Strafverteidiger ist der Feind!“ Aussagen wie diese sind bei Kriminalbeamten eher die Norm als die Ausnahme und fußen in der Tat auf so mancher Begegnung, die man seinem ärgsten Feind nicht wünschen würde. Störversuche im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen, Einschüchterung, konsequente Ablehnung jeglicher Kooperation der Mandanten, stundenlange, die Grenzen des persönlichen Angriffs überschreitende Befragungen im Gerichtssaal; Beispiele, die begründen, warum Ermittler allgemein nicht gut auf Strafverteidiger zu sprechen sind, gibt es auf jeder Polizeidienststelle zuhauf.
Aber was steckt hinter diesen Beispielen? Wie viel Konfliktpotenzial zwischen Ermittlern und Strafverteidigern gibt es tatsächlich? Wie viel davon ist gewollt, sozusagen „systemimmanent“, und wie viel liegt in der Person des Einzelnen begründet? Und, bezogen auf die Ermittler: Welche Möglichkeiten, diese Konflikte zu vermeiden, sie zu beeinflussen oder ihnen zu begegnen, hat man? Mit diesen und anderen Fragen setzte sich der Autor, basierend auf einer historischen, verfassungsrechtlichen und strafprozessualen Betrachtung der Rolle von Strafverteidigung in Deutschland (nicht Bestandteil der folgenden Ausführungen), im Rahmen seiner Masterthesis 2010 auseinander.
Grundlage waren neben einer umfassenden Literaturrecherche auch vier Experteninterviews197 mit je einem Strafverteidiger, Kriminalbeamten, Richter und Staatsanwalt. Zentraler Knackpunkt der Thesis war der „Konfliktbegriff“ an sich. „Konfliktbehaftete Situationen“ zwischen Polizei und Strafverteidiger sind nämlich mitnichten nur solche, in denen es zu verbalen Attacken oder Zwangsmaßnahmen kommt. Sie liegen vielmehr bereits dann vor, wenn beide Akteure aufgrund ihrer jeweiligen Rolle konkurrierende Ziele verfolgen und unterschiedlich handeln (müssen).
Die Ausprägung dieser Konflikte wird vom Rollenbild des Strafverteidigers, aber auch dem Verteidigertypus und -stil geprägt, welche im Folgenden näher behandelt werden.
1. Grundsätzliches zur möglichen Interaktion
Die folgenden Erörterungen sind auf Interaktionen begrenzt, die im Rahmen repressiver Tätigkeit erfolgen. Zwar bietet auch die präventive Aufgabenerledigung der Polizei Berührungspunkte mit Rechtsanwälten; entsprechende Besonderheiten konnten jedoch nicht berücksichtigt werden.
Das polizeiliche Handeln im repressiven Bereich spielt sich überwiegend im Vorverfahren bzw. Ermittlungsverfahren ab. Darüber hinaus besteht jedoch bis zum Abschluss des Hauptverfahrens die Möglichkeit, dass, z. B. aufgrund von Beweisanträgen, weitere Ermittlungshandlungen durchgeführt werden müssen.
Hinsichtlich des Kontakts zu Strafverteidigern gilt es aus polizeilicher Sicht zunächst zwischen zwei Stadien der Ermittlungstätigkeit zu unterscheiden: Der „verdeckten“ und der „offenen Phase“.
Solange der Beschuldigte nicht weiß, dass gegen ihn ermittelt wird, werden regelmäßig „verdeckte Maßnahmen“ wie TKÜ oder Observation durchgeführt.198 Im entsprechenden Zeitraum verbietet sich jegliche Information des Beschuldigten oder seines Verteidigers. Sofern der Beschuldigte ohnehin bereits über das Ermittlungsverfahren informiert ist, spätestens aber nach Eintritt in die „offene Phase“ (oftmals in Verbindung mit Durchsuchungsmaßnahmen/Vernehmungsversuchen) besteht die Möglichkeit der Einbindung eines Verteidigers als Beistand des Beschuldigten.
Kontakte mit Strafverteidigern sind also zu erwarten, sobald Ermittlungen geführt werden, von deren Existenz der Beschuldigte Kenntnis hat. Dies gilt unabhängig davon, dass die Polizei in repressiver Funktion lediglich „Helferin der Staatsanwaltschaft“ und insofern die Staatsanwaltschaft als „Herrin des Verfahrens“ und Anklagebehörde eigentliche Ansprechpartnerin des Verteidigers ist. Die Kapazitäten der Staatsanwaltschaften sind schlichtweg nicht dazu geeignet, an sämtlichen Ermittlungshandlungen teilzunehmen, so dass es vielfach der Polizei obliegt, mit anwesenden Verteidigern umzugehen, auch wenn die Staatsanwaltschaften sich mitunter zunehmend in die Ermittlungen einbringen.
Reflektiert man die eher spärlichen Rechte der Verteidiger im Ermittlungsverfahren, wird deutlich: Solange eine Gefährdung des Ermittlungserfolges bejaht werden muss, bleibt das Ermittlungsverfahren „Domäne der Strafverfolgungsbehörden“199. Sämtliche Beteiligungsmöglichkeiten der Verteidiger unterliegen dem Ermessen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Möglichkeiten zur Einflussnahme, etwa bei Durchsuchungen oder Vernehmungen, sind minimal, entsprechende Versuche jederzeit zu unterbinden.
Schulz hält es im Interview aus Verteidigersicht folglich für „das Klügste“, bis zur Hauptverhandlung abzuwarten, „was an belastenden Ermittlungsergebnissen generiert wird“. Demzufolge bleiben Begegnungen mit Strafverteidigern bis zum Abschluss der Ermittlungen eher die Ausnahme.
In der Hauptverhandlung kommt es schließlich zu einem klaren Bruch in der Interaktion zwischen Polizeibeamten und Strafverteidigern. Während der Polizist bis dahin der Staatsanwaltschaft als direkter Verfahrensbeteiligten „dient“, wird er im Rahmen der Hauptverhandlung faktisch in eine andere Rolle gedrängt und selbst zum Verfahrensbeteiligten – in der Funktion als Zeuge.
Aus dieser Besonderheit resultiert in Fällen, bei denen Ermittlungsverfahren zur Anklage und Eröffnung der Hauptverhandlung führen, eine Begegnung mit dem Strafverteidiger, die unter völlig anderen Vorzeichen als bei vorheriger Interaktion erfolgt. Denn zum einen hat er aufgrund seiner Pflicht zum Erscheinen nicht die Möglichkeit, der Begegnung auszuweichen. Zum anderen sieht sich der Polizist vor Gericht einem Verteidiger gegenüber, der mit seinen dortigen Rechten, den umfänglich vorliegenden Informationen und dem „Heimvorteil“ vor Gericht mindestens auf Augenhöhe agiert. Die damit einhergehende kritische Überprüfung „hinsichtlich der Arbeit, die er geleistet hat“ ist zudem ein Vorgang, den Polizeibeamte „erfahrungsgemäß nicht mögen“ (Kröschel).
Polizisten müssen demnach lernen, unter völlig verschiedenen Bedingungen mit Strafverteidigern umzugehen. Im Verlauf des (offenen) Ermittlungsverfahrens, wo sie unbestritten „Chef im Ring“ sind; und im Zeugenstand im Rahmen der Hauptverhandlung, in der sie mitunter „den Verteidigern […] zum Fraß vorgeworfen“ (Breidling) werden.
Wenn auch diese überspitzte Beschreibung bewusst die Extreme andeutet, ist nicht von der Hand zu weisen, dass allein die Möglichkeit beider Seiten, die wechselseitigen Machtverhältnisse auszunutzen, Konfliktpotenzial birgt.
Soweit derartige Szenarien weitgehend vermieden werden, hängt dies nicht zuletzt mit dem gebotenen Verständnis füreinander und der Objektivität der jeweiligen Aufgabenerledigung zusammen.
2. Klischee und Realität – Rollenbilder im Fokus
2.1 Das Feindbild – ein altes, neues Klischee
„Als ich angefangen habe, war der Polizeibeamte der Feind“, konstatiert der Berliner Rechtsanwalt Schulz, auf sein persönliches Bild vom Polizeibeamten hin befragt. Er relativiert dieses Bild aufgrund seiner Erfahrungen aus den letzten 20–25 Jahren und kann für sich dieses Polizei-Verständnis auf „pubertäre Wahrnehmungen“ in der „Post-68er- Generation“ zurückführen. Er führt aus, dass aus seiner Sicht eine Veränderung im gegenseitigen Rollenverständnis stattgefunden habe, schränkt jedoch ein, dass es Kollegen gebe, die Polizisten nach wie vor als „Repräsentanten einer Unrechtsjustiz“ betrachten.
„Für den Polizisten scheint der Verteidiger oftmals der ‚geborene Feind‘ zu sein“, erklärt wiederum StA-Gruppenleiter Artkämper aus Dortmund. Er kritisiert, ihnen fehle teilweise die nötige Neutralität, und stellt fest, dass Polizisten dazu neigten, ihre Ermittlungsverfahren „sehr persönlich zu nehmen“. Das Feindbild resultiere insbesondere daraus, dass Polizisten im Rahmen der Hauptverhandlung durch Strafverteidiger konsequent mit ihren Fehlern konfrontiert würden. Er schildert ausführlich, in welcher Deutlichkeit derartige Fehler zutage treten können und schließt: „Wenn ich solche Erfahrungen in der Hauptverhandlung mache, wenn ich so ‚vorgeführt‘ werde, dann ist es, glaube ich, relativ klar, warum es dort ein gewisses Feindbild gibt.“
BKA- Ermittler Kröschel antwortet auf die Frage nach einer Positionierung zum Bild des Strafverteidigers als „Feind“ des Polizeibeamten: „Das ist falsch und entspricht einer naiven Denkvorstellung“. Er spricht von aktuellen Beispielen, wonach es „auch Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verteidiger geben kann“ und merkt an, dass es ohnehin „nahezu keine Kommunikation zwischen Verteidigern und Polizei im Laufe des Ermittlungsverfahrens“ mehr gebe. Er räumt jedoch ein, dass der Polizeibeamte mitunter „in dem Verteidiger eine Person sieht, die seine Ermittlungen behindert oder die Rechte des Angeklagten […] über Gebühr in Anspruch nimmt“.
Verständnis für beide Positionen äußert der ehemals Vorsitzende Richter am Düsseldorfer OLG Breidling. Er differenziert beim Verhältnis zwischen Verteidigern und Polizeibeamten zwischen „unterschiedlichen [regionalen] Ebenen“ und verweist auf den „härteren Kampf“, der bei örtlichen Polizeidienststellen geführt werde, wo Beamte im Rahmen der Hauptverhandlung mitunter „prozessual misshandelt“ würden. Das Feindbild baue sich in solchen Fällen „ganz zwangsläufig“ auf und werde auch dort mitgetragen, wo „man ihm an anderer Stelle begegnet“. Aus der Sicht vieler Polizeibeamter sei der Verteidiger daher „ein natürlicher Feind, zumindest aber eine Institution, die einer schnellen und gerechten Bestrafung im Wege steht“.
Das Verhältnis zwischen Polizei und Strafverteidiger scheint also auch im Auge des Betrachters zu liegen; unterschiedliche Erfahrungen, gesellschaftliche Prägung oder das Aufgreifen gängiger Klischees können ausschlaggebend dafür sein, ob das Gegenüber z. B. als „Feind“ wahrgenommen wird oder nicht.
Das Verhältnis beider Akteure scheint sich zwar mit zunehmender Qualifikation und professioneller Arbeitsauffassung zu verbessern.200 Es liegt jedoch in der Natur des Zwischenmenschlichen, dass Sachlichkeit, Unvoreingenommenheit und Professionalität weder auf polizeilicher Seite noch von Strafv...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Geleitwort
- Inhalt
- Ehrensache(n): Ehrverbrechen – Zwangsverheiratungen und Ehrenmord
- Der Einsatz von Mantrailern bei Kapitaldelikten
- Die Besonderheit von Obduktionen nach Alleinunfällen aus rechtlicher und ethisch-moralischer Sicht
- Durch Ideologie zum Terrorismus. Salafismus und Radikalisierung von „Homegrown Terrorists“
- Opfer, Ermittler und Justiz: Einordnung und Bewertung traumarelevanter Aspekte im Ermittlungs- und Strafverfahren
- Analysen von großen und komplexen Datenmengen
- Raubüberfälle auf Geldinstitute durch alleinhandelnde Täter
- Kriminalistik und Ethik
- Ermittlungen in Ost- und Südosteuropa
- Kindesmisshandlung – Möglichkeiten des Erkennens aus rechtsmedizinischer und kriminalistischer Sicht unter Berücksichtigung des Projekts RISKID
- Ermittlungsbeamte und Strafverteidigung im Konflikt
- Kriminalistik in der Schweiz
- Polizeiarbeit heute Mehr und mehr eine Frage der Legitimität
- Digitale Daten im persönlichen Umfeld – Fakten‑basierte Entscheidungsfindung im Bereich der Sicherheit
- Raubüberfälle in Österreich
- Globale Kriminalität – Claims Counter Fraud Management eines Globalen Versicherers
- Schwachstellen Mensch und Schloss beim Schutz von Objekten
- Preis der DGfK
- Stichwortverzeichnis
- Reihenanzeigen
- Neuerscheinungen