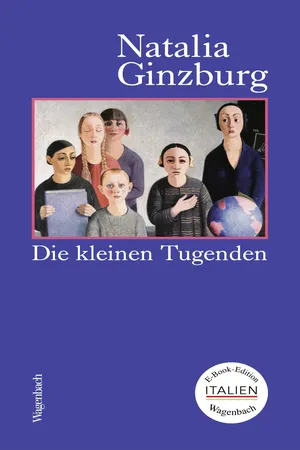
- 160 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Die kleinen Tugenden
Über dieses Buch
Diese Texte über ihre prägenden Lebenserfahrungen gehören zum Persönlichsten, was Natalia Ginzburg je geschrieben hat: Die Autorin hat sie für diesen Band selbst zusammengestellt.
Sie erzählt von der Verbannung ihrer Familie in das abruzzesische Bergdorf, die mit der Ermordung ihres Mannes Leone durch die Nazis in Rom endet; von der verzweifelten Zeit nach der Befreiung, in der Natalia nicht weiß, was mit dem Leben anzufangen sei; von ihrer Freundschaft zu Cesare Pavese, ihrem Leben mit dem Anglistikprofessor Gabriele Baldini und der gemeinsamen Zeit mit ihm in England, das ihr das traurigste Land der ganzen Welt zu sein scheint.
Ob sie über ihren Beruf, das Schweigen, die menschlichen Beziehungen oder die großen und kleinen Tugenden schreibt, Natalia Ginzburg gelingt es stets, Lebensstoff so zu gestalten, dass große Literatur entsteht.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Information
Zweiter Teil
DES MENSCHEN SOHN
Es ist Krieg gewesen und die Leute haben viele Häuser einstürzen sehen und fühlen sich jetzt nicht mehr so ruhig und sicher in ihren Wohnungen wie früher. Da ist etwas, wovon man sich nicht erholt, und die Jahre werden vergehen, aber wir werden niemals genesen. Selbst wenn wir wieder eine Lampe auf dem Tisch haben und ein Blumenväschen und die Bilder unserer Lieben, glauben wir doch an keines dieser Dinge mehr, weil wir sie einmal plötzlich verlassen mußten oder vergeblich unter den Trümmern danach gesucht haben.
Es ist zwecklos zu glauben, daß wir genesen können von zwanzig Jahren wie denen, die wir erlebt haben. Wer von uns ein Verfolgter war, wird nie mehr Frieden finden. Ein nächtliches Sturmklingeln kann nichts anderes bedeuten für uns als das Wort »Polizeipräsidium«. Und es ist zwecklos, uns selbst immer wieder zu sagen, daß hinter dem Wort »Polizeipräsidium« jetzt vielleicht freundliche Gesichter sind, die wir um Schutz und Beistand bitten können. In uns erzeugt jenes Wort immer Mißtrauen und Schrecken. Wenn ich meine schlafenden Kinder betrachte, denke ich mit Erleichterung, daß ich sie nicht nachts werde aufwecken müssen, um zu flüchten. Aber es ist keine völlige und tiefgreifende Erleichterung. Es kommt mir immer so vor, als werden wir eines Tages doch wieder nachts aufstehen müssen und flüchten, und alles hinter uns lassen, stille Zimmer und Briefe und Erinnerungen und Kleider.
Einmal erlitten, vergißt man die Erfahrung des Bösen nicht mehr. Wer die Häuser hat einstürzen sehen, weiß zu genau, welch unbeständige Güter die Blumenvasen, die Bilder, die weißen Wände sind. Er weiß zu gut, woraus ein Haus gemacht ist. Ein Haus besteht aus Ziegelsteinen und Mörtel, und es kann einstürzen. Ein Haus ist nicht sehr solide. Von einem Augenblick zum anderen kann es einstürzen. Hinter den heiteren Blumenväschen, hinter den Teekannen, den Teppichen, den gewachsten, gebohnerten Fußböden verbirgt sich das andere, wahre Gesicht des Hauses, das entsetzliche Gesicht des eingestürzten Hauses.
Wir werden nicht mehr von diesem Krieg genesen. Es ist zwecklos. Wir werden nie mehr unbeschwerte Menschen sein, Menschen, die denken und studieren und in Frieden ihr Leben ordnen. Ihr seht, was man aus unseren Häusern gemacht hat. Ihr seht, was man aus uns gemacht hat. Wir werden nie mehr ruhige, gelassene Menschen sein.
Wir haben die Wirklichkeit von ihrer finstersten Seite kennengelernt. Wir empfinden nunmehr keinen Ekel mehr davor. Es gibt noch manche, die sich darüber beklagen, daß die Schriftsteller eine bittere und gewaltsame Sprache benutzen, daß sie harte und traurige Dinge erzählen, daß sie die Wirklichkeit in ihren trostlosesten Aspekten darstellen.
Wir können in den Büchern nicht lügen und wir können bei keiner Sache lügen, die wir tun. Und vielleicht ist dies das einzig Gute, das der Krieg uns gebracht hat. Nicht zu lügen und nicht zu dulden, daß die anderen uns etwas vorlügen. So sind wir jungen Leute jetzt, so ist unsere Generation. Die anderen, die älter sind als wir, sind noch sehr verliebt in die Lüge, in die Schleier und die Masken, mit denen sich die Wirklichkeit verhüllt. Unsere Sprache macht sie traurig und beleidigt sie. Sie verstehen unsere Haltung gegenüber der Wirklichkeit nicht. Wir sind den Dingen in ihrer Substanz nahe. Es ist das einzig Gute, das der Krieg uns gegeben hat, aber nur uns Jungen. Den anderen, die älter sind als wir, hat er nur Unsicherheit und Angst gebracht. Und auch wir Jungen haben Angst, auch wir fühlen uns nicht sicher in unseren Häusern, aber wir sind nicht wehrlos dieser Angst gegenüber. Wir haben eine Härte und eine Kraft, die die anderen vor uns nie gekannt haben.
Für manche hat der Krieg erst mit dem Krieg, mit den eingestürzten Häusern und den Deutschen begonnen, aber für andere hat er früher angefangen, schon in den ersten Jahren des Faschismus, und so ist jenes Gefühl von Unsicherheit und ständiger Gefahr noch größer. Die Gefahr, das Gefühl, sich verstecken zu müssen, das Gefühl, Hals über Kopf die Wärme des Bettes und der Häuser verlassen zu müssen, hat für sehr viele von uns vor vielen Jahren begonnen. Es hat sich in die jugendlichen Vergnügungen eingeschlichen, ist uns auf die Schulbänke gefolgt und hat uns gelehrt, überall Feinde zu sehen. So ist es für sehr viele von uns gewesen, in Italien und anderswo, und man glaubte, daß wir eines Tages in Frieden auf den Straßen unserer Städte würden umhergehen können, aber heute, da wir vielleicht in Frieden umherlaufen könnten, heute bemerken wir, daß wir nicht von diesem Übel genesen sind. So sind wir gezwungen, immer neue Kräfte, immer eine neue Härte zu suchen, die wir jeglicher Wirklichkeit entgegenhalten können. Wir sind angehalten, eine innere Ruhe und Gelassenheit zu suchen, die nicht aus den Teppichen und Blumenväschen erwächst.
Es gibt keinen Frieden für des Menschen Sohn. Die Füchse und die Wölfe haben ihre Höhlen, aber des Menschen Sohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt betten kann. Unsere Generation ist eine Generation von Menschen. Es ist keine Generation von Füchsen und Wölfen. Jeder von uns hätte große Lust, irgendwo sein Haupt zu betten, jeder hätte Lust auf eine trockene und warme kleine Höhle. Aber es gibt keinen Frieden für der Menschen Söhne. Jeder von uns hat sich einmal in seinem Leben vorgemacht, er könne sich auf etwas ausruhen, sich irgendeine Gewißheit aneignen, irgendeinen Glauben, und seine Glieder ruhen lassen. Aber alle Gewißheiten von damals sind uns entrissen worden und der Glaube ist nie etwas, worauf man schließlich einschlafen könnte.
Und wir sind nunmehr Menschen ohne Tränen. Was unsere Eltern rührte, rührt uns überhaupt nicht mehr. Unsere Eltern und die Leute, die älter sind als wir, werfen uns die Art vor, wie wir unsere Kinder großziehen. Sie hätten gern, daß unsere Kinder mit Plüschtieren spielen in anmutigen, rosa gestrichenen Zimmern, in denen Bäume und Häschen an die Wände gemalt sind. Sie hätten gern, daß wir ihre Kindheit mit Schleiern und Lügen umgeben, daß wir ihnen die Wirklichkeit in ihrer wahren Substanz sorgfältig verheimlichten. Aber das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen mit Kindern, die wir nachts aufgeweckt und überstürzt im Dunkeln angekleidet haben, um zu flüchten oder uns zu verstecken oder weil der Sirenenalarm den Himmel zerriß. Das können wir nicht machen mit Kindern, die den Schrecken und das Grauen auf unserem Gesicht gesehen haben. Diesen Kindern können wir nicht mehr erzählen, daß wir sie im Kohlkopf gefunden haben, oder von einem, der gestorben ist, sagen, er sei auf eine lange Reise gegangen.
Es besteht eine unüberbrückbare Kluft zwischen uns und den Generationen vorher. Ihre Gefahren waren gering und ihre Häuser stürzten recht selten ein. Erdbeben und Brände waren keine Ereignisse, die ständig vorkamen und alle betrafen. Die Frauen strickten und bestellten bei der Köchin das Mittagessen und empfingen ihre Freundinnen in Häusern, die nicht einstürzten. Ein jeder dachte nach und studierte und kümmerte sich darum, in Frieden sein Leben zu ordnen. Es war eine andere Zeit und vielleicht ging es den Leuten gut. Wir aber sind an diese unsere Angst gebunden und im Grunde froh über unser Schicksal, Menschen zu sein.
MEIN BERUF
Mein Beruf ist das Schreiben, und das weiß ich genau und seit langer Zeit. Ich hoffe, man mißversteht mich nicht: Über den Wert dessen, was ich schreiben kann, weiß ich nichts. Ich weiß, daß Schreiben mein Beruf ist. Wenn ich zu schreiben anfange, fühle ich mich außerordentlich wohl und bewege mich in einem Element, das ich, so scheint mir, außerordentlich gut kenne: Ich benutze Werkzeuge, die mir bekannt und vertraut sind, und fühle sie fest in meiner Hand liegen. Wenn ich irgend etwas anderes tue, wenn ich eine Fremdsprache erlerne, wenn ich versuche, Geschichte oder Geographie oder Stenographie zu lernen, oder versuche, vor Publikum zu sprechen oder zu stricken oder zu reisen, leide ich und frage mich ständig, wie die anderen eben diese Dinge machen, es kommt mir immer so vor, als müsse es eine richtige Art und Weise geben, diese Dinge zu machen, die den anderen geläufig und mir unbekannt ist. Und es kommt mir so vor, als sei ich taub und blind, und tief innerlich empfinde ich etwas wie Ekel. Wenn ich dagegen schreibe, denke ich nie, daß es vielleicht eine richtigere Art und Weise gibt, derer sich die anderen Schriftsteller bedienen. Es ist mir ganz gleich, wie die anderen Schriftsteller es machen. Verstehen wir uns recht, ich kann nur Geschichten schreiben. Wenn ich versuche, einen kritischen Essay oder einen Zeitungsartikel auf Bestellung zu schreiben, geht es ziemlich schlecht. Was ich dann schreibe, muß ich mir mühsam, wie außerhalb meiner selbst, zusammensuchen. Ich kann es ein bißchen besser als eine Fremdsprache lernen oder vor Publikum sprechen, aber nur ein bißchen. Und ich habe immer den Eindruck, den Nächsten zu betrügen mit geborgten oder hier und da gestohlenen Wörtern. Und ich leide und fühle mich im Exil. Schreibe ich aber Geschichten, bewege ich mich wie einer, der sich in seiner Heimat aufhält, auf den Straßen, die er von klein an kennt, zwischen den Mauern und Bäumen, die seine sind. Mein Beruf ist Geschichten zu schreiben, erfundene Dinge oder Dinge aus meinem Leben, an die ich mich erinnere, aber jedenfalls Geschichten und Dinge, bei denen nicht Bildung, sondern nur Gedächtnis und Phantasie eine Rolle spielen. Das ist mein Beruf, und ich werde ihn bis zu meinem Tod ausüben. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Beruf und würde ihn um nichts auf der Welt wechseln. Daß es mein Beruf ist, habe ich vor sehr langer Zeit begriffen. Zwischen meinem fünften und meinem zehnten Lebensjahr zweifelte ich noch daran und stellte mir abwechselnd vor, malen zu können, zu Pferd fremde Länder zu erobern oder auch neue, sehr wichtige Maschinen zu erfinden. Aber ab zehn habe ich es immer gewußt und mich so gut ich konnte mit Romanen und Gedichten herumgeplagt. Ich besitze diese Gedichte noch. Die ersten sind plump und die Verse falsch, aber recht lustig: doch mit der Zeit verfaßte ich allmählich Gedichte, die immer weniger plump, dafür aber immer langweiliger und idiotischer waren. Allerdings wußte ich das nicht und schämte mich für die plumpen Gedichte, die weniger plumpen, idiotischen dagegen kamen mir sehr schön vor, ich dachte immer, eines Tages würde ein berühmter Dichter sie entdecken, sie veröffentlichen lassen und lange Artikel über mich schreiben, ich stellte mir schon die Wörter und Sätze jener Artikel vor und schrieb sie in meinem Inneren in aller Ausführlichkeit auf. Ich dachte, ich würde den Premio Fracchia erhalten. Ich hatte gehört, es gebe diesen Preis für Schriftsteller. Da ich meine Gedichte nicht als Buch veröffentlichen konnte, weil ich damals keinen berühmten Dichter kannte, schrieb ich sie in Schönschrift in ein Heft und malte ein Blümchen aufs Deckblatt und machte ein Inhaltsverzeichnis und alles, was dazugehört. Es war sehr leicht für mich geworden, Gedichte zu schreiben. Ich schrieb beinahe eins pro Tag. Wenn ich keine Lust zum Schreiben hatte, war mir aufgefallen, brauchte ich nur einige Gedichte von Pascoli oder Gozzano oder Corazzini zu lesen, um sofort Lust zu bekommen. Sie gerieten mir dann je nachdem à la Pascoli, Gozzano oder Corazzini, zuletzt auch sehr à la D’Annunzio, als ich entdeckte, daß es ihn auch gab. Allerdings dachte ich nie, daß ich mein Leben lang Gedichte schreiben würde, früher oder später wollte ich Romane schreiben. Drei oder vier habe ich in jenen Jahren geschrieben. Einer trug den Titel Marion oder das Zigeunermädchen, ein anderer hieß Molly und Dolly (ein humoristischer Kriminalroman) und noch ein anderer hieß Eine Frau (dannunzianisch: in der zweiten Person: Die Geschichte einer Frau, die von ihrem Mann verlassen wurde: Ich weiß noch, daß auch eine schwarze Köchin darin vorkam), und dann gab es noch einen sehr langen und komplizierten mit schrecklichen Geschichten von entführten Mädchen und Kutschen, ich fürchtete mich sogar, daran zu schreiben, wenn ich allein zu Haus war: Ich erinnere mich an nichts mehr, ich weiß nur noch, daß dort ein Satz vorkam, der mir sehr gefiel, und daß sich meine Augen mit Tränen füllten, als ich ihn hinschrieb: »Er sagte: Ah! Isabella geht.« Das Kapitel endete mit diesem Satz, der sehr wichtig war, weil ihn der Mann aussprach, der in Isabella verliebt war, es aber nicht wußte, er hatte es sich selbst noch nicht eingestanden. Ich erinnere mich kaum noch an diesen Mann, mir scheint, er trug einen rötlichen Bart, Isabella hatte lange schwarze Haare mit blauem Schimmer, sonst weiß ich nichts mehr: Ich weiß noch, daß mich lange Zeit ein Freudenschauer überlief, wenn ich mir leise vorsagte: »Ah! Isabella geht.« Ich sagte mir auch oft einen Satz vor, den ich in einem Fortsetzungsroman in der ›Stampa‹ gefunden hatte und der so lautete: »Mörder von Gilonne, wohin hast du mein Kind gebracht?« Doch meiner Romane war ich mir nicht so sicher wie der Gedichte. Wenn ich sie wieder durchlas, entdeckte ich immer eine schwache Seite, etwas Falsches, das alles kaputtmachte und das ich einfach nicht verändern konnte. Eine Weile pfuschte ich immer zwischen Modernem und Altem herum, es gelang mir nicht, sie richtig in einer Zeit anzusiedeln: Einerseits gab es Klöster und Kutschen und einen Hauch von Französischer Revolution, und andererseits gab es Polizisten mit Schlagstöcken; und dann tauchte auf einmal ein graues Kleinbürgertum mit Nähmaschinen und Katzen auf, wie man es in den Büchern von Carola Prosperi findet, und zu den Kutschen und Klöstern paßte das wirklich überhaupt nicht. Ich schwankte zwischen Carola Prosperi, Victor Hugo und den Geschichten von Nick Carter: Ich wußte nicht so recht, was ich wollte. Auch Annie Vivanti gefiel mir sehr. Es gibt einen Satz in Nancy war ein Genie, wenn sie dem Unbekannten schreibt: »Braun ist mein Gewand.« Auch diesen Satz sagte ich mir lange Zeit immer wieder vor. Während des Tages murmelte ich halblaut diese Sätze, die mir so gut gefielen: »Mörder von Gilonne«, »Isabella geht«, »braun ist mein Gewand«, und fühlte mich dabei unermeßlich glücklich.
Gedichte schreiben war leicht. Meine Gedichte gefielen mir sehr, ich hielt sie für fast vollkommen. Ich verstand nicht, welcher Unterschied zwischen meinen und den wahren, veröffentlichten Gedichten der wahren Dichter bestand. Ich verstand nicht, warum meine Geschwister kicherten, wenn ich sie ihnen zu lesen gab, und sie zu mir sagten, ich solle lieber Griechisch lernen. Ich dachte, daß meine Geschwister vermutlich nicht viel von Dichtung verstanden. Unterdessen mußte ich zur Schule gehen und Griechisch, Latein, Mathematik und Geschichte lernen, ich litt sehr und fühlte mich in der Verbannung. Ich verbrachte die Tage damit, meine Gedichte zu verfassen und sie in Hefte abzuschreiben, ich lernte meine Hausaufgaben nicht und stellte mir dann den Wecker auf fünf Uhr früh. Der Wecker klingelte, aber ich wachte nicht auf. Ich erwachte um sieben, wenn keine Zeit mehr blieb zum Lernen, und ich mich anziehen mußte, um zur Schule zu gehen. Ich war nicht zufrieden, hatte immer schreckliche Angst und ein Gefühl von Unordnung und Schuld. Ich lernte in der Schule, in der Lateinstunde Geschichte, in der Geschichtsstunde Griechisch, und immer so weiter, und lernte gar nichts. Ziemlich lange dachte ich, daß es sich lohnte, weil meine Gedichte so schön wären, doch an einem bestimmten Punkt kam mir der Zweifel, sie seien vielleicht gar nicht so schön, und ich fing an, mich beim Schreiben zu langweilen und angestrengt nach Themen zu suchen, und mir schien, als hätte ich schon alle möglichen Themen ausgeschöpft, als hätte ich schon alle Wörter und Reime benützt: speranza – lontananza, pensiero – mistero, vento – argento, fragranza – speranza [Hoffnung – Ferne, Denken – Geheimnis, Wind – Silber, Duft – Hoffnung]. Da begann eine sehr häßliche Zeit für mich, und ich verbrachte den Nachmittag damit, zwischen Wörtern herumzutrödeln, die mir keinerlei Freude mehr bereiteten, mit einem Gefühl von Schuld und Scham, was die Schule betraf; es ging mir nie durch den Kopf, meinen Beruf verfehlt zu haben, schreiben wollte ich unbedingt, nur verstand ich nicht, warum die Tage plötzlich so unfruchtbar und wortarm für mich geworden waren.
Die erste ernsthafte Sache, die ich schrieb, war eine Erzählung. Eine kurze Erzählung, fünf oder sechs Seiten: Wie durch ein Wunder kam sie an einem Abend aus mir heraus, und als ich dann schlafen ging, war ich müde, betäubt und erstaunt. Ich hatte den Eindruck, daß es etwas Ernsthaftes sei, das erste, was ich je gemacht hatte: Die Gedichte und die Romane mit den Mädchen und den Kutschen schienen mir auf einmal sehr weit weg, in einer für immer untergegangenen Epoche, ahnungslose und lächerliche Geschöpfe eines anderen Lebensalters. In dieser neuen Erzählung gab es Personen. Isabella und der Mann mit dem rötlichen Bart waren keine Personen: Ich wußte nichts von ihnen außer den Sätzen und Wörtern, die ich in bezug auf sie benutzt hatte, und sie waren dem Zufall und der Willkür meiner Laune ausgesetzt. Die Wörter und Sätze, die sich auf sie bezogen, hatte ich aufs Geratewohl herausgefischt: Es war, als hätte ich einen Sack gehabt und bald einen Bart, bald eine schwarze Köchin herausgezogen oder etwas anderes, das man verwenden konnte. Diesmal dagegen war es kein Spiel gewesen. Diesmal hatte ich Personen erfunden, deren Namen zu ändern mir nicht möglich gewesen wäre: Nichts an ihnen hätte ich ändern können, und ich wußte eine Menge Einzelheiten über sie, ich wußte, wie ihr Leben bis zum Tag meiner Erzählung verlaufen war, auch wenn ich in der Erzählung nicht darüber gesprochen hatte, weil es nicht nötig gewesen war. Und ich wußte alles über das Haus und die Brücke und den Mond und den Fluß. Ich war damals siebzehn Jahre alt und in Latein, Griechisch und Mathematik durchgefallen. Ich hatte sehr geweint, als ich es erfuhr. Aber jetzt, nachdem ich die Erzählung geschrieben hatte, schämte ich mich etwas weniger. Es war Sommer, eine Sommernacht. Das Fenster stand zum Garten hin offen, und dunkle Falter flogen um die Lampe. Ich hatte meine Erzählung auf kariertes Papier geschrieben und mich so glücklich gefühlt wie noch nie in meinem Leben, reich an Gedanken und an Wörtern. Der Mann hieß Maurizio und die Frau hieß Anna und das Kind hieß Villi, und es gab auch die Brücke und den Mond und den Fluß. Diese Dinge lebten in mir. Und der Mann und die Frau waren weder gut noch schlecht, sondern komisch und ein wenig bedauernswert, und ich meinte damals zu entdecken, daß die Leute in den Büchern immer so sein müßten, komisch und bedauernswert zugleich. Diese Erzählung erschien mir schön, von welcher Seite ich sie auch betrachtete: Sie hatte keinen Fehler. Alles geschah zur rechten Zeit, im richtigen Augenblick. Jetzt kam es mir vor, als könnte ich Millionen von Erzählungen schreiben.
Und ich habe wirklich eine gewisse Anzahl geschrieben, im Abstand von ein bis zwei Monaten, manche ganz schön und manche nicht. Damals habe ich entdeckt, daß es einen ermüdet, wenn man ernsthaft etwas schreibt. Es ist ein schlechtes Zeichen, wenn man nicht müde wird. Man kann nicht hoffen, so leichthin etwas Ernsthaftes zu schreiben, mit einer Hand, wie unbeschwert, lebhaft dahinflatternd. Man kann nicht mit so wenig davonkommen. Wenn man etwas Ernsthaftes schreibt, fällt man hinein, man versinkt darin bis zu den Augen; und wenn man sehr starke Gefühle hat, die einen im Herzen bewegen, wenn man sehr glücklich oder sehr unglücklich ist aus irgendeinem, sagen wir irdischen Grund, der überhaupt nichts mit der Sache zu tun hat, die man gerade schreibt, dann schläft, wenn das, was man schreibt, etwas wert ist und zu bestehen verdient, jedes andere Gefühl in einem ein. Man kann nicht hoffen, sein teures Glück oder sein teures Unglück unberührt und frisch zu bewahren, alles entgleitet einem und vergeht, man ist allein mit seiner geschriebenen Seite, kein Glück und kein Unglück kann in einem fortbestehen, das nicht eng mit dieser Seite verknüpft ist, man besitzt nichts sonst und gehört niemandem sonst an, und geht es einem nicht so, dann ist es ein Zeichen, daß die Seite nichts wert ist.
Ich habe also eine bestimmte Zeit lang kurze Erzählungen geschrieben, eine Zeit, die etwa sechs Jahre dauerte. Da ich entdeckt hatte, daß es Figuren gab, schien mir, eine Figur zu haben genüge, um eine Erzählung zu machen. So war ich stets auf der Jagd nach Figuren, ich beobachtete die Leute in der Trambahn und auf der Straße, und wenn ich ein Gesicht fand, das in eine Erzählung hineinzupassen schien, wob ich darum herum moralische Eigenschaften und eine kleine Geschichte. Ich machte auch Jagd auf Einzelheiten der Kleidung und des Äußeren von Menschen, oder der Räume von Häusern oder der Orte; wenn ich ein neues Zimmer betrat, bemühte ich mich, es in Gedanken zu beschreiben, und bemühte mich, eine winzige Besonderheit zu finden, die gut in eine Erzählung passen würde. Ich hatte ein Notizbuch, in das ich gewisse Besonderheiten hineinschrieb, die ich entdeckt hatte, oder kleine Vergleiche oder Episoden, von denen ich mir vornahm, sie in den Erzählungen unterzubringen. In das Notizbuch schrieb ich zum Beispiel folgendes: »Er kam aus dem Bad und zog wie einen langen Schwanz die Kordel des Bademantels hinter sich her.« – »›Wie das Klo in dieser Wohnung stinkt‹, sagte das...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Impressum
- Erster Teil
- Zweiter Teil
- Editorische Notiz der Autorin
- Über die Autorin
- Lesen Sie weiter!
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Ja, du hast Zugang zu Die kleinen Tugenden von Natalia Ginzburg, Maja Pflug im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Literatur Allgemein. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.