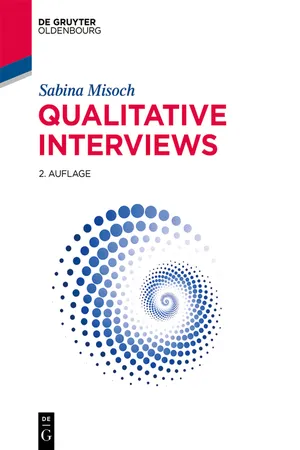1.1Empirische Sozialforschung: quantitativ und qualitativ
Empirische Sozialforschung hat zum Ziel, Aussagen über die Struktur und Beschaffenheit der uns umgebenden sozialen Wirklichkeit zu machen. Mit einer empirischen Untersuchung wird eine systematische und regelgeleitete Analyse eines bestimmten Wirklichkeitsausschnittes anhand des Einsatzes bestimmter Erhebungstechniken durchgeführt. Erhebungstechniken können dabei Befragungen, (Labor-)Experimente oder Beobachtungen sein, d. h. die Daten des zu untersuchenden Ausschnittes der sozialen Realität können anhand des Einsatzes von reaktiven (Befragung, Experiment) oder nicht-reaktiven Methoden (Beobachtung) gewonnen werden.
Solche systematischen Formen der Datenerhebung werden als empirische Sozialforschung bezeichnet. Diese hat sich im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts aus verschiedenen Vorgängerdisziplinen heraus entwickelt. Als wichtigste Vorgängerdisziplinen sind hierbei die Politische Arithmetik und die Bevölkerungs- und Sozialstatistik zu nennen, die bereits im 17. Jahrhundert vorzufinden waren (älteste Belege zu Datenerhebungen finden sich bereits im Ägypten des 2. Jahrhunderts). Durch die im 18./19. Jahrhundert sich vollziehende Entwicklung von agrarischen zu industriellen Gesellschaften und durch die mit der Industrialisierung und Verstädterung einhergehenden Probleme der Verelendung kam es im Rahmen der „sozialen Frage“ zu einem Aufschwung der empirischen Sozialforschung: Es wurden groß angelegte sozialstatistische Untersuchungen durchgeführt, von denen man sich Erkenntnisse für eine erfolgreiche Armutsbekämpfung erhoffte. Die heutige moderne, wissenschaftlich-systematisch betriebene empirische Sozialforschung hat sich aber erst im 20. Jahrhundert herausgebildet und nach und nach institutionalisiert (siehe hierzu u. a. Schnell et al., 2013).
Die empirische Sozialforschung als Sammlung verschiedener Techniken und Methoden zur wissenschaftlichen Untersuchung sozialer Phänomene kann ihrerseits in zwei zentrale Zugänge differenziert werden, die als quantitative und qualitative Sozialforschung bezeichnet werden.
Quantitative Zugänge haben zum Ziel – um es pointiert zum Ausdruck zu bringen –, anhand von möglichst repräsentativ gewonnenen empirischen Daten quantifizierbare, d. h. statistisch auswertbare und verallgemeinerbare Aussagen machen zu können. Im Zentrum des Forschungs- und Erkenntnisinteresses stehen Analysen von Kausalzusammenhängen, deduktive Prozesse und somit die Ermöglichung von „objektiven“ Aussagen über die soziale Realität sowie die Hypothesenüberprüfung. Das Subjekt wird zumeist nicht in seiner Ganzheit, sondern als Merkmalsträger bestimmter Variablen untersucht, die anhand konkreter Operationalisierungen einer empirischen Messung zugänglich gemacht werden. Unabdingbare Parameter quantitativer Forschung sind die Messbarkeit von Phänomenen sowie deren vorherige Operationalisierung, eine möglichst klare Isolierung von Ursache und Wirkung mit dem Ziel der Verallgemeinerung der an Stichproben ermittelten Aussagen.
Qualitative Forschung hingegen hat zum Ziel, bestimmte soziale Phänomene einer tiefen und differenzierten Analyse zu unterziehen; das Vorgehen ist dabei – in klarer Abgrenzung zu den quantitativen Zugängen – zumeist induktiv und hypothesen- und/oder theoriegenerierend. Es sollen subjektive Wirklichkeiten und subjektive Sinnkonstruktionen und Alltagstheorien untersucht, Lebenswelten von innen heraus beschrieben, individuelle Sichtweisen und Meinungen oder Motive analysiert werden. Dies alles mit dem Ziel, diese nicht nur detailliert zu beschreiben, sondern verstehend nachvollziehen zu können. Repräsentativität wird nicht im statistischen, sondern im inhaltlichen Sinne realisiert (vgl. hierzu Kap. 7.3). Das Subjekt wird, ohne Reduktion auf Einzelvariablen, in seiner Ganzheit betrachtet und die Daten werden in sozialen Interaktionen (mittels Kommunikation) erhoben.
Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen: Wenn das Untersuchungsfeld die Internetnutzung Jugendlicher darstellt, so könnten Fragestellungen quantitativ orientierter Forschungsprojekte darin liegen, empirisch zu ermitteln, wie viele Jugendliche welche Dienste und Anwendungen im Internet nutzen, wie sich diese Nutzung z. B. zeitlich verteilt oder welche (psycho-)sozialen Parameter mit bestimmten Nutzungsweisen korrelieren. Es handelt sich somit vornehmlich um Fragestellungen, die darauf abzielen, statistische Zusammenhänge zu ermitteln, die numerisch dargestellt werden können. Demgegenüber wäre ein Ansatz qualitativer Forschung in diesem Forschungsthema die Frage, wie genau sich die Nutzung gestaltet oder warum bestimmte Dienste und Anwendungen genutzt werden. Das Erkenntnisinteresse richtet sich hier auf die individuellen Sinnzuschreibungen der Internetnutzung, aber Fragestellungen qualitativer Forschungsprojekte können sich beispielsweise auch auf die Rolle der Mediennutzung im Lichte der eigenen Biografie und des eigenen Lebenslaufs beziehen.
Qualitative Forschung ist durch folgende Kriterien gekennzeichnet:
–Phänomene sollen von „innen heraus“, aus der Sicht des Subjekts, verstanden werden;
–Subjektbezogene Forschung;
–Differenzierte Beschreibung von Inhalten und/oder Prozessen;
–Ermittlung individueller Sichtweisen, Einstellungen, Motive, Bedürfnisse usw.;
–Generierung von Hypothesen;
–Erfassung der subjektiven Wirklichkeit und subjektiver Wirklichkeitstheorien (Situationsdeutungen, Handlungsmotive, Alltagstheorien);
–Sinnverstehen, Sinnrekonstruktion;
–Untersuchung eines bisher unbekannten Feldes bzw. Untersuchung bisher unbekannter Sachverhalte;
–Erfassung von Selbstinterpretationen;
–Herausarbeitung von manifesten und ggf. latenten Sinnstrukturen;
–nicht Repräsentativität im statistischen, sondern im exemplarischen Sinne soll erreicht werden; es geht um eine Generalisierung durch Typenbildung.
Qualitative Forschungen nähern sich unter Zuhilfenahme offener und flexibler Methoden an die zu untersuchenden Forschungsbereiche an. Sie erheben unter Einsatz nicht standardisierter Erhebungsinstrumente das Subjektive mit den Zielen des Verstehens und des Nachvollziehens subjektiver Wirklichkeitskonstruktionen, der Analyse der Herstellung von sozialer Realität sowie der (Re-)Konstruktion von Bedeutung (d. h. von Sinn).
Der qualitative und der quantitative Forschungsstrang werden im wissenschaftlichen Diskurs häufig als ein sich ausschließendes Gegensatzpaar angesehen („quali“ versus „quanti“), wobei geltend gemacht wird, dass die dahinterstehenden Paradigmen oftmals unvereinbar seien. Dies überzeugt jedoch nicht, da beide Methoden mit unterschiedlichen Ansätzen dasselbe Ziel haben, nämlich vertiefende Erkenntnisse über die umgebende soziale Realität zu gewinnen. Sie unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie dieses Ziel methodologisch umsetzen und unterscheiden sich in den ihnen zugrunde liegenden Paradigmen, so insbesondere in den Vorstellungen über die soziale Realität, über deren Messbarkeit und über den Umgang mit Subjektivität.
Tab. 1.1: Vergleich qualitativer und quantitativer Methoden (Quelle: eigene Darstellung)
| Quantitativ | Qualitativ |
| Erklären, Darstellen von Ausprägungen bestimmter Merkmale und/oder Merkmalszusammenhänge | Verstehen von bestimmten Merkmalen |
| Gesetz der „großen Zahl“ | Das Subjekt steht im Vordergrund |
| Numerische Relationen | Qualitative Relationen |
| Kausale Beziehungen | Muster erkennen |
| Messen | Sinnverstehen |
| Standardisierung | Offenheit, Flexibilität |
| Ergebnisse sollen Rückschluss auf Grundgesamtheit ermöglichen | Ergebnisse sollen Typenkonstruktion ermöglichen |
| Hypothesenprüfung | Hypothesengenerierung |
| Vergleichbarkeit der Daten | Oftmals explorative Untersuchungen |
| Geschlossenes Vorgehen | Offenes Vorgehen |
| Statisch | Prozessual; gegenstandsbezogen |
| Große Stichproben | Kleine Stichproben |
| Zufallsstichprobe | Gezieltes Sampling; theoretisches Sampling |
Die Auseinandersetzung um die Angemessenheit und Wertigkeit von empirischen Methoden wurde in den Sozialwissenschaften im sogenannten Methodenstreit in den 1960er-Jahren (teil-)öffentlich ausgetragen. Der Konflikt gipfelte u. a. im Positivismusstreit im Jahre 1961. Dabei standen sich zwei Positionen gegenüber, die – etwas verkürzt, vereinfacht und zugespitzt dargestellt – als eine Differenz von erklärenden gegenüber verstehenden Ansätzen beschrieben werden kann und die von außen als Konflikt zwischen quantitativen und qualitativen Methoden wahrgenommen wurde:
–Erklärende Ansätze sind dabei dem Ideal der Naturwissenschaften verpflichtet und wollen „objektive“ Daten erheben. Betrachtet man die Entwicklung in den Sozialwissenschaften, so hatte sich hier zu Beginn hauptsächlich dieser Ansatz und damit die quantitativen Methoden durchgesetzt.
–Verstehende Ansätze sind den Geisteswissenschaften verpflichtet und wollen subjektive Strukturen anhand von hermeneutischen, d. h. interpretativen Verfahren nachvollziehen. Hintergrund ist dabei, dass sich im Subjektiven Gesellschaftliches ablagert und dass sich in konkreten, subjektiven, sich wiederholenden Mustern Gesellschaftliches rekonstruieren lässt. Qualitative Ansätze etablierten sich vor allem seit den 1980er-Jahren.
Auch wenn es heute kaum mehr einen öffentlich ausgetragenen Methodenstreit gibt, so sind z. B. wissenschaftliche Fachzeitschriften häufig entweder dem einen oder dem anderen Ansatz verpflichtet. Nur wenige Zeitschriften publizieren sowohl quantitative als auch qualitative Studien auf hohem Niveau. Auch in der Lehre werden in den Methodenkursen zumeist entweder quantitative oder qualitative Methoden vermittelt und spätestens bei einer Methodenvertiefung müssen sich die Teilnehmenden für das eine oder andere Paradigma entscheiden.
Diese Unterschiedlichkeit löst sich aber dann auf, wenn die Methoden und Paradigmen in ein Verhältnis gesetzt werden zum angestrebten Erkenntnisinteresse. Quantitative Methoden sind ungeeignet für die Fragen qualitativer Forschungsthemen; mit qualitativen Methoden können keine Fragen quantitativer Forschungsthemen beantwortet werden. Sinnvoll eingesetzt, können beide Methoden sich gegenseitig ergänzen und befruchten und damit zu noch tieferen Erkenntnissen führen. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Methodentriangulation (vgl. hierzu 10.3.1, Abschnitt c).
Eine Abkehr von diesem bipolaren Denken zeigt sich im Bereich der Forschungsförderung, sodass Förderinstitutionen zunehmend eine Methodentriangulation einfordern und die Erwartungshaltungshaltung vorliegt, dass der routinierte und seriöse Forscher die Vorteile der beiden methodologischen Ansätze kennt und diese souverän und gewinnbringend im Rahmen der entsprechenden Forschungsfrage miteinander zu kombinieren vermag. In der Forschungspraxis wird dies, wenn nicht durch den Forschenden selbst, so doch häufig durch Forschungskooperationen realisiert, die die Verschränkung von qualitativen und quantitativen Methoden sicherstellt.