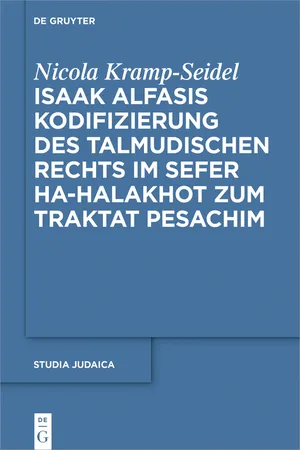Isaak Alfasi (Rif, 1013–1103) gilt als einer der bedeutendsten rabbinischen Gelehrten des Mittelalters und sein Hauptwerk, das Sefer ha-Halakhot, als zentrales Kodifikationswerk, das sowohl im Mittelalter als auch noch in der Neuzeit eine große Wertschätzung erfuhr.2 Dennoch fällt auf, dass Alfasi in der wissenschaftlichen Diskussion nur eine marginale Rolle spielt und nicht den zentralen Stellenwert wie beispielsweise Maimonides erhalten hat. Auf die Diskrepanz zwischen Wertschätzung auf der einen Seite und der wissenschaftlichen Beschäftigung auf der anderen Seite hat bereits Steven Wald hingewiesen.3
1.1 Forschungsstand zum Sefer ha-Halakhot
Kurze Beschreibungen des Sefer ha-Halakhot finden sich in der Literatur zur jüdischen sozialen und religiösen Geschichte, zum jüdischen Recht oder zur jüdischen Literatur. So stellen insbesondere Isaac H. Weiss, Israel M. Ta-Shma, Salo W. Baron, Chaim Tschernowitz und Menachem Elon das Werk in seinem Aufbau vor.4 Sie verweisen auf die Auslassungen praxisirrelevanter Stellen und nennen die Ordnungen und Traktate, aus denen das Sefer ha-Halakhot besteht.5 Sie führen einführende Äußerungen zur Qualität des Werkes sowie zu den Übernahmen aus dem Talmud und zur Verwendung anderer Quellen an, ohne diese anhand von Textbeispielen zu belegen. Neben diesen allgemeinen Einführungen liegen verschiedene ausführliche Untersuchungen des Sefer ha-Halakhot oder bestimmter thematischer Aspekte dieses Kodifikationswerkes vor.
So hat Boaz Cohen 1929 in einem Aufsatz drei von Alfasi auf Arabisch verfasste halakhische Diskussionen zum Traktat Ketubbot untersucht, die Alfasi am Ende seines Werkes angeschlossen hat.6 Neben den drei von ihm dargelegten Diskussionen verweist Cohen auf eine weitere arabischsprachige Abhandlung, die zum Traktat Shebuot vorhanden ist und nach Cohens Angaben von Landauer gedruckt und ins Deutsche übersetzt wurde. In Bezug auf diese von Landauer vorgestellte Diskussion geht Cohen davon aus, dass Alfasi sie zuvor als Erklärung verfasst und später in sein Werk aufgenommen hat. Zu diesem Schluss kommt er aufgrund von Alfasis Formulierung in seinem Trakat Shebuot, wenn Alfasi auf diese Erklärung verweist.7 Cohen stellt die drei Diskussionen vor, druckt ihren arabischen Text ab und übersetzt sie ins Hebräische. Er betont, dass die Diskussionen nicht in reinem Arabisch verfasst seien und man hebräische oder aramäische Übernahmen finden könne. Cohen verweist auf zwei Fälle, bei denen er davon überzeugt ist, dass Alfasi die arabischen Formulierungen „under influence of Rabbinic language“ verwendet hat.8
Shaʾul Shefer hat sich ausführlich mit dem Sefer ha-Halakhot in seiner 1967 veröffentlichten Monographie Ha-Rif u-mishnato auseinandergesetzt. Shefer umreißt zunächst Alfasis Lebensdaten und befasst sich mit dessen Responsa. Im Hinblick auf das Sefer ha-Halakhot führt Shefer neben den sonst in der einführenden Literatur üblichen Feststellungen zum Aufbau des Werkes an einigen Stellen dazugehörige Textbelege an. Zu den nachtalmudischen Quellen, die Alfasi verwendet hat, nennt er eine Reihe von Textbeispielen. Auch für die inhaltlichen Umstellungen sowohl zwischen den Kapiteln eines Traktates als auch den Einfügungen aus anderen Traktaten des Bavli oder eigenen Hinzufügungen führt Shefer Beispiele an.9 Darüber hinaus behandelt er die durch Alfasi erfolgte Überarbeitung des Sefer ha-Halakhot, die Resonanz auf das Werk sowie die Besprechung verschiedener Kommentarwerke zum Sefer ha-Halakhot.10
1977 befasste sich Israel Francus mit Fehlern, die in verschiedenen Versionen des Sefer ha-Halakhot zu finden sind. Im ersten Teil seines Aufsatzes möchte Francus aufzeigen, dass es ursprünglich innerhalb der Ausführungen von Alfasi zu bShab 34a zwei zusätzliche Wörter gegeben habe, die den Kontext besser verstehen ließen. Diese Version sei nur im Sefer ha-Ittim erhalten geblieben; in allen heute bekannten Handschriften kämen diese zwei Worte nicht mehr vor, sodass der Kontext schwer verständlich werde. Er arbeitet zudem heraus, dass auch die Nachfolger von Alfasi, die sich mit seinem Text auseinandersetzten, nicht mehr diese im Sefer ha-Ittim erhaltene Version gekannt und daher Verständnisschwierigkeiten gehabt hätten. Im zweiten Teil meint Francus, den Fehler eines Wortes ausfindig zu machen, den bereits Gelehrte wie R. Nissim ben Reuben Gerondi oder Nachmanides in ihrer Rezeption des Alfasi vorgefunden hätten. Dadurch seien diese Gelehrten auf bestimmte Ausführungen zum Sefer ha-Halakhot gekommen.11 Francus hat noch weitere Artikel geschrieben, die sich mit Festlegungen des Alfasi auseinandersetzen. In zwei Artikeln diskutiert er Schwierigkeiten, die sich bei Alfasis Entscheidungen in Bezug auf Witwen ergeben. Francus interpretiert eine mögliche Bedeutung, weist anschließend jedoch auf Problemfälle hin, wenn er Responsen entdeckt, die seiner ersten Interpretation von Alfasis Aussagen zu widersprechen scheinen, und bietet Lösungsansätze dafür.12
Lee H. Snitzer hat 1982 die Werke von Alfasi, Maimonides und Josef Caro in Bezug auf die Regeln zu Körperverletzungen untersucht, mit dem Anspruch, die drei Werke miteinander zu vergleichen. Doch liegt sein Hauptfokus auf einem Vergleich des Schulchan Aruch (Josef Caro) und der Mischne Torah (Maimonides) zu diesen Themenbereichen. Nach der langen, vergleichend gegenübergestellten Übersetzung weist Snitzer auch selbst darauf hin, dass er sich in seiner Betrachtung hauptsächlich auf die zwei anderen Kodifikationswerke gestützt hat. Er möchte aber mit den dort eingebauten Passagen des Sefer ha-Halakhot veranschaulichen, dass die beiden anderen Werke durch die halakhischen Meinungen des Alfasi beeinflusst worden seien. Bevor Snitzer auf gewisse Unterschiede und Gemeinsamkeiten der drei Werke eingeht, hält er fest: „It is impossible to ascertain if Alfasi’s use of the literary features had any effect on the other two codifiers. This is in part since these features do not occur in corresponding halakhot shared by the other codes, but occur randomly throughout the codes.”13
Daraufhin bietet Snitzer eine kurze vergleichende Analyse, in der er zunächst den unterschiedlichen Umgang mit Quellen, die Nennung einzelner Gelehrter oder Quellen im Sefer ha-Halakhot und die anonyme Übernahme in den anderen beiden Werken hervorhebt. Hierbei beleuchtet Snitzer das Charakteristikum des Maimonides, an manchen Stellen in allgemeinen Floskeln auf andere Autoritäten zu verweisen, ohne direkt ihre Namen anzugeben. Zudem arbeitet Snitzer heraus, dass alle drei Gelehrten aus der Bibel zitieren und den Ansatz verfolgen, Hilfestellungen beim Verständnis der Halakha zu geben. Hinsichtlich des Sefer ha-Halakhot und der Mischne Torah hebt er als wesentliche Gemeinsamkeit hervor, ethische und moralische Aussagen in das jeweilige Kodifikationswerk mit aufzunehmen.14
1994 hat Steven Wald dargelegt, wie Alfasi talmudische Quellen in seinem Werk verwendet hat. Er verweist insbesondere auf den unterschiedlichen Ansatz Alfasis und der Tosafisten. So arbeitet Wald heraus, dass Alfasi bei widersprüchlichen Sugyot nach einer Version entscheide und die gegensätzliche Lesart nicht in das Werk aufnehme.15 Die Tosafisten hätten hingegen eine Notwendigkeit darin gesehen, solche Stellen zu harmonisieren, da sie den Talmud als eine Einheit betrachten würden. So hätten die Tosafisten auch „die Komponenten der einzelnen Sugya und ihren literarischen Rahmen wie aus einem Stück gemacht“16 angesehen, sodass die unterschiedlichen Quellen miteinander vereinbar sein müssten. Wald geht davon aus, dass Alfasi im Gegensatz dazu die unterschiedlichen Schichten für „losgelöste Überlieferungen“ hält. Wald stellt daher die These auf, Alfasi habe den Talmud als eine Art „Sammlung“17 verstanden, also als ein Werk, das auch widersprüchliche Stellen beinhalte. Er meint:
So wie Rif sich auf die Quellen und verschiedenen Quellen und Erklärungen, die in den unterschiedlichen Sugyot genannt werden, wie auf eine Sammlung von Optionen bezieht, die man abwägen und zwischen denen man entscheiden muss, so bezieht er sich auch in der einzelnen Sugya auf verschiedene Quellen und Erklärungen, die in ihren unterschiedlichen Schichten genannt wurden, wie auf eine Sammlung von verschiedenen Optionen, die man abwägen muss und zwischen denen man entscheiden muss.18
Im Kontrast dazu bezeichnet Wald den Talmud im Hinblick auf die Tosafisten als „Kodex“, da man bei der Einordnung des Werks unter diese Kategorie um eine Harmonisierung und Einigkeit bemüht sein müsse.19
Leonard Levy hat in seiner 2002 veröffentlichten Dissertation sechs Entscheidungsprinzipien des Alfasi analysiert. Zu diesem Zweck hat er jene Stellen untersucht, an denen Alfasi explizit eines dieser Prinzipien nennt. Er verweist auf vier Entscheidungskategorien, wobei er sich in seiner Analyse auf die erste fokussiert: „[…] principles which decide the law based on the way opinions are presented in the Talmud.“20 Zunächst untersucht Levy Alfasis Quellenumgang mit jeweils einem Entscheidungsprinzip. Im ersten Kapitel analysiert Levy das Prinzip, dass die Halakha eindeutig durch den anonymen („stam“) Talmud oder einen Amoräer entschieden worden ist. Im zweiten Kapitel beleuchtet er unwidersprochene amoräische Aussagen, die als Halakha gelten. Im dritten Kapitel untersucht Levy das Prinzip, dass jede tannaitische Lehre oder amoräische Aussage, die dafür genutzt wird, eine Diskussion anzugreifen, als autoritativ anzusehen ist. Im vierten Kapitel analysiert Levy das Prinzip der Schlussfolgerungen (מסקנא). Im fünften Abschnitt beleuchtet er das Prinzip der Sugyan/Sugya: Zu Beginn dieses Kapitels führt Levy aus, Alfasi zeige implizite Anzeichen, dass eine Lehrmeinung des Talmuds bevorzugt werde, mit den Begriffen סוגיין oder סוגיא דשמעתא an.21 Er arbeitet ebenfalls das Verständnis des Alfasi bezüglich des Begriffs Sugyan und die Unterschiede zu anderen Gelehrten zur Zeit der Geonim22 sowie das unterschiedliche Verständnis von bSanhedrin 6a heraus: „Instead of understanding the term סוגיין בעלמא to refer to principles of adjudication between specific Tannaim or Amoraim, as the Geonim used this term and as Alfasi himself used it in the places noted above23, he understands ‚our going‘ to refer to the ‚going‘ of the stam Talmud.“24
Levy ist der Ansicht, dass Alfasi diesen Begriff ähnlich dem Verständnis von „wir stellen eine Schwierigkeit auf“ auffasst. Dieser werde ebenfalls so verstanden, dass er sich auf den anonymen Teil des Talmuds beziehe.25 Er arbeitet zudem drei Kriterien heraus, wann das Prinzip dieser Entscheidung angewandt wird.26 Levy verweist auf eine gewisse Überlappung der Begriffe „Sugyan“ und der Schlussfolgerung (מסקנא).27 Er geht aber dennoch davon aus, dass der Begriff „Sugyan“ von Alfasi nur dafür verwendet werde, wenn der Talmud implizit der Meinung eines Tannaiten oder Amoräers recht gebe, wobei diese sowohl durch ein Argument als auch durch eine Schlussfolgerung vorgetragen worden sein kann.28 Die Benutzung von „Sugyan“ wird im Folgenden von ihm noch weiter und in Abgrenzung zum Wort „Sugya“ untersucht. Zum Ende seiner Untersuchung zu Sugyan/Sugya hält Levy fest: „[…] Alfasi defines סוגיין as a principle separate and distinct from those principles. When it can logically be deduced that stam Talmud presumed the opinion of one of the Tannaim or Amoraim in dispute, a judge must decide between the disputants on that basis or else he is guilty of an error in judicial discretion.“29
Als sechstes Entscheidungsprinzip identifiziert Levy Alfasis Umgang mit den Formulierungen „מדמקשינן ומפרקינן אליביה“ und „מדפרשינן מיליה“.
Aufgrund seiner Analyse geht Levi davon aus, dass Alfasi die Quellen im Talmud einem Autor zuschreibe, sie damit als autoritativ ansehe und auf dieser Grundlage ediere. Levy ist demnach der Ansicht, dass für Alfasi die Schlussfolgerung der Gemara autoritativer als die Ausführung eines späten Amoräers ist. Auch habe für Alfasi eine amoräische Aussage, die er dem Editor des Talmuds zuschreibe, vor der Aussage eines bestimmten Amoräers Vorrang.
Der Ansatz ist sicherlich interessant, doch weist Levy selbst darauf hin, dass er ausschließlich jene Stellen betrachte, an denen Alfasi explizit seine Entscheidungsprinzipien offenlegt. Es wird dabei allerdings nicht ersichtlich, wie Alfasi letztendlich mit seinen talmudischen Quellen umgeht, um seine Entscheidungen festzulegen, wenn er seine Entscheidungsprinzipien nicht explizit nennt. Zudem erkennt der Leser anhand von Levys Ausführungen nicht, wie Alfasi seine Regeln durch Auslassungen oder eine andere Zusammenstellung der Talmudstellen festlegt.
Ezra Sheveṭ stellt in einem 2006 veröffentlichten Aufsatz die Arbeit für eine geplante Edition des Sefer ha-Halakhot vor, bei der versucht wird, Alfasis ursprünglichen Text zu rekonstruieren. Er erklärt dabei zunächst, wie vorgegangen wurde, um diese Version zu entdecken. Für die Edition wurden folgende Quellen hinzugezogen: verschiedene Handschriften, die unter Berücksichtigung des Zeitpunktes und Ortes ihres Entstehens dem Ursp...