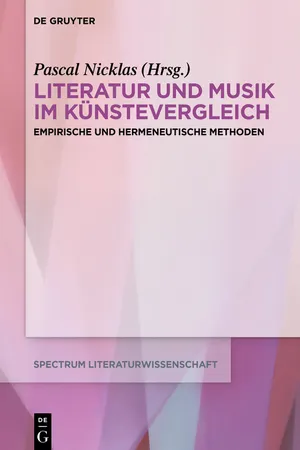Für Alain Badiou ist eine „unreine Kunstform“ (2012, 138) eine solche, in deren Werken verschiedene Künste zusammenkommen: In der Oper beispielsweise die Musik, der Gesang, das Schauspiel, die Dichtung. Um zu einem Kunstwerk zu werden, wird sie dieses Mischungsverhältnis in einer solchen Klarheit und Exaktheit bestimmen, dass wir nicht anders empfinden können und dieses Verhältnis als konsequent und richtig verstehen. Das schließt die Brüche, Überlappungen, Verwischungen, Undeutlichkeiten, Wiederholungen und Entgegensetzungen nicht aus, sondern sie gehören vielmehr in dieser Form zusammen. Als unreine Kunstform eignet sich die Oper wie sonst vielleicht nur das Kino hervorragend dazu, spezifische Fragen über den Charakter des Werkes zu stellen, die seine Einheit, Reinheit und Größe betreffen: Wenn ein einheitlich und rein geformtes Werk uns oft als großes Werk der Kunst erscheint, dann bevorzugt die Kunst der Gegenwart das gemischte, unreine und minoritäre Werk. Anders herum vermeidet die gegenwärtige Kunst die Geste der ‚großen Kunst‘, weil sie die Momente der Einheit und Reinheit eher zu unterminieren denn hervorzubringen sucht. Die Kategorien der Reinheit, Einheit und Größe weisen so über das einzelne Werk hinaus: Nicht dass sie nur Interpretationsmuster markieren, sondern sie weisen darauf hin, dass Kunstwerke uns etwas zu denken geben, dass sie uns spezifische Entwürfe dieser Kategorien zu denken geben.
Vor dem Hintergrund dieser Gegenüberstellung stellt dann jedoch gerade die Oper eine Frage: Nämlich die Frage danach, was eine reine Form in einer unreinen Kunstform eigentlich bedeutet. Ähnlich stellt sie als Mischungsverhältnis die Frage danach, was die Einheitlichkeit eines Werkes bedeutet. Wenn sich jedoch an einzelnen Werken zeigen lässt, dass eine reine Form gerade die Unreinheit als solche geschehen lässt und dass die Einheitlichkeit des Werkes die Einheitlichkeit dieses Geschehens ist, dann erscheint auch die Frage nach der ‚großen Kunst‘ in einem anderen Licht.
Dies bedeutet jedoch auch, dass sich anhand der Oper Fragen zum Prozess des Kunstwerks stellen lassen, die in doppeltem Sinn über die Oper hinausreichen: Zum einen stellen sich in ihr Fragen, die in Bezug auf die Reinheit der Form Kunstwerke überhaupt betreffen. Zum anderen stellen sich in ihr Fragen der Mischung nicht nur künstlerischer Mittel, sondern auch der Mischung mit außerkünstlerischen Momenten: Beispielsweise der Philosophie und der Politik. So stellt die Oper jedoch auch eine Herausforderung für die Philosophie dar, wenn Philosophie der Platz genannt wird, an dem die möglichen Unterschiede in der Bestimmung der Fragen der Reinheit, der Einheit und der ‚großen Kunst‘ gesammelt werden. Und es bedeutet auch, dass die Oper Fragen der Mischung stellt, die heute erneut so dringend vor uns stehen, nachdem das zwanzigste Jahrhundert versucht hatte, diese Fragen einseitig zu bescheiden.
1
In seiner Verteidigung Wagners hat Alain Badiou unter anderem die „Frage der ‚großen Kunst‘“ (2012, 86) aufgegriffen, um sie als eine Herausforderung der heutigen Zeit zu affirmieren: Was wir benötigen, ist weniger eine Distanz zu dem, was wir implizit unter dem Stichwort ‚große Kunst‘ verstehen (Vereinnahmung! Ungleichheit! Herrschaft!), als vielmehr ein neues Verständnis dessen, was ‚große Kunst‘ zu bedeuten vermag, und das führt schließlich auf ein neues Verständnis ihres Platzes in unserer symbolischen Ordnung. Wir sind nicht über große Kunst hinaus, uns fehlt große Kunst.
Warum dem so sei, das ist eine Frage, die Badiou in anderen Texten zu beantworten gesucht hat. Allein, um den Rahmen abzustecken, sei gesagt, dass wir für Badiou nach dem Scheitern der Avantgarden in einer Zeit leben, in der die Kunst zwischen einem „Pseudo-Klassizismus“ einerseits und einem „romantischen Formalismus“ andererseits hin- und herschwankt: Große Spiele vereint mit großen Gefühlen als Ausdrücke der Körper (Vgl. Badiou 2007). Beides sind trügerische Paradigmen, da sie die Kunst entweder in den Kommerz überführen oder aber im Dasein der Körper verankern. Die Antwort auf die Frage nach dem, was uns fehlt, wenn uns ‚große Kunst‘ fehlt, lässt sich jedoch auch anders erreichen: Nämlich in einer Bestandsaufnahme einer ihrer letzten erklärten Erfüllungen – Wagner.
Einer der Aspekte, die die Frage der ‚großen Kunst‘ für Badiou entscheidend bestimmen, ist ihr Verhältnis zur Totalität. Die Kunst der Avantgarden im frühen zwanzigsten Jahrhundert hat noch um die Frage der Totalität gekämpft, aber in dem Versuch, sie zu brechen. Es liegt in diesem Bruch der Norm begründet, dass die Avantgarden implizit politisch sind (Badiou 2006). Dieser Bruch passt sie in das zwanzigste Jahrhundert ein, das die beiden Pole von Affirmation und Nihilismus in einer „disjunktiven Synthese“ zusammen zu zwingen sucht, mit einer Gewalt, die die „Stelle einer fehlenden Konjunktion“ ausfüllen soll (Badiou 2006, 45). Wenn ein Aspekt der heutigen Situation der Kunst im Scheitern der Avantgarden zu finden ist, dann liegt es nahe, den Bezugspunkt der Totalität zu befragen, in den immanent auch die Verknüpfung von Kunst und Politik eingetragen ist – als Affirmation oder Unterbrechung der Norm, des Ganzen, des transzendenten Zusammenhangs. Nun ist Wagner das Beispiel schlechthin nicht für die Unterbrechung und Befragung, sondern zunächst ein Paradigma für den Versuch der Errichtung eines alles umfassenden transzendenten Zusammenhangs. Badious Beispiel ist hier Lacoue-Labarthes Wagner-Kritik, es ließe sich aber auch Adorno anführen, der in seinem Versuch über Wagner schrieb: „Bei Wagner überwiegt denn auch schon das totalitär-herrschaftliche Moment der Atomisierung; jene Entwertung des Einzelmoments gegenüber der Totalität, die echte, dialektische Wechselwirkungen ausschließt“ (Adorno 1997, 48–49). Ein paar Zeilen weiter wird jedoch die Totalität bei Wagner als widersprüchlich begriffen, was auf das Kernargument Adornos gegen Wagner hinausläuft, nämlich auf die Konstatierung einer undialektischen Doppeldeutigkeit, die aufgrund ihrer Unveränderlichkeit eine Naturalisierung in Szene setzt. Transzendenz wird für Adorno bei Wagner letztlich durch die Phantasmagorie ersetzt, den Schein des falschen Zusammenhangs, der dennoch die Unveränderlichkeit propagiert, das Schließen des Rings zum Immergleichen. Dies führt auf das Problem der transzendenten Schließung: Das Ganze unterwirft sich das Einzelne, und weil das Ganze sich nicht mehr entlang des Einzelnen begründet („undialektisch“), kann das Ganze auch als ‚transzendent‘ verstanden werden, das sich schließt und dauerhaft wiederholt. Adornos Unterscheidung zu Gunsten der Phantasmagorie ist letztlich eine Modifikation der Transzendenz. Transzendente Totalität: das ist das problematische Gesicht ‚großer Kunst‘.
Begreifen wir diese Struktur als Problem der Frage nach der ‚großen Kunst‘ – Totalität, Naturalisierung, Schließung – dann müsste Wagner, wenn er als Beispiel gerade für eine solche ‚große Kunst‘ gelten könnte, die uns heute fehlt, ein Wagner sein, der in einer bestimmten Hinsicht betrachtet wird, ein Wagner, der sich unterscheidet von einem anderen Wagner, in dem die „Ästhetisierung der Totalität“ (Badiou 2012, 88) zu beobachten ist, die letztlich auf alle jene Momente führt, auf die die Kritik an Wagner zielt. Oder anders: Wenn über Wagner ein gegenwärtiger Mangel von ‚großer Kunst‘ gefasst werden kann, dann müsste in Wagner weniger ihre Bestimmung als vielmehr ihre Fragwürdigkeit auftauchen. Es müsste sich zeigen, dass die Frage der ‚großen Kunst‘ gerade nicht abgeschlossen ist.
Badiou schlägt somit vor, eine Trennung in Wagner einzuführen, eine Trennung, die jedoch nicht den einen von dem anderen Wagner unterscheidet: nicht also dem Wagner der ‚großen Kunst‘ einen der ‚Kunst des Kleinen‘ gegenüberstellt. Es geht vielmehr um einen anderen Begriff ‚großer Kunst‘. Diese Operation vereinigt mehrere Züge auf mehreren Ebenen, die es zunächst nachzuvollziehen gilt. Hierzu sei eine ausführlichere Stelle zitiert, in der die verschiedenen Momente dieser Operation zusammengeführt werden:
Wir müssen Wagner als jemanden begreifen, der sich heute anders verstehen lässt, als er sich selbst verstand, oder anders, als ihn jene verstanden, die den ‚Fall Wagner‘ konstruiert haben. Das ist meine Hypothese. Wenn es sich so verhält, ließe sich Wagner nicht mehr ausschließlich als Totalität betrachten, weil das, womit wir uns beschäftigen, Größe ohne Totalität ist. Wir lassen uns also auf eine Fragmentierung Wagners ein. Das bedeutet nicht unbedingt, dass man keine Totalität mehr kennt, sondern dass sich ihre Spur in der Fragmentierung oder Lokalisierung findet, dort, wo – musikalisch und dramatisch – Kontinuität und Dissonanz, Lokales und Globales aufeinandertreffen. Wenn wir Wagner – durch sein Werden, seinen künstlerischen Prozess, sozusagen mikroskopisch – in seiner eigenen, einmaligen Form der Fragmentierung begreifen, bin ich davon überzeugt, dass er sich gerade da, wo Kontinuität und Dissonanz, Lokales und Globales aufeinandertreffen, gegen die sechs Anklagepunkte, die gegen ihn vorgebracht wurden, verteidigen lässt.
(Badiou 2012, 88–89)
Der Unterschied, der hier eingezogen wird, betrifft den strukturellen Platz der Totalität: Anstatt Totalität als die umfassende Einheit ei...