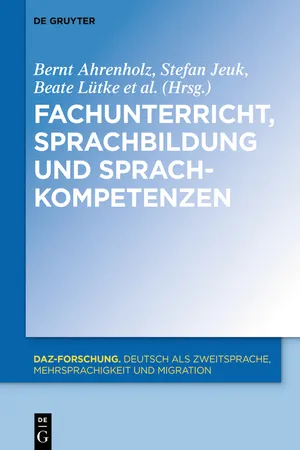
eBook - ePub
Fachunterricht, Sprachbildung und Sprachkompetenzen
- 362 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Fachunterricht, Sprachbildung und Sprachkompetenzen
Über dieses Buch
Die Bedeutung lexikalischer, diskursiver und textueller sprachlicher Mittel schulischer Wissensvermittlung und -aneignung ist in den letzten Jahren vielfach als "Register Bildungssprache" diskutiert worden. Empirische Beschreibungen sowie diagnostische Verfahren sind häufig Gegenstand wissenschaftlicher und praxisbezogener Projekte. Der Band adressiert das "Register Bildungssprache" und die weitreichenden Implikationen für den Fachunterricht.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Fachunterricht, Sprachbildung und Sprachkompetenzen von Bernt Ahrenholz, Stefan Jeuk, Beate Lütke, Jennifer Paetsch, Heike Roll, Bernt Ahrenholz,Stefan Jeuk,Beate Lütke,Jennifer Paetsch,Heike Roll im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Languages & Linguistics & German Language. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information

III Texte und Textverstehen
Hansjakob Schneider, Eliane Gilg, Miriam Dittmar und Claudia Schmellentin
Prinzipien der Verständlichkeit in Schulbüchern der Biologie auf der Sekundarstufe 1
1 Einleitung
Lernen geschieht in der Schule immer auch vermittelt über Sprache. Dies gilt für das Fach Deutsch, das Sprache zum Beobachtungsgegenstand hat, ebenso wie für alle anderen Fächer. Auch in den naturwissenschaftlichen Fächern sind ausreichende Sprachkompetenzen in mehrfacher Hinsicht von hoher Bedeutung: Die naturwissenschaftlichen Fächer bedienen sich einer schulisch gefärbten Fachsprache, die dem Lernen dienen soll. Dieses schulisch geprägte Sprachregister enthält einerseits Merkmale disziplinenspezifischer Wissenschaftssprache (z. B. Fachwortschatz) und andererseits auch Merkmale allgemeiner Wissenschaftssprache, im Fall des Wortschatzes etwa Wörter wie Struktur, Funktion, analysieren, interpretieren (so genannte all-purpose academic words, Snow 2010). Mit anderen Worten: Der Gebrauch von Sprache im Fachunterricht erfordert einerseits disziplinenspezifische Sprachkompetenzen, andererseits auch allgemein bildungssprachliche Kompetenzen. Dazu gehört die Einsicht in die Struktur von Texten oder auch von typisch bildungssprachlichen Diskursfunktionen wie etwa Definieren, Zusammenfassen, Beschreiben, Erklären, Argumentieren u. a. (Vollmer 2010, Vollmer/Thürmann 2010).
Wenn die oben angesprochenen Sprachkompetenzen nicht genügend ausgebildet sind, stellt sich Misserfolg nicht nur im Fach Deutsch, sondern auch in den anderen Fächern ein. Im Fall des Naturwissenschaftsunterrichts halten Bolte/Pastille (2010: 27) fest: „Lernende mit ohnehin eingeschränkter Sprachkompetenz erleben in den naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächern ein frühes und oftmals endgültiges Scheitern.“ Hier ist anzumerken, dass nicht nur die Stoffvermittlung zum Auftrag eines Schulfachs gehört, sondern auch der Aufbau einer scientific literacy als der Fähigkeit, sich bspw. naturwissenschaftliches Wissen erschließen und Naturphänomene erklären zu können (OECD 2013: 100). Mit diesen Fähigkeiten sind auch sprachliche Kompetenzen verbunden, und die Schulfächer sind verpflichtet, diese Fähigkeiten bei den Schülerinnen und Schülern auszubilden.
Im vorliegenden Beitrag wird die Rolle der Sprache im Fachlernen am Beispiel des Verstehens von biologischen Schulbuchtexten ausgeleuchtet. Er ist wie folgt strukturiert: Im zweiten Abschnitt werden die oben angesprochenen Ebenen des Sprachlichen in Schulbuchtexten genauer betrachtet und sprachdidaktische Hintergründe referiert. Im dritten Abschnitt wird das Forschungsprojekt Textverstehen in den naturwissenschaftlichen Schulfächern vorgestellt, auf das sich der Rest des Beitrags bezieht. Dabei wird auch gezeigt, dass die sprachliche Realisierung in Schulbuchtexten öfters nicht optimal ist. Aus dieser Studie werden im vierten Abschnitt Analysen gezeigt, welche auf die Herausarbeitung von Prinzipien der Textgestaltung fokussiert sind. Die Herleitung dieser Prinzipien wird erläutert und die Prinzipien selbst inhaltlich gefasst. Im fünften Abschnitt folgt ein Fazit und eine Diskussion der Textgestaltungsprinzipien.
2 Merkmale schulischer Fachtexte
Im Folgenden wird die Sprache in schulischen Fachtexten betrachtet, die in der Literatur oft als bildungssprachliches Register bezeichnet wird (z. B. Feilke 2012, Morek/Heller 2012). Die meisten Abhandlungen zur Bildungssprache enthalten Aufzählungen zu den sprachlichen Besonderheiten dieses Registers, die sich weitgehend mit den Merkmalen konzeptioneller Schriftlichkeit (Koch/Oesterreicher 1994) decken; meist werden diese Merkmale noch linguistischen Ebenen zugeordnet (Syntax, Wortschatz usw., z. B. Gogolin/Lange 2011). In diesem Abschnitt wird darüber hinausgehend die funktionale Seite mit Bezug zu einschlägiger Literatur (Schleppegrell 2004, Feilke 2012, Czicza/Hennig 2011) in den Blick genommen. Dies geschieht in der Analyse verschiedener varietätenlinguistischer Ebenen, die in Schulbuchtexte hineinspielen: Schulbuchtexte sind einerseits der konzeptionellen Schriftlichkeit verpflichtet (2.1). Sie enthalten gleichzeitig Merkmale wissenschaftlicher Fachtexte (2.2) und schließlich sind sie Texte, die spezifisch für das schulische Lernen geschaffen worden sind (2.3). Diese drei Ebenen werden in der Folge genauer untersucht.
2.1 Schulische Fachtexte als konzeptionell schriftliche Texte
Schulische Fachtexte sind Texte, die sich an den Normen und Gepflogenheiten der konzeptionellen Schriftlichkeit orientieren. Auf der textlinguistischen Ebene sind dabei die beiden (Dimensionen Kohäsion und Kohärenz maßgebend (Fix 2008). Die „Disziplin des schriftlichen Ausdrucks“ (Habermas 1977: 39) erfordert einen hohen Grad an Befolgung dieser textlinguistischen Prinzipien, weil Rücksprache meistens nicht direkt möglich ist. Damit der Kohärenzaufbau auf Seiten der Rezipienten gelingen kann und nicht zu viel Spielraum offen bleibt, muss das Gebot der syntaktisch und semantisch klaren Strukturiertheit für Schulbuchtexte als konzeptionell schriftliche Texte gelten. Verstöße gegen dieses Gebot sind Verstöße gegen die Normen der konzeptionellen Schriftlichkeit und können zu erheblichen Verstehensproblemen, verbunden mit eingeschränktem Lerngewinn, führen.
In Schulbuchtexten werden Informationen nicht nur mittels Text im engeren Sinn vermittelt, sondern auch mittels Bildern (vgl. Dittmar, Schmellentin, Gilg & Schneider 2017). Es gilt also auch, zwischen Text und Bild sowie zwischen den Bildern Kohärenz herzustellen. Kohäsionsmittel spielen entsprechend auch bei der Kohärenzherstellung zwischen Text und Bild bzw. Bild und Bild eine große Rolle: So sollte die Text-Bild-Kohäsion explizit sein, z. B. über kataphorische Verweise im Text (siehe Abbildung 1), die Bild-Bild-Kohärenz kann u. a. durch die Kohäsion zwischen Bildern bzw. Bildteilen unterstützt werden, z. B. mittels Pfeilen zwischen Bildern oder durch die Nebeneinanderstellung von sequentiell zu lesenden Abbildungen. Dass sich auch Schulbuchtexte an den Normen der Schriftlichkeit orientieren müssen, klingt banal, eine Analyse solcher Texte zeigt aber erstaunlich viele unter der Perspektive der konzeptionellen Schriftlichkeit ungünstige Passagen.
2.2 Schulische Fachtexte als Texte der Wissenschaftssprache
Jede Bezugsdisziplin der Schulfächer hat ihre eigene wissenschaftliche Fachsprache aufgebaut, die grundsätzlich auch im schulischen Unterricht verwendet wird. Vor dem Hintergrund der pragmatischen Bedingungen von wissenschaftlichen Texten haben Czicza/Hennig (2011) vier Gebote für solche Texte aufgestellt, Präzision, Ökonomie, Origo-Exklusivität und Diskussion, die in der Folge in Bezug auf Schulbuchtexte diskutiert werden.10
(1) Präzision
Wissenschaftliche Fachtexte enthalten immer komplexe und differenzierte Inhalte. Um diese Inhalte und Konzepte nachvollziehbar darzustellen, muss die Sprache präzise sein. Präzision zeigt sich bspw. in der Definition und der durchgängig gleichen Verwendung von Fachwörtern und umgekehrt in der Bezeichnung eines Phänomens durch das gleiche Fachwort. Dieser Anspruch gilt im Prinzip auch für die schulische Fachsprache. Allerdings werden Fachwörter auf dem Niveau der Sekundarstufe I oft nicht in ihrer umfassenden fachlichen Bedeutung eingeführt und verwendet, weil das dazu notwendige Fachwissen nicht vorausgesetzt und auch nicht aufgebaut werden kann. Wenn im Fach Biologie etwa der Begriff Knorpel eingeführt wird, dann werden nicht alle fachwissenschaftlich exakten strukturellen Eigenschaften des Knorpels abgehandelt.
(2) Ökonomie
Insbesondere für wissenschaftliche Fachtexte, in denen komplexe Inhalte differenziert dargestellt werden, muss das Gebot der Ökonomie zum Tragen kommen, weil sonst zu lange und komplexe Sätze/Texte entstehen würden, die von den Lesenden nur mit Mühe verarbeitet werden könnten. Das Gebot der Ökonomie leitet sich ab von den kognitiven Ressourcen, die für die Verarbeitung einer Textpassage zur Verfügung stehen. Typischerweise führt das Gebot der Ökonomie zu Verdichtungen im Text, bspw. zu komplexen Präpositional- bzw. Nominalphrasen. Diese Verdichtungen haben den Zweck, dass Information, die sich sonst über verschiedene Teilsätze verteilen würde, kompakt dargeboten wird.
(3) Origo-Exklusivität
Ein Ziel von wissenschaftlicher Tätigkeit ist allgemeingültige wissenschaftliche Aussagen zu machen. Sprachlich manifestiert sich dieses Ziel in der Vermeidung von subjektiven Standpunkten. So dominieren unpersönliche, distanzierte, nicht an Person, Ort oder Zeit gebundene sprachliche Formen wie das Passiv oder das generische Präsens. Diese für Schülerinnen und Schüler häufig unvertraute unpersönliche Sprache findet sich auch in schulischen Fachtexten.
(4) Diskussion/Diskursivität
Wissenschaftliche Texte sind typischerweise in einen intertextuellen Diskurs eingebettet, der das Ziel verfolgt, durch die kr...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Inhalt
- Sprache im fachlichen Unterricht. Eine Einleitung
- I Forschungsperspektiven
- II Diagnose
- III Texte und Textverstehen
- IV Mündliche Partizipation am Unterricht
- V Texte schreiben im Unterricht
- VI Lehrkräftebildung